
| Mit der Suche nach • 7-3.2 wird der Abschnitt 7-3.2 gefunden. Mit Verb werden alle Vorkommen des Wortes Verb gefunden (genau ausgedrückt: der Zeichenkette Verb). Eine Suche nach •• 4 oder •• Adjunkt führt zum Beginn des Kapitels 4 Adjunkte, die Suche nach ••• zum Dateibeginn. | |
 |
Diese Suchdatei enthält alle Einträge des Wörterbuchs Deutsch - Filipino. Sie ist deshalb sehr lang und kann bei langsamem mobilen Internet schwierig zu gebauchen sein. Dann sollte nach Beenden der Suche wieder auf die Einzeldateien dieses Webplatzes ( www.germanlipa.de ) zurüchgegangen werden. |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_such_kopf.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
🔎
14A
15A
15A
16A
Ugn
Vollbild
| 3A Anhang zu Objunkte | |
| 3A-401 Σ Wechsel von Objunkt nach Adjunkt, Nominalphrase ohne Kernwort. | 3A |
| 11A Anhang zu Kurzwörter | |
| 11A-621 Σ Spaltung der Nominalphrase, die das Subjekt in einem Existenzsatz bildet. 11A-651 Σ Existenzinterklit. | 11A ↑ ↑ |
| 14A Schlüsselsystem | ||||
| 14-1 Einleitung | 14A | |||
| 14A-2 Allgemeines. 14A-3 Verb. 14A-4 Substantiv. 14A-5 Adjektiv und Adverb. 14A-6 Pronomen. 14A-7 Andere Wortarten. 14A-8 Phrasen. 14A-9 Teilsätze. | ↑ ↑ | |||
| 15A Anhang: Sach- und Wortweiser | 15A | |||
| Als Ergänzung zum Inhaltsverzeichnis. | ||||
| 15A Anhang: Talatawagan | 15A AE FN OS TZ | |||
| 16A Anhang: Quellenverzeichnis und Werstatt-Korpus | 16A | |||
| 16A-1 Linguistische Quellen. 16A-2 Sonstige Quellen. 16A-3 Ergänzende Studien. | ||||
| Buchausgabe (pdf-Datei) | ↑ ↑ | |||
Unsere Syntax der filipinischen Sprache ist in deutscher und filipinischer Sprache Syntax der filipinischen Sprache - Palaugnayan ng Wikang Filipino als elektronisches Buch (pdf-Datei) bei der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) allgemein zugänglich. Die Publikation hat den URN (Uniform Resource Name) der Deutschen Nationalbibliothek http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-360807 bzw. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-360807 . Die Datei wurde am 12. November 2019 aufgenommen und ist 9.6 MB groß (744 Seiten).
Eine Zählung mit Hilfe unserer Suchprogramme ergab:
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_titel.html
| Man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den einfachen Mann auf dem Markt fragen und denen auf das Maul sehen, wie sie reden. Martin Luther (1530) {1A-101 |
Linguistik stand und steht in den Philippinen
stark unter ausländischem Einfluss. Es begann mit den spanischen Priestern, die die
lokalen Sprachen in den Philippinen lernen mussten, um die einheimische Bevölkerung den
katholischen Glauben zu lehren. So ist das erste in den Philippinen
gedruckte Buch von einem spanischen Priester zweisprachig in Spanisch und Tagalog
geschrieben {![]() DC 1593}. Das Spanisch ist inzwischen vom (amerikanischen)
Englisch abgelöst worden, und der ausländische Einfluss ist sicher noch stärker
geworden. Heute hat nahezu jeder bessere Professor ganz oder ein paar Semester in den
Vereinigten Staaten studiert. Für ein Tagalog-Englisch
Wörterbuch schreibt die philippinische Staatspräsidentin das Vorwort in Englisch.
DC 1593}. Das Spanisch ist inzwischen vom (amerikanischen)
Englisch abgelöst worden, und der ausländische Einfluss ist sicher noch stärker
geworden. Heute hat nahezu jeder bessere Professor ganz oder ein paar Semester in den
Vereinigten Staaten studiert. Für ein Tagalog-Englisch
Wörterbuch schreibt die philippinische Staatspräsidentin das Vorwort in Englisch.
Bewusst oder unbewusst wurden die philippinischen Sprachen und heute das Filipino
stets in die Nähe der Fremdsprache gebracht {1A-111 ![]() }. Die spanischen
Mönche mussten ihre katholischen Texte in die lokalen Sprachen übersetzen. Heute
müssen philippinische Grundschüler Englisch lernen, um ihre Rechenbücher lesen zu
können.
}. Die spanischen
Mönche mussten ihre katholischen Texte in die lokalen Sprachen übersetzen. Heute
müssen philippinische Grundschüler Englisch lernen, um ihre Rechenbücher lesen zu
können.
Wenn man die eigene Sprache studiert, um sie mit einer Fremdsprache (und zwar mit einer europäischen, niemals mit z.B. Chinesisch oder Indonesisch) zu vergleichen, wird man zwangsläufig den eigentlichen Mittelpunkt der eigenen Sprache verlassen und sich dorthin begeben, wo die eigene Sprache der Fremdsprache am ähnlichsten ist. Damit werden keine eigentlichen Fehler begangen, aber typische Elemente der eigenen Sprache können undeutlicher hervortreten oder ganz verschwinden.
Muttersprache (wikang kinagisnan) → {1A-112}
(1) Formal ist Filipino die offiziell in der philippinischen Verfassung von 1987 genannte Sprache. Dort ist die Landessprache "Filipino" festgelegt und Englisch "bis auf weiteres" als Amt-, Handels- und Unterrichtssprache beibehalten.
Als gesprochene und geschriebene Sprache verstehen wir unter Filipino die Sprache, die von Filipinos der mittleren und oberen sozialen und Ausbildungsgruppen landesweit als Umgangssprache und Kommunikationsmittel verwendet wird {1A-121}. Diese Sprache zeigt kaum regionale Unterschiede. Daneben gibt es weitere Sprachen und Dialekte, die nur selten schriftlich verwendet werden. Zwischen geschriebenem Filipino und Tagalog gibt es kaum Unterschiede. Deshalb besteht kein Grund mehr, für die gegenwärtige landesweite Sprache den Namen Tagalog beizubehalten.
(2) Da in den Philippinen wenig gelesen und geschrieben wird, ist die Auswahl an geschriebenem Filipino nicht sehr groß.
(3) Zum Studium der Schriftsprache haben wir eine Textsammlung
erstellt, die vorwiegend Texte aus dem Wochenblatt {![]() Liwayway} enthält,
aber auch Auszüge aus filipinischen Buchtexten {16A-2}. Diese Textsammlung (eine Angabe zu ihrem Umfang: Sie enthält
mehr als 10 000 Sätze und etwa 6000-mal das Wort ang) kann digitalisch mit Hilfe
eines Suchprogramms ausgewertet werden, daher sprechen wir von unserem
'Werkstatt-Korpus'.
Liwayway} enthält,
aber auch Auszüge aus filipinischen Buchtexten {16A-2}. Diese Textsammlung (eine Angabe zu ihrem Umfang: Sie enthält
mehr als 10 000 Sätze und etwa 6000-mal das Wort ang) kann digitalisch mit Hilfe
eines Suchprogramms ausgewertet werden, daher sprechen wir von unserem
'Werkstatt-Korpus'.
(4) Die Vereinheitlichung der gesprochenen Sprache schreitet schnell voran. Den größten Einfluss hat vermutlich das landesweite Fernsehen. Die Mobilität der Bevölkerung ist groß, insbesondere zieht der Großraum Manila junge Leute aus allen Provinzen an, die in ihrer neuen Umgebung kein typisches Tagalog mehr sprechen lernen, sondern ein Umgangsfilipino. Durch Besuche zu Hause und durch moderne Kommunikation (Mobiltelefon) wird dieses Filipino in die Provinzen gebracht.
(1) Wir haben uns die Aufgabe gestellt, einige wichtige Merkmale der filipinischen Sprache zu betrachten, ohne sie im Vergleich zu europäischen Sprachen zu sehen. Auf den Gebieten der Phonologie und Morphologie ist die Eigenständigkeit der filipinischen Sprache (mit Gemeinsamkeiten innerhalb der austronesischen Sprachfamilie) deutlich erkennbar und unumstritten. In der Lexikologie ist die Thematik der spanischen, chinesischen und englischen Fremdwörter deutlich sichtbar.
Anders auf dem Gebiet der Syntax. Wir haben kaum Arbeiten gefunden, die die filipinische Syntax aus der eigenen Sprache her entwickeln. Vielmehr werden häufig Ansätze der Syntax europäischer Sprachen (der klassischen Sprachen und der zwei Kolonialsprachen der Philippinen Spanisch und Englisch) zur Beschreibung der filipinischen Syntax übernommen. Dabei wird wenig darauf geachtet, ob diese Ansätze den Eigenheiten dieser Sprache Rechnung tragen. Deshalb erschien es uns sinnvoll, unsere Studie der filipinischen Syntax zu widmen. Hinzu kommt, dass in der morphologisch formenarmen filipinischen Sprache der Syntax eine besondere Bedeutung zukommt.
(2) Wenn wir von der Syntax der filipinischen Sprache sprechen,
setzen wir stillschweigend voraus, dass es genügend syntaktische Gemeinsamkeiten der
philippinischen Sprachen gibt, um einen solchen Ansatz zu rechtfertigen. Diese Frage wird
gegenstandslos, wenn man Filipino als ein landesweites Tagalog ansieht, was der heutigen
Praxis entspricht. Von vielen Autoren werden die Unterschiede der verschiedenen
philippinischen Sprachen hervorgehoben (statt von Wikang Filipino wird heute häufig
von Mga Wika sa Pilipinas gesprochen), aber wir haben dort keine oder nur
unerhebliche Hinweise auf Unterschiede in der Syntax gefunden. Ein weiterer Zeuge ist die
Arbeit von {![]() Kroeger 1991}, in der sich an verschiedenen Stellen Aussagen
wie 'in Tagalog, and in Philippine languages generally'
finden.
Kroeger 1991}, in der sich an verschiedenen Stellen Aussagen
wie 'in Tagalog, and in Philippine languages generally'
finden.
(1) In der philippinischen Gesellschaft ist der ausländische Einfluss sehr stark, vermutlich stärker als in jedem anderen Land vergleichbarer Größe. Die spanische Kolonisation hat die katholische Religion und ein Stück europäischer Zivilisation in die Philippinen gebracht. Während der anschließenden Kolonialzeit unter den Vereinigten Staaten erhielten die Philippinen ein kapitalistisches Wirtschaftssystem und ein auf der englischen Sprache basierendes Schulsystem. Die koloniale Einflussnahme wurde dadurch erleichtert, dass die philippinische Gesellschaft nur wenig eigenständige Elemente entwickelt hat. Spanisch und später Amerikanisch ergänzten nicht etwa eine philippinische Kultur. Das Ausländische wurde stets als überlegen betrachtet, und das nicht nur auf den Gebieten, wo die Kolonialmacht entsprechende Kompetenz besaß. Der Filipino wurde kaum gezwungen, ausländisch zu werden; sein Denken (und seine zumeist schlechte Erfahrung im eigenen Land) sagt ihm, dass er sich nur entwickeln kann, wenn er sich weitgehend an ausländischen Lebens- und Denkgewohnheiten orientiert. Davon ausgehend, sollte man vermuten, dass die Kolonialsprachen Spanisch und Englisch die indigenen Sprachen erheblich beeinflusst haben. Dies ist jedoch - von wenigen Ausnahmen abgesehen - nur auf dem Gebiet des Wortschatzes geschehen.
(2) Die Kolonialmächte importierten zusammen mit ihren Innovationen, die sie in den Philippinen einführten, auch die entsprechenden sprachlichen Begriffe, die dann in die indigenen Sprachen integriert wurden (kurọs, tinidọr, tịsyu). Zusätzlich wurden jedoch ausländische Wörter übernommen, um althergebrachte Begriffe zu ersetzen. So wurde der philippinische Tisch hapạg durch den spanischen Tisch mesa, lamesa ersetzt, aber auch Wörter für Basisbegriffe wurden verändert, ohne dass irgendeine Änderung ihrer Bedeutung eintrat (tungo - puntạ, bahạghari - rainbow). So besitzt heute die filipinische Sprache Tausende von spanischen Lehnwörtern; und ebenso sind Tausende von amerikanisch-englischen Wörtern übernommen worden, zu denen täglich neue kommen. Diese ausländischen Wörter werden als Sprachbrocken übernommen, ein Bezug zur Morphologie und Syntax in der Ursprungssprache geht regelmäßig verloren (kumustạ, istạmbay).
Für viele dieser ausländischen Wörter wurde deren ursprüngliche Phonologie nicht übernommen. Für die spanischen Lehnwörter ist dies nicht erstaunlich, da sie oft nicht gelehrt, sondern von den Filipinos aufgeschnappt wurden. Anders ist die Situation bei den englischen Übernahmen. Obwohl amerikanisches Englisch seit über hundert Jahren das wichtigste Schulfach in den Philippinen ist, sind Einflüsse einer englischen Phonetik und Phonologie recht begrenzt geblieben. Häufig wird das ausländische orthografische Wortbild filipinisch ausgesprochen.
(3) Der Einfluss der spanischen Sprache auf die filipinische Morphologie ist sehr beschränkt geblieben. Beispiele wie pakialamero, karinderyạ sind eher als Ausnahme zu sehen. Ein entsprechender Einfluss der englischen Sprache ist überhaupt nicht zu sehen; vermutlich sind filipinische und englische Morphologie zu weit voneinander entfernt.
(4) Spanisch und auch Englisch haben die filipinische Syntax nur wenig beeinflusst. Entsprechend dem spanischen und englischen Satzbau mit der Reihenfolge Subjekt - Prädikat wurden Versuche unternommen, diese Form als Regelsatzbau in die filipinische Sprache einzuführen. Dies erschien erfolgversprechend, da auch die filipinische Sprache diesen Satzbau (nichtkanonische Reihenfolge) kennt. Trotzdem können diese Versuche als gescheitert betrachtet werden. Der in den Schulen gebräuchliche westliche Stil hat außerhalb der Schule Schrift- und Umgangssprache fast nicht beeinflusst {13-5.1}. Ein weiteres Beispiel ist die Komparation der Adjektive. Das spanische Wort mas hat die indigenen Wörter lalo, higit und labis weitgehend verdrängt, aber deren Syntax beibehalten.
Das in der filipinischen Sprache auffallend häufige Auftreten englischer Einsprengsel ('Taglish') zeigt kaum einen Einfluss auf den filipinischen Satzbau {13-5.2}.
Beim Studium der Literatur haben wir häufig sehr treffende Fachausdrücke in filipinischer Sprache gefunden. Dies hat uns so beeindruckt, dass wir filipinischen Fachaudrücken Vorrang gegeben haben vor lateinischen, spanischen oder englischen Lehn- und Fremdwörtern. Es erschien uns auch konsequent, in einer Arbeit, deren endgültige Sprache Filipino ist, so viel wie möglich filipinische Fachausdrücke zu verwenden.
Die Fachausdrücke wurden von uns so weit wie möglich beibehalten. Für eine große Anzahl war dies möglich, ohne wesentliche Änderungen von Definition und Bedeutung vornehmen zu müssen. An den Stellen, wo deutliche Abweichungen zwischen Fachliteratur und unserer Darstellung vorliegen, haben wir diese entsprechend ihrer Bedeutung herausgearbeitet. Eine weitere Gruppe von Fachausdrücken haben wir neu geprägt und im Anhang Talatawagan {15A} (im Teil Palaugnayan) mit F gekennzeichnet. Eine Anzahl in der Literatur gefundener Fachausdrücke war für unsere Darstellung nicht erforderlich oder nicht geeignet.
Zur Verwendung internationaler Fachausdrücke in der philippinischen
Linguistik → {1A-151
![]() }.
}.
In der Sprache möchten wir unsere Gedanken ausdrücken. Einen vollständigen Gedanken bezeichnen wir als einen Satz (pangungusap). Ein Satz besteht aus Phrasen (parirala). Eine Phrase besitzt ein Inhaltswort als Kernwort und kann weitere Wörter und untergeordnete Phrasen enthalten [1-4].
|
Einem Großteil dieser Phrasen werden kurze Wörter vorangestellt (ay, ang, ng, sa oder nang). Diese Wörter werden verwendet, um die Art und Funktion der Phrase anzuzeigen. Wir bezeichnen sie als Bestimmungswörter {*} (panandạ) {11-2}. Der Gebrauch der Bestimmungswörter am Phrasenanfang ist charakteristisch für die filipinische Sprache. Die -ng/na Ligatur zählen wir ebenfalls zu den Bestimmungswörtern. Wir stellen dies an folgendem Satz [5] dar (ausführlich in {13-3}).
|
{*} Wir haben den Begriff Bestimmungswort gewählt, da es entfernte Ähnlichkeit mit einem 'determiner' besitzt. Davon zu unterscheiden ist das 'Bestimmungswort' in der deutschen Grammatik, das den ergänzenden Teil einer Zusammensetzung beschreibt. In diesem Fall verwenden wir den Begriff 'Ergänzungswort'.
Diese Bestimmungswörter ay, ang, sa, ng, nang sind keine Präpositionen. Man kann sie entfernt mit dem Kasussystem von europäischen Sprachen vergleichen {1A-521 Θ}. Aber der Gebrauch der Bestimmungswörter ist nicht auf Nomina beschränkt.
Wir haben damit Funktionsphrasen für die filipinische Sprache eingeführt {1-6.1} und entsprechende Bezeichnungen gewählt {1A-201}. In den folgenden Abschnitten legen wir dar, warum wir zu diesen, von der konventionellen Grammatik abweichenden Ergebnissen gekommen sind.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_ugnay_1.html
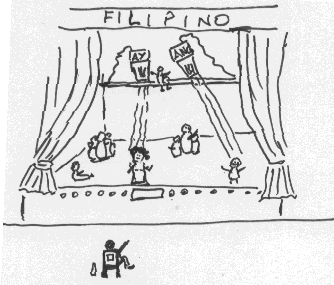
(1) Wir wollen die Syntax des filipinischen Satzes mit dem Geschehen auf einer Theaterbühne vergleichen. Auf der Bühne sind Schauspieler und Gruppen von Schauspielern (Wörter und Phrasen). Vor der Bühne sitzt der Regisseur. Er kann die Schauspieler veranlassen, bestimmte Plätze auf der Bühne einzunehmen (das entspricht Satzanfang, -mitte und -ende). Das Besondere auf unserer filipinischen Bühne ist, dass über der Bühne ein vom Regisseur unabhängiger Beleuchter sitzt, der zwei Scheinwerfer bedient, die die Namen ANG und AY tragen. Diese Scheinwerfer kann er auf beinahe jeden Schauspieler bzw. jede Gruppe richten und somit beliebige Gruppen ins rechte Licht rücken, unabhängig davon, wo der Regisseur sie plaziert hat. Der Beleuchter ist dafür verantwortlich, dass seine zwei Scheinwerfereinstellungen zueinander passen. Da Beleuchter und Regisseur voneinander unabhängig arbeiten dürfen, erhält das Bühnengeschehen eine große Flexibilität, und - um wieder auf die Sprache zu kommen - eine beachtliche Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten.
Wir stellen fest, dass es außer der eindimensionalen zeitlichen Abfolge der Wörter und Phrasen im Satz noch ein zweites beherrschendes Element in der filipinischen Syntax gibt. Zwei Bestandteile des Satzes können ein besonderes Gewicht erhalten. Mit ANG wird eine Phrase markiert, die mit dem klassischen Subjekt viele Gemeinsamkeiten besitzt und die wir daher als Subjektphrase bezeichnen. Entsprechend können wir die AY-Phrase als Prädikat identifizieren. Das Besondere an der filipinischen Sprache ist, dass Prädikat und Subjekt deutlich hörbar bzw. sichtbar markiert werden und dass fast alle Phrasen die Rolle von Prädikat oder Subjekt übernehmen können, wobei einschränkend eine Konsistenz zwischen Prädikat und Subjekt gewahrt bleiben muss.
Ein Weiteres kommt hinzu. Der ANG-Scheinwerfer verleiht allem, was er beleuchtet, besonders scharfe Konturen (wir sprechen später von Fokus und Bestimmtheit des Subjekts). Daher gibt es keinen Sinn, ihn auf etwas Diffuses, Unbestimmtes zu richten. Die filipinische Sprache hat eine besonders wirksame Methode entwickelt, dieses zu verhindern. ANG- und AY-Scheinwerfer können die Objekte, auf die sie ihr Licht richten, tauschen. Durch diesen Tausch von Prädikat und Subjekt können wenig bestimmte Objekte aus dem Fokus genommen werden oder deutlich bestimmbare Objekte in den Fokus gesetzt werden.
(2) Eine weitere Eigenart der filipinischen Sprache ist, dass ein Satz nur dann ein Verb enthält, wenn es semantisch erforderlich ist. Die Syntax verlangt kein Verb, so dass viele Sätze verblos sind. Ein Verb kann daher nicht oder zumindest in vielen Fällen nicht den Mittelpunkt des filipinischen Satzes bilden.
Aus diesen Überlegungen heraus haben wir ein Strukturmodell für den einfachen Satz in der filipinischen Syntax gewählt, in dem Prädikat- und Subjektphrase die Hauptrolle spielen, wodurch Verb- und Nominalphrase zwangsläufig in eine untergeordnete Rolle gedrängt werden.
(3) In diesem Modell wird in erster Linie die syntaktische Funktion der Phrasen im filipinischen Satz betrachtet. Es ist eine Besonderheit der filipinischen Sprache, dass sich daraus nur beschränkt Regeln für die Reihenfolge dieser Phrasen im Satz herleiten; vielmehr ist die Reihenfolge in weiten Grenzen frei wählbar. Der Grund dafür ist, dass die Phrasen im Allgemeinen selbst eine Markierung ihrer Funktion besitzen, so dass eine bestimmte Positionierung zur Erkennung ihrer Funktion nicht erforderlich ist.
Nachstehend stellen wir unser Strukturmodell in Form einer Tabelle vor.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen
(1) In unserem Strukturmodell definieren wir eine Prädikatphrase (pariralang panagurị) und eine Subjektphrase (pariralang paniyạk) auf dem höchsten hierarchischen Niveau des filipinischen Satzes, die wir in Kapitel {2} behandeln. Mit dem Bestimmungswort ang wird das Subjekt gekennzeichnet, das einen "im Fokus stehenden" Satzschwerpunkt bildet, Filipino ist eine fokusorientierte Sprache. ay hat eine ang vergleichbare Funktion für das Prädikat. ay wird viel seltener verwendet als ang, da ein am Satzanfang stehendes Prädikat keiner besonderen Kennzeichnung bedarf.
(2) Es gibt in der filipinischen Sprache mehrere Mechanismen, dass Phrasen ihre Funktion im Satz ändern können. Dadurch können nahezu alle Phrasen in einem oder in mehreren Schritten in die Prädikat- oder in die Subjektphrase gewandelt werden. Da Prädikat und Subjekt ihre Funktionen tauschen können, entsteht eine formale Symmetrie zwischen Prädikatphrase und Subjektphrase.
(3) Die Prädikatsphrase kann durch eine Verbphrase gebildet werden. Jedoch enthält der filipinische Satz nur dann ein Verb als Prädikat, wenn dieses semantisch erforderlich ist. Die Syntax verlangt kein Verb, so dass viele Sätze verblos sind. Daher können Nominal-, Adjektiv-, Adverb-, Präpositionalphrasen und selten Adjunktphrasen ebenfalls das Prädikat bilden, und aus den oben angeführten Symmetriegründen auch das Subjekt. Deshalb besitzt das Verb in der filipinischen Syntax keine zentrale Rolle beim Aufbau des Satzes, und eine Gleichsetzung von Verb und Prädikat ist nicht zulässig. Ebenso ist in der filipinischen Sprache das Subjekt nicht stets eine Nominalphrase.
(4) In unserem Strukturmodell sind Prädikat und Subjekt die wesentlichen Bestandteile des Satzes; sie stehen auf dem höchsten hierarchischen Niveau im Satz. Daraus folgt zwangsläufig, dass ihre Bestandteile, u.a. Nominal- und Verbphrase, auf das zweite Niveau zu stehen kommen. Unabhängige Phrasen können neben Subjekt- und Prädikatphrase ergänzend im Satz stehen. Damit ergibt sich folgende Struktur für den filipinischen Regelsatz {13-2.3 Θ}.
|
(5 ![]() ) In der
filipinischen Sprache werden alle Sätze nach Muster [1] gebildet {1A-511
) In der
filipinischen Sprache werden alle Sätze nach Muster [1] gebildet {1A-511 ![]() }. In anderen
Sprachen ist dieser Satzbau ('Nominalsatz') nicht vorhanden oder
die Ausnahme, die es nur gibt, wenn kein Verb vorhanden ist.
}. In anderen
Sprachen ist dieser Satzbau ('Nominalsatz') nicht vorhanden oder
die Ausnahme, die es nur gibt, wenn kein Verb vorhanden ist.
(1) Außer Prädikat und Subjekt gibt es in der filipinischen Sprache weitere, untereinander grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten, Nominalphrasen in den Satz einzubinden. Zwei davon bezeichnen wir als Objunktphrase (pariralang pantuwịd) und Adjunktphrase (pariralang pandako) und behandeln sie in den Kapiteln {3} und {4}.
Die durch das Bestimmungswort ng charakerisierte Objunktphrase kommt hauptsächlich als Phrase vor, die als Argument einer Verbphrase zugeordnet ist und als Attribut in einer Nominal- oder Adjektivphrase. Die Objunktphrase kann nicht unabhängig im Satz stehen und nicht am Satzanfang.
sa ist das Bestimmungswort der Adjunktphrase. Wie das Objunkt, kann sie Argument eines Verbs oder Attribut zu einem Nomen sein. Außerdem kann die Adjunktphrase das Attribut in einer Präpositionalphrase sein oder auch eine unabhängige Phrase im Satz. Sie kann am Satzanfang stehen.
Objunkt und Adjunkt besitzen ein nahezu vollständiges Paradigma von Personal-, Demonstrativ- und Interrogativpronomen, die wir als NG- und SA-Pronomen bezeichnen.
(2) Ein Vergleich von Objunkt- und Adjunktphrase einerseits und den verschiedenen Nomina-Kasus und Präpositionalphrasen von indoeuropäischen Sprachen zeigt, dass die Organisationsprinzipien sich erheblich unterscheiden und Vergleiche nur sehr beschränkt erlaubt sind {1A-521 Θ}.
Neben Objunkt und Adjunkt gibt es weitere Möglichkeiten, Phrasen einander zuzuordnen. Mit Hilfe der -ng/na Ligatur wird ein Abhängigkeitsverhältnis angezeigt, ohne semantisch die Art der Abhängigkeit darzustellen. Wir bezeichnen diese Phrasen als Subjunkte bzw. Subjunktphrasen (pariralang panlapạg). Sie werden als Attribute verwendet, vorwiegend in Nominal- und Verbphrasen. Nicht in allen Fällen erhalten diese Subjunktphrasen eine Ligatur; es gibt also Subjunkte ohne Ligatur.
Eine weitere Gruppe von Phrasen, die Disjunkte (pariralang pang-umpọg), stehen unabhängig im Satz. Am Satzanfang besitzen sie kein Bestimmungswort. An anderen Positionen im Satz kann das Bestimmungswort nang verwendet werden. Da sie stets unabhängig im Satz stehen, können sie nicht Attribut zu einer anderen Phrase sein.
Subjunkte und Disjunkte sind Funktionsphrasen; wir behandeln sie gemeinsam in Kapitel {5}.
Zusätzlich zum Strukturmodell gilt in der filipinischen Sprache das Prinzip der Rechtsverzweigung, nach dem das Ergänzungswort auf das Grundwort bzw. die ergänzende Phrase auf die grundlegende folgt. Dieses Prinzip führt zu einer Anzahl Regeln, die mehr oder weniger streng gelten:
Imperativ- und Fragesätze passen in das Strukturmodell, obwohl sie naturgemäß einige Besonderheiten besitzen. Eine weitere Gruppe von Sonderfällen wird vom Strukturmodell nicht erfasst, sie können jedoch als Ergänzungen angesehen werden, die nicht im Widerspruch zum Strukturmodell stehen. Dazu gehört adverbiales ANG {2-3.3}. Hinzu kommen Nicht-Regelsätze {13-2.2}.
Das Strukturmodell gilt für den einfachen Satz, kann jedoch für zusammengesetzte Sätze angepasst werden.
(1) Die bisher betrachteten Phrasen - Prädikat, Subjekt, Objunkt, Adjunkt, Subjunkt und Disjunkt - besitzen Bestimmungswörter (panandạ), die die syntaktische Funktion der Phrase anzeigen. Wir bezeichnen diese Phrasen als Funktionsphrasen (pariralang pangkayariạn).
| Funktionsphrase | Bestimmungswort |
| Prädikat | ay |
| Subjekt | ang |
| Objunkt | ng |
| Adjunkt | sa |
| Subjunkt | -ng/na |
| Disjunkt | nang |
(2) {Θ} Den ganzen Satz bzw. Teilsatz in der filipinischen Sprache betrachten wir nicht als Phrase, ihm fehlen Bestimmungswort und Kernwort. Daher sind für uns Bezeichnungen wie 'Verbphrase' oder 'Inflectional phrase' zur Beschreibung des filipinischen Satzes nicht geeignet.
Zuordnung von Phrasen in der Literatur → {1A-611 ![]() }.
}.
(1) Den inhaltlichen Bestandteil der Phrasen bilden die Inhaltsphrasen (pariralang pangnilalamạn). Sie besitzen keine Bestimmungswörter. Die Inhaltsphrasen unterscheiden wir nach der Wortart ihres Kernwortes. Definitionsgemäß sind die Kernwörter der Inhaltsphrasen die Inhaltswörter der filipinischen Sprache.
| Inhaltsphrasen | Kernwörter |
| Nominalphrase | Substantiv, Pronomen |
| Verbphrase | Verb |
| Adjektivphrase | Adjektiv |
| Adverbphrase | Adverb |
| Präpositionalphrase | Präposition |
(2) Inhaltsphrasen bzw. deren Kernwörter können durch Attribute (panuring) ergänzt werden. Die Attribute sind Funktionsphrasen (Objunkt, Adjunkt, Subjunkt) oder Kurzwörter.
| Funktionsphrase | ||
| Inhaltsphrase | ||
| Attribut | Kernwort | Attribut |
| ↓ | ↓ |
|
| ||||||
Eigenschaften der Attribute → {1A-621}
Attribut und ergänzte Phrase → {5A-201 Θ}
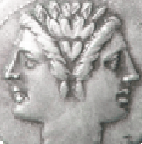
(1) Die Einteilung in Funktions- und Inhaltsphrasen bedarf einer Ergänzung. Funktions- und Inhaltsphrase sind nicht zwei getrennte Phrasen. Vielmehr bilden sie gemeinsam eine duale Identitität der filipinischen Phrase. Die äußere oder funktionale Identität einer Phrase bezeichnen wir vereinfacht als ihre Funktionsphrase; desgleichen ist die Inhaltsphrase ihre innere oder inhaltliche Identität. Beide Identitäten - Funktion und Inhalt - sind erforderlich, um eine Phrase zu bilden.
Dieser Dualität tragen wir im Schlüsselsystem Rechnung, indem wir eine Phrase mit ihren beiden Identitäten kennzeichnen ({Funktionsphrase = Inhaltsphrase}, Beispiel {P-P=P-D} für ein Prädikat, das ein Verb ist). Eine Funktionsphrase allein ist keine wirkliche Phrase, sondern ein Gattungsbegriff für Phrasen mit gleicher äußerer Identität ({P-P} für alle Phrasen {P-P=P-..}); entsprechend ist eine Inhaltsphrase der Gattungsbegriff für gleiche innere Identität ({P-U} für alle Phrasen {P-..=P-U}). Analyse eines Beispielsatzes → {1A-631 Σ}.In der filipinischen Sprache besteht kein fester Zusammenhang zwischen syntaktischen Funktionen und konventionellen Wortarten. Die Einteilung in Funktions- und Inhaltsphrasen ist unser Ansatz, dieser wesentlichen Eigenschaft der filipinischen Sprache Rechnung zu tragen.
(2) Wie die Strukturmodelltabelle zeigt {1-4}, gibt es viele Möglichkeiten, Funktions- und Inhaltsphrasen zu kombinieren. Dies schließt nicht aus, dass bestimmte Kombinationen von Funktions- und Inhaltsphrasen nicht vorkommen {1A-632}.
(3) {Θ} Die Funktionsphrasen sind unmittelbar aus der sprachlichen Wirklichkeit herzuleiten, da sie durch ihre Bestimmungswörter definiert sind. Im Gegensatz dazu sind die konventionellen Wortarten und die davon abgeleiteten Inhaltsphrasen weit weniger deutlich. Funktionsphrasen sind daher der sprachlichen Wirklichkeit näher als Inhaltsphrasen.
(4) Eine Funktions- und eine Inhaltsphrase bilden die duale Identität einer Phrase. Es gibt jedoch Ausnahmen: Eine Inhaltsphrase kann in einer Präpositionalphrase (ebenfalls Inhaltsphrase) stehen {10-2 (1)}. Selten ist eine andere Ausnahme, wenn ein Adjunkt (Funktionsphrase) das Prädikat (ebenfalls Funktionsphrase) bildet {2-4.6}.
Paradigma ang - ng - sa der Nominalphrasen → {1A-633 Θ}.
Entsprechend der syntaktischen Struktur der Sprache nehmen wir eine Einteilung vor in 'syntaktischen Wortarten' (uring-salitạng (pampalaugnayan)) {1-7.1}. Zusätzlich verwenden wir eine Einteilung in konventionelle Wortarten ('Wortarten', bahagi ng panalitạ) {1-7.2}.
Wortarten in der Linguistik → {1A-701 ![]() }
}
Entsprechend ihrer syntaktischen Funktion bzw. Verwendung teilen wir die filipinischen Wörter in drei Klassen ein, die wir als Inhaltswörter, Funktionswörter und Kurzwörter bezeichnen (Beispiele dazu in {1A-711}).
(1) Inhaltswörter (salitạng pangnilalamạn) bilden den Inhalt der Funktionsphrasen, sie bilden Inhaltsphrasen. Diese können Attribute besitzen. Inhaltswörter können als Interklitbezugswort dienen. Inhaltswörter bilden in der Regel Wortfamilien und besitzen semantischen Inhalt.
(2) Funktionswörter (salitạng pangkayariạn) sind die Bestimmungswörter. Ihre syntaktische Funktion überwiegt den semantischen Inhalt. Von einer Ausnahme abgesehen (sa), bilden Funktionswörter keine Wortfamilien.
(3) Kurzwörter (katagạ) sind die Restklasse der Wörter, die weder Inhalts- noch Funktionswörter sind. Kurzwörter sind keine Phrasen und können keine Phrasen bilden. Sie können nicht als Interklitbezugswort dienen. Sie können Attribut in einer Inhaltsphrase sein. Kurzwörter können selbst keine Ligatur besitzen, jedoch eine "übernehmen" {11-5.2}. In der Regel bilden Kurzwörter keine Wortfamilien. Sie besitzen semantischen Inhalt.
| (1) Wortart (konvent.) | Enklit. | Syntaktische Wortart | ||
| Verb (pandiwa) | {D} | nein | Inhaltswort | {6-1} |
| Substantiv (pangngalan) | {N} | nein | Inhaltswort | {8-1} |
| Adjektiv (pang-uri) | {U} | nein | Inhaltswort | {9-1} |
| Präposition (pang-ukol) | {O} | nein | Inhaltswort | {10-1} |
| Interjektion (padamdạm) | {M} | nein | Kurzwort | {9-8} |
| Adverb (pang-abay) | {A/LM} | nein | Inhaltswort | {9-4.3} |
| enklitisch (hutagạ) | {A/HG} | ja | Kurzwort | {9-4.1} |
| proklitisch (untagạ) | {A/UG} | proklit. | Kurzwort | {9-4.2} |
| Pronomen (panghalịp) | {H} | möglich | Inhaltsw./Kurzw. | {8-4} {11-6.2} |
| Konjunktion (pangatnịg, katnịg) | {K} | einige | Kurzw./Inhaltsw. | {13-4.2} |
| Artikel (pantukoy) | {Y} | proklit. | Kurzwort | {8-6.2} |
| Bestimmungswort (panandạ, tandạ) | {T} | --- | Funktionswort | {11-2} |
(2) Nur eine Wortart besitzt besondere morphologische Eigenschaften: das Verb mit seiner Tempuskonjugation. Nomina (Substantive und Pronomen), Adjektive und Adverbien können nur semantisch oder konventionell unterschieden werden.
(3) Einige Wortarten können als andere Wortart verwendet werden. Das besagt, dass ein Wort in einer anderen syntaktischen Funktion steht als der "üblichen". Dabei findet keine morphologische Anpassung statt. Dies ist eine Besonderheit der filipinischen Sprache, da fast jede Kombination von Funktions- und Inhaltsphrase gebildet werden kann.
(1) In der filipinischen Sprache sind große Wortfamilien (angkạng-salitạ) um Wortstämme (ugạt-salitạ) gruppiert. Der Wortstamm einer Wortfamilie wird häufig als eigenständiges Wort verwendet (Stammwort, salitạng-ugạt, {1A-731}).
(2) Abgeleitete Wörter (salitạng hango) werden gebildet mit Hilfe von:
(3) Wir verwenden das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) zur phonologischen und phonetischen Beschreibung. In der Regel verzichten wir auf eine phonologische Beschreibung und stellen die häufigste phonetische Form in eckigen Klammern […] dar.
(4) Um die Betonung eines Wortes anzuzeigen, folgen wir dem System des Duden. Lange betonte Vokale sind unterstrichen, während ein Punkt unter kurze betonte Vokale gesetzt wird (was in den Philippinen neu und ungebräuchlich ist).
| Betonte Silbe | Langen Vokal unterstreichen. | sama makasama ['sa:.mʌ] [mʌ,ka:'sa:.mʌ] |
| Punkt unter kurzem Vokal. | lamạn bantọg [lʌ'mʌn] [bʌn'tɔg] | |
| Unbetonte Silbe | In der Regel keine Anzeige. | sama ['sa:.mʌ] (letzte Silbe) |
Wir stellen im Schriftbild den Konsonanten Po (glottaler Verschlusslaut [ ʔ ], impit na pasara) nicht dar. Stattdessen setzen wir den vorangehenden Vokal in Kursivschrift, wenn Po angezeigt werden soll.
| Po am Wortende | Kursivsetzen des vorangehenden Vokales. | hina samạ ['hi:.nʌʔ] [sʌ'mʌʔ] |
Weitere Beispiele → {7A-121}
(1) Wir haben – zumindest war dies unsere Absicht – 'sine ira et studio' Daten gesammelt, wobei das 'common sense' der Muttersprachler die höchste sprachliche Autorität war. Diese Daten haben wir dann versucht, schlüssig und widerspruchsfrei zu ordnen. Dabei haben wir im ersten Ansatz vermieden, bestimmte Phänomene mit Standardtermen der Linguistik zu benennen, um eine vorzeitige Klassifizierung und Interpretation in eine bestimmte Richtung zu vermeiden. Auf Grund unserer empirischen Daten sind wir zu Ergebnissen gelangt, die nicht in allen Punkten mit denen anderer Autoren übereinstimmen, die wir in drei Gruppen einteilen möchten.
Zunächst sehen wir die internationale Linguistik, die oft auf
{![]() Bloomfield 1917} zurückgreift {1A-8011
Bloomfield 1917} zurückgreift {1A-8011 ![]() }.
Als neuere Prototypen dieser Richtung betrachten wir die Arbeiten von N. Himmelmann
{
}.
Als neuere Prototypen dieser Richtung betrachten wir die Arbeiten von N. Himmelmann
{![]() Himmelmann 1987} {1A-8012
Himmelmann 1987} {1A-8012 ![]() } und von
P. Schachter und F. T. Otanes {
} und von
P. Schachter und F. T. Otanes {![]() Schachter 1972}
{1A-8013
Schachter 1972}
{1A-8013 ![]() }.
}.
Eine philippinische Schule - hier als Prototyp die UP Diliman - kommt der
internationalen Linguistik recht nahe, als Beispiele zitieren wir den Beginn mit
{![]() Lopez 1941} {1A-8014
Lopez 1941} {1A-8014 ![]() } bis hin zu {
} bis hin zu {![]() Aganan 1999}
{1A-8015
Aganan 1999}
{1A-8015 ![]() }.
}.
Für eine dritte Gruppe, die mehr an die traditionelle spanisch-philippinische
Linguistik anknüpft, finden wir als Representanten die Schulgrammatik von
{![]() Villanueva 1968/1998} und als neuere Arbeit
{
Villanueva 1968/1998} und als neuere Arbeit
{![]() Santiago 2003-B}.
Santiago 2003-B}.
(2) In und zwischen den drei Gruppen zeigen sich erhebliche Unterschiede über das Grundverständnis der filipinischen Syntax, und ein gemeinsamer wissenschaftlicher Fortschritt ist kaum zu erkennen. Nun ist die filipinische Syntax in erster Linie kein akademisches Studienobjekt, sondern die Grundlage für ein Hauptfach von Millionen philippinischen Schülern, und es ist deshalb schwer nachzuvollziehen, dass nicht ernsthaftere Bemühungen unternommen werden, um zu einem sachlich richtigen, der Sprache angemessenen und damit allgemein akzeptablen Grundmodell zu kommen.
Wir haben uns an den beiden ersten Gruppen orientiert und Abweichungen zwischen diesen Schulen und unseren Befindungen untersucht. Einige wesentliche Unterschiede zu anderen Lehrmeinungen haben wir im folgenden Abschnitt {1-9} zusammengestellt.
(3) Nach unserer Auffassung sind auch heute noch – nach etwa 100 Jahren – die Ansätze von Bloomfield grundsätzlich am besten geeignet, die Struktur der filipinischen Sprache zu verstehen. Subjekt, Prädikat und Attribute, wobei letztere in vier Gruppen gegliedert werden, sind seine Grundelemente der Syntax. Dem entsprechen unsere sechs Funktionsphrasen Prädikat, Subjekt, Objunkt, Adjunkt, Subjunkt und Disjunkt. Bei Bloomfield werden zwei Wortarten definiert, Inhalts- und Funktionswörter (letztere aus zwei Gruppen bestehend). Ähnlich ist unsere Einteilung in drei syntaktische Wortarten. Daneben werden bei Bloomfield weitere 'groupings of words' dargestellt, die mit unseren konventionellen Wortarten vergleichbar sind.
Während wir also grundsätzlich den Ansätzen von Bloomfield folgen, haben wir sie an
mehreren Stellen ergänzt oder gar verlassen. Wir haben in den entsprechenden Kapiteln
unserer Arbeit versucht, die wesentlichen Abweichungen ausführlich darzustellen und zu
begründen {1A-8011 (2)}. Als eine
grundsätzliche Abweichung betrachten wir unsere Sicht zu der "Nominalisierung" der das
Subjekt bildenden Inhaltswörter {2A-102
![]() }. Nach Bloomfield
(und anderen Autoren) werden alle Wörter, wenn sie das Subjekt bilden, zu Substantiven. Wir
haben keine Hinweise gefunden, die eine solche Nominalisierung unterstützen.
}. Nach Bloomfield
(und anderen Autoren) werden alle Wörter, wenn sie das Subjekt bilden, zu Substantiven. Wir
haben keine Hinweise gefunden, die eine solche Nominalisierung unterstützen.
(4) Wir ziehen aus dem Postulat von Bloomfield, dass im Prinzip jedes Inhaltswort als Subjekt, Prädikat und Attribut verwendet werden kann, die Schlussfolgerung, dass syntaktische Funktion und konventionelle Wortart in der filipinischen Sprache streng zu trennen sind. In unserem Ansatz nehmen wir eine Trennung von Syntax und Morphologie vor, insbesondere wegen der Seltenheit morphologischer Paradigmen. Der Begriff Morphosyntax wird von uns nicht verwendet. Damit weichen wir deutlich von der modernen Linguistik ab.
Wir nehmen eine strenge Trennung zwischen Prädikat und Verb vor, desgleichen von Subjekt und Nominalphrase. Eine Verbphrase kann das Prädikat bilden und eine Nominalphrase das Subjekt. Aber die filipinische Sprache bietet hier viele zusätzliche Möglichkeiten. Besonders unsere Auffassung über die prinzipielle Trennung der Begriffe Subjekt und Nominalphrase wird in den linguistischen Schulen in der Regel nicht geteilt.
Die Öffnung von Prädikat und Subjekt für nahezu alle Phrasen ermöglicht unsere Darstellung von Symmetrie und Tausch von Prädikat und Subjekt, die ohne eine solche Annahme nicht möglich ist (und in der Regel in philippinischen Arbeiten ignoriert wird).
In Zusammenhang mit dieser Trennung ist ebenfalls die Frage nach den Kasus der Nomina zu betrachten. In unserem Modell mit Phrasenmarkierern ist kein Platz für Kasusmarkierer (wir folgen damit Bloomfield), da es nur eine erstere Markierung in der filipinischen Sprache gibt. Deshalb kommt der Begriff Kasus in unserem Modell nicht vor.
(5) Wir identifizieren Prädikat- und Subjektphrase durch ihre Bestimmungswörter ay und ang. Im Allgemeinen ist die Funktion von ay als 'predicate marker' beinahe unumstritten. Anders ist es mit ang. Während das Strukturmodell ang als Gegenstück zu ay für das Subjekt ansieht, ist dies keineswegs allgemein akzepiert. Einerseits wird ang in der Literatur als 'focus or subject marker' betrachtet. Dies ist jedoch umstritten, da es Sätze gibt, in denen ang zweimal bzw. in einer Kombination ay ang vorkommt.
(6) In unserer Syntax sprechen wir von Nominal-, Verb- usw. Phrasen. Damit wird vorausgesetzt, dass es diese Phrasen in der filipinischen Sprache gibt. Es muss also Kernwörter für diese Phrasen geben, die sich von anderen Wortarten unterscheiden, so dass eine Abgrenzung zwischen den verschiedenen Phrasen möglich ist. Dies ist keineswegs selbstverständlich im Filipino. Die Übergänge zwischen den Wortarten sind fließend, morphologische Merkmale fehlen. Wir sind trotzdem den Weg gegangen, neben der Einführung der syntaktische Wortarten die filipinischen Wörter so weit und so gut wie möglich zusätzlich in "konventionelle" Wortarten einzuteilen.
(7) Wir haben nicht untersucht, ob wesentliche Unterschiede zwischen dem historischen Tagalog und dem von uns betrachteten Filipino bestehen, zumal unsere Informationen über Filipino vorwiegend von Angehörigen der heutigen urbanen und jüngeren Generation stammen, die weitgehend den Einflüssen der modernen Kommunikation (Fernsehen und Mobiltelefonie) unterliegen. Trotzdem haben wir einen kleinen Versuch in diese Richtung unternommen {W Tag-Fil}.
Es ist verständlich, dass unsere Ansätze über die filipinischen Syntax von denen in anderen Quellen abweichen. In diesem Abschnitt wollen wir keine vergleichende Bewertungen zwischen diesen Quellen und unseren Ansätzen vornehmen, sondern nur die Unterschiede anreißen. Sie werden im Einzelnen in den angegebenen Kapiteln behandelt.
Wie verwenden den Begriff 'Gebilde' statt des häufiger anzutreffenden Begriffs 'Konstruktion', da Gebilde gebildet und nicht konstruiert werden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_ugnay_2.html
(1) Wir betrachten Prädikat (Schlüssel {P-P}, pariralang panagurị) und Subjekt (Schlüssel {P-T}, pariralang paniyạk [tiyạk] {2A-101}) in diesem Kapitel gemeinsam. Prädikat und Subjekt können ihre syntaktische Funktion tauschen {2-2.3}, es besteht also eine syntaktische Symmetrie dieser beiden Funktionsphrasen {2-2.4}. Beide können von nahezu allen Inhaltsphrasen gebildet werden. Die filipinische Sprache besitzt keine "Hilfsverben", daher können Prädikat und Subjekt von Nicht-Verbphrasen gebildet werden.
(2) In der filipinischen Sprache besitzt das Subjekt einen Fokus; damit verbunden ist die Eigenschaft des Subjekts, dass es ein hohes Maß von Bestimmtheit ausdrückt {2-3}. Wenn eine Nominal- oder ähnliche Phrase keinen Bestimmtheit besitzt, kann diese Phrase nicht Subjekt sein.
(3) ay ist das Bestimmungswort des Prädikats, ang das des
Subjekts. In der filipinischen Sprache gibt es keine strenge Koppelung von Wortart und
syntaktischer Funktion. Deshalb gibt es keine feste Verbindung von ang mit der
Wortart Substantiv {2A-102 ![]() }. ang kann zu dem Prädikat gefügt werden,
wir bezeichnen dies als adverbiales ANG {2-3.3}.
}. ang kann zu dem Prädikat gefügt werden,
wir bezeichnen dies als adverbiales ANG {2-3.3}.
Die Funktion von Prädikat und Subjekt im Satz behandeln wir in {13-2.3 Θ}.
(1) Die überwiegende Mehrzahl der filipinischen Sätze besitzt ein Verb als Prädikat [1]. Jedoch gibt es regelmäßig Sätze ohne Verb, es gibt keine Entsprechungen zu den in indogermanischen Sprachen vorhandenen Verben wie 'sein' oder 'to be'. Dadurch können Nicht-Verbphrasen das Prädikat bilden (Substantiv [2], Adjektiv [3], Präpositionalphrase [4], Adjunkt [5]). Die Interrogativpronomen sino, anọ und kanino bilden Prädikate [6], ebenso die Interrogativpräposition nasaạn (sa) {12-2.1}.
|
(2) Das Prädikat besitzt das Bestimmungswort
ay {2A-211 ![]() }. Wenn der Satz
in nichtkanonischer Reihenfolge steht, wird dem Prädikat das Bestimmungswort vorangesetzt
[7-10]. Ebenfalls wird ay häufig verwendet, wenn bei kanonischer Reihenfolge vor dem Prädikat eine andere Phrase
[11 12] oder ein Teilsatz steht [13]. Nach kürzeren Phrasen vor dem Prädikat wird im
Allgemeinen auf ay verzichtet [14].
}. Wenn der Satz
in nichtkanonischer Reihenfolge steht, wird dem Prädikat das Bestimmungswort vorangesetzt
[7-10]. Ebenfalls wird ay häufig verwendet, wenn bei kanonischer Reihenfolge vor dem Prädikat eine andere Phrase
[11 12] oder ein Teilsatz steht [13]. Nach kürzeren Phrasen vor dem Prädikat wird im
Allgemeinen auf ay verzichtet [14].
Die Sätze [1-6] sind in kanonischer Reihenfolge, das Prädikat ist am Satzanfang. Sie haben kein Bestimmungswort ay, da dieses am Satzanfang entfällt.
|
{Θ} Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Bestimmungswort ay nur dann verwendet wird, wenn ein nicht am Satzanfang stehendes Prädikat einer besonderen Markierung bedarf. Dies geschieht unabhängig vom Inhalt der Prädikatsphrase (hier unterscheidet sich ay von dem Bestimmungswort ang der Subjektphrase).
(1) Als besondere Eigenschaft besitzt das filipinische Subjekt Bestimmtheit {2-3.1}. Wenn das Prädikat ein Verb ist, ist das Subjekt in dessen Fokus. In der Regel steht am Anfang des Subjekts das Bestimmungswort ang. Neben seiner Funktion als Bestimmungswort des Subjekts zeigt ang die Bestimmtheit des Subjekts an, wenn dieses eine Nominalphrase ist. Wegen seiner Bestimmtheit kann das Subjekt nicht erfragt werden {12-4.2}.
Vorwiegend wird das Subjekt von einer Nominalphrase gebildet [1]. Pronomen und mit si versehene Substantive sind stets bestimmt, bedürfen deshalb keines zweiten Bestimmtheitsmarkierers und haben deshalb kein Bestimmungswort ang [2 3] {2-4.1}.
(2) Undeutlich ist die Bestimmtheit des Subjekts, wenn es keine Nominalphrase ist [4-6]. In diesen Fällen wird ang stets verwendet, es hat ausschließlich die Funktion, das Subjekt anzuzeigen.
|
(3) Vorwiegend umgangssprachlich kann statt des Bestimmungsworts ang das vorangehende Wort ein Suffix -ng erhalten {*}. Davon wird vor allem Gebrauch gemacht, wenn ang keine besondere Bestimmtheit ausdrückt und eine rein syntaktische Funktion besitzt [7]. Dies ist auch der Fall in Fragesätzen [8a] {12-2.1 (2)}.
{*} Vermutlich besteht keine Beziehung zu der -ng Form der Ligatur, da obiges Suffix -ng nicht durch die na Form der Ligatur ersetzt werden kann.
|
(4) Besteht das Subjekt aus einer Aufzählung, so kann ang vor das gesamte Subjekt gesetzt werden [9]. Um die Bestimmtheit der einzelnen Teile zu betonen, kann ang wiederholt werden [10].
|
(1) Prädikat und Subjekt können ihre Funktionen tauschen
(pagpapalitạn ng panaguri
at paniyạk) {2A-231
![]() }. Die das Prädikat bildende Phrase
wird in einem geänderten Satz Subjekt, und das Subjekt wird zum Prädikat [1|2]. Beispiel
[3|4] zeigt, dass der Funktionstausch von Prädikat und Subjekt nicht auf Sätze mit Verb
beschränkt ist.
}. Die das Prädikat bildende Phrase
wird in einem geänderten Satz Subjekt, und das Subjekt wird zum Prädikat [1|2]. Beispiel
[3|4] zeigt, dass der Funktionstausch von Prädikat und Subjekt nicht auf Sätze mit Verb
beschränkt ist.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sätze [1-4] sind in kanonischer Reihenfolge. Zu unterscheiden ist der Funktionstausch Prädikat/Subjekt von nichtkanonischer Reihenfolge von Prädikat und Subjekt (in [1|5 3|6] wird nur die Stellung von Prädikat und Subjekt getauscht).
| ||||||||||||||||
(2) Die Prädikat und Subjekt bildenden Inhaltsphrasen können untergeordnete Phrasen besitzen. Bei Tausch von Prädikat und Subjekt werden sie mitgetauscht, bleiben also Bestandteil ihrer übergeordneten Phrase [7a|b]. Naturgemäß werden unabhängige Phrasen durch einen Tausch von Prädikat und Subjekt nicht beeinflusst (kahapon in [8a|b]).
| |||||||||||
(3) Vom Funktionstausch wird Gebrauch gemacht, um einer Phrase Bestimmtheit zu verleihen oder sie von dieser zu entfernen. Das Subjekt ist nicht erfragbar, deshalb muss es Prädikat werden, um einen Interrogativsatz bilden zu können [8b 9] {12-4.2}.
|
Funktionstausch und europäische Sprachen →
{2A-232 ![]() }
}
Alle Phrasen, die in der filipinischen Sprache das Prädikat bilden können, können auch Subjekt sein und umgekehrt. Dadurch entsteht eine syntaktische Symmetrie zwischen Prädikat und Subjekt. In Abschnitt {2-2.1} wurde gezeigt, dass außer Verbphrasen auch Nicht-Verbphrasen das Prädikat bilden können. Wegen der Symmetrie können sie auch Subjekt sein.
Die Symmetrie beschränkt sich ausschließlich auf die Syntax. Wegen der Bestimmtheit des Subjekts besteht keine semantische Symmetrie [1|2].
|
(1) Den Begriff 'Bestimmtheit' (katiyakạn) beziehen wir auf Personen und Dinge. Wir verstehen darunter Eigenschaften, etwas Besonderes, Unterscheidbares zu sein. Leichter zu erklären ist der Begriff der Unbestimmtheit. Hier sind keine eigentlichen Personen oder Dinge gemeint, sondern die Eigenschaft, einer Gruppe von Personen oder Dinge anzugehören. Die Begriffe Bestimmtheit und Unbestimmtheit sind semantisch.
(2) Fokus (fokus) ist eine Eigenschaft des Verbs. Eines der Argumente des Verbs erhält besonderes Gewicht, dieses Argument ist im Fokus des Verbs und bildet das Subjekt. Fokus ist ein syntaktischer Begriff. Fokus ist eine Eigenschaft der austronesischen Sprachenfamilie.
Bestimmtheit in Filipino und in europäischen Sprachen →
{2A-301 ![]() }
}
(1) Das Subjekt besitzt Bestimmtheit, diese Bestimmtheit an sich
(katiyakạng likạs) kann dem
Subjekt nicht entzogen werden {2A-311
![]() }. Das Bestimmungswort ang
zeigt Bestimmtheit an sich an [1 2]. ang wird nicht verwendet, wenn die Bestimmtheit
auf andere Weise deutlich ist [3] {2-4.1 (2)}.
}. Das Bestimmungswort ang
zeigt Bestimmtheit an sich an [1 2]. ang wird nicht verwendet, wenn die Bestimmtheit
auf andere Weise deutlich ist [3] {2-4.1 (2)}.
(2) In Sätzen mit Verb kann nahezu jede Phrase Bestimmtheit an sich oder auch Unbestimmtheit erlangen. Mit anderen Worten, die verschiedenen Argumente können in den Fokus gestellt werden oder aus ihm genommen werden. Dies wird mit Hilfe der Affigierung der Verben ausgeführt [1 2].
(3) Wenn das Subjekt kein Nomen ist, wird der Begriff Bestimmtheit undeutlich bzw. die Bestimmtheit fehlt. Dann ist ang nur ein syntaktisches Bestimmungswort ohne semantischen Inhalt. Wenn eine Verbphrase das Subjekt ist, ist das Prädikat im Fokus des Verbs, ohne das dessen Inhaltsphrase Bestimmtheit besitzt [4].
Der Begriff Fokus wird nicht verwendet, wenn der Satz kein Verb enthält. Trotzdem besitzt das Subjekt Bestimmtheit an sich [5 6].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Ist eine Nominalphrase das Prädikat, so besitzt sie keine Bestimmtheit an sich [1]. Man kann dem Prädikat besondere Bestimmtheit geben mit Hilfe von Folgendem:
Personalpronomen sind stets bestimmt. Besonderes Gewicht erhalten sie als Prädikat am Satzanfang [10 11].
|
Das adverbiale ANG erhöht die Bestimmtheit des Prädikats erheblich {2-3.3}. Das Bestimmungswort ay hat keinen Einfluss auf die Bestimmtheit des Prädikats.
(2) Da das Prädikat keine Bestimmtheit an sich besitzt, kann diese Eigenschaft verwendet werden, um Phrasen unbestimmt zu machen [12-14]. Dies geschieht häufig bei Gattungsbegriffen [1].
| |||||||||||||||||||
(1) ang ist das Bestimmungswort des Subjekts. Daneben wird ang als Adverb verwendet, wir nennen es 'adverbiales ANG' (ANG na makaabay). Syntaktisch besitzt das adverbiale ANG keine Funktion.
Das adverbiale ANG wird verwendet, um die Bestimmtheit des Prädikats anzuzeigen [1] und ihm ein besonderes Gewicht zuzuweisen [2 3]. Prädikat und Subjekt besitzen eine syntaktische Gleichheit {2-2.4}. Wenn dem Prädikat das adverbiale ANG zugefügt wird, wird dieses verstärkt, um auch semantische Gleichheit zu erreichen [4a|b 5]. In Satz [6] wird nicht dem gesamten Prädikat, sondern nur seiner Existenzphrase ein Zusatzgewicht gegeben.
| ||||||||||||||||||||
(2) {Θ} Da das adverbiale ANG ein Adverb und kein Bestimmungswort ist, entfällt das Bestimmungswort ay des Prädikats nicht [3 5]. Am Beginn eines Ligatursatzes bleibt die Ligatur stehen, wenn ein Prädikat mit adverbialem ANG folgt [1]. In Satz [6] steht die Ligatur nach dem Adverb tangi und damit vor dem adverbialen ANG.
Wir betrachten adverbiales ANG als Adverb, man kann es auch zu der Wortart Artikel zählen. Das adverbiale ANG wird ausschließlich im Prädikat verwendet, nicht in Objunkt oder Adjunkt.
Bei {![]() Aganan 1999 p. 78}
werden Sätze mit adverbialem ANG als pangungusap na tinitiyak ang panaguri
('Satz mit bestätigtem Prädikat') bezeichnet.
Aganan 1999 p. 78}
werden Sätze mit adverbialem ANG als pangungusap na tinitiyak ang panaguri
('Satz mit bestätigtem Prädikat') bezeichnet.
Objunkt- und Adjunktphrasen (ebenso Subjunkte und Disjunkte) stehen nicht im Fokus. Ein Objunkt besitzt keine Bestimmtheit [1b 2a], während Adjunkte bestimmt oder beschränkt bestimmt sind [2b 3a|b]. Die Bestimmtheit kann erhöht werden mit den gleichen Mitteln wie beim Prädikat.
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-P_1.html
(1) In der Regel steht das Bestimmungswort ang vor dem Subjekt, wenn dieses eine Nominalphrase ist [1 2].
|
(2) Das Bestimmungswort ang für das Subjekt zeigt dessen Bestimmtheit an. Regelmäßig entfällt es in den folgenden Fällen, bei denen die Bestimmtheit des Subjekts bereits auf andere Weise deutlich ist:
|
(3) Vor einigen Wörtern kann das Bestimmungswort ang entfallen. Dazu gehören:
| ||||||||||||||||||||||||||
Häufig sind Sätze mit Nominalphrase als Prädikat [1-7]. In [1-3] ist das Prädikat ein Substantiv, in [4-7] ein Pronomen. Oft ist eine weitere Nominalphrase das Subjekt [1 2 4-6]. Eine Verbphrase kann als Subjekt gewählt werden, um einer Nominalphrase die Bestimmtheit zu entziehen [3] oder der Nominalphrase als Prädikat am Satzanfang besonderes Gewicht zu verleihen [7]. Da in den Sätzen [1b 2b 2c 5] das Prädikat nicht am Satzanfang steht, wird ihm das Bestimmungswort ay vorangesetzt.
|
In der Mehrzahl der Sätze ist ein Verb das Prädikat. Das Verb besitzt Argumente (Subjekt, Objunkt(e), Adjunkt). Das Objunkt (oder die Objunkte) und das Adjunkt sind Bestandteil der Verbphrase, jedoch nicht das Fokus tragende Subjekt. Trotzdem beeinflusst das Verb das Subjekt, wir sprechen von 'globaler Wirkung' des Verbs im Satz (kabisaang buọ) {2A-431}. Entsprechendes gilt, wenn die Verbphrase das Subjekt bildet. Dann ist das Prädikat in den globalen Wirkungskreis des Verbs einbegriffen.
Als Vollverben bezeichnen wir Verben mit globaler Wirkung, also Verben, die Argumente besitzen {6-2}. Unser Begriff Vollverb ist syntaktisch. Er steht im Gegensatz zu dem syntaktischen Begriff Partizip {6-6.4}. Da die filipinische Sprache keine Hilfs- und Modalverben besitzt, wird der Begriff Vollverb nicht anderweitig für eine lexikalische Kategorie benötigt.
{Θ} Trotz globaler Wirkung im Satz kann dem Verb (bzw. der Verbphrase) nicht die zentrale Rolle im Satz eingeräumt werden, die es in den europäischen Sprachen besitzt. In der filipinischen Sprache gilt "Wenn der Satz ein Verb hat, ist es ein Vollverb." (wenn es prädikativ bzw. als Subjekt verwendet wird) und nicht "Das Verb übt die zentrale Rolle im Satz aus."
Zwei Verben im Satz → {6-7.2}
Bei kanonischer Reihenfolge von Prädikat und Subjekt folgt das Subjekt nach der Verbphrase, wenn diese das Prädikat bildet [1]. Dabei kann das Prädikat gespalten werden, um das Subjekt unmittelbat hinter dem Verb einzufügen [2 3].
| ||||||||||||
(1) Die Verbphrase kann das Subjekt des Satzes bilden [1 2a]. Häufig werden Fragesätze so gebildet [2b]. In Satz [3] ist ein Adjektiv das Prädikat.
(2) Ein zweites Verb im Satz kann das Subjekt bilden; es ist dem ersten Verb, das das Prädikat bildet, untergeordnet und ist daher kein Vollverb [4 5].
| ||||||||||||||||||
Nur selten bildet eine Adjunktphrase das Prädikat [1-3]. Sa [1a] ist ein Personalpronomen das Kernwort; in [3] das Interrogativpronomen kanino. SA-Demonstrativpronomen (dito …) werden als Prädikat vermieden. Stattdessen wird eine Verbform wie nandito, die vom Demonstrativpronmen abgeleitet ist, vorgezogen [4] {7A-113}.
|
{Θ} Wenn eine Adjunktphrase das Prädikat ist, bildet eine Funktionsphrase (Adjunkt) den Inhalt einer anderen Funktionsphrase (Prädikat) {1-6.3 (4)}.
(1) Ein Adjektiv oder eine Adjektivphrase kann das Prädikat bilden [1-3]. Satz [3] ist in nichtkanonischer Reihenfolge. Wegen der Tauschbarkeit von Prädikat und Subjekt werden auch Subjekte von Adjektiven gebildet [4 5]. In [6] ist das Adjektiv das Prädikat und ein Ligatursatz das Subjekt.
|
(2) Nur selten finden sich Sätze, in denen das Prädikat eine Adverbphrase ist [7 8]. In der Regel sind dies Adverbien der kanina Gruppe {9-5.3 (1)}. Es gibt nahezu keine Adverbien als Subjekt.
|
(1) Präpositionalphrasen mit nasa (sa ) [1 2] oder einem Existenzwort [3-5] können das Prädikat [1 3 4] oder Subjekt [2 5] bilden.
| ||||||||||||||||
(2) Seltener werden Prädikat [6] oder Subjekt [7] von Präpositionalphrasen der tungkol Gruppe gebildet.
|
(1) Ein Teilsatz kann an Stelle des Subjekts treten {6-2.5}. Häufig ist dies ein Ligatursatz [1]. Wenn dessen Reihenfolge nichtkanonisch ist, stehen die Ligatur und ang am Anfang des Ligatursatzes [2]. Wenn der Teilsatz, der Subjekt ist, ein Fragewort enthält, wird ein Konjunktionssatz mit kung gebildet [3 4].
|
(2) In einigen zusammengesetzten Sätzen kann das Prädikat ein Teilsatz sein [5 6] {13-4.3.2 (4)}.
|
(1) In unserem Strukturmodell sind Prädikat und Subjekt Funktionsphrasen, sie stehen unmittelbar im Satz, ihre Funktion wird in {13-2.3 Θ} beschrieben. Prädikat und Subjekt können keine untergeordneten Phrasen sein.
(2) Das Prädikat kann wie folgt dargestellt werden.
| Prädikat ist | Prädikat besteht aus | ||
| [1] | Unmittelbar im Satz | Verbphrase | {2-4.4} |
| [2] | Unmittelbar im Satz | Nominalphrase | {2-4.2} |
| [3] | Unmittelbar im Satz | Adjektivphrase | {2-4.7} |
| [4] | Unmittelbar im Satz | Adverbphrase | {2-4.7 (3)} |
| [5] | Unmittelbar im Satz | Präpositionalphrase | {2-4.8} |
| [6] | Unmittelbar im Satz | Adjunktphrase | {2-4.6} |
| Teilsätze können das Prädikat bilden. | {2-4.9} | ||
In [6] ist die Adjunktphrase das Prädikat. Das ist syntaktisch eine Ausnahme, weil eine Funktionsphrase (Adjunkt) den Inhalt einer anderen Funktionsphrase (Prädikat) bildet {1-6.3 (4)}.
(3) Wegen der Symmetrie von Prädikat und Subjekt ist die Darstellung für das Subjekt im Strukturmodell fast gleich.
| Subjekt ist | Subjekt besteht aus | ||
| [7] | Unmittelbar im Satz | Nominalphrase | {2-4.1} |
| [8] | Unmittelbar im Satz | Verbphrase | {2-4.5} |
| [9] | Unmittelbar im Satz | Adjektivphrase | {2-4.7} |
| [10] | Unmittelbar im Satz | Adverbphrase | {2-4.7 (3)} |
| [11] | Unmittelbar im Satz | Präpositionalphrase | {2-4.8} |
| Teilsätze können das Subjekt bilden. | {2-4.9} | ||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-P_2.html
(1) Im Strukturmodell haben wir die Objunktphrase (Schlüssel {P-W}, pariralang pantuwịd {1A-201 (2)}) eingeführt; ng ist ihr Bestimmungswort. Die Objunktphrase wird in Nominalphrasen und in Verbphrasen verwendet. In einer Nominalphrase ist die Objunktphrase ein Attribut [1 4b] {8-8.1}. Als Bestandteil einer Verbphrase ist sie ein Argument {6-2.1}, das in der Regel die Funktion des Tatobjektes bei Aktivverben [2] oder des Täters bei Passiverben [3] hat. Ein Objunkt kann ein Adjektiv ergänzen [4a] {9-3.1}.
|
(2) Syntaktisch verhält sich die Objunktphrase wie folgt:
(3) Wir betrachten als nachlaufendes Verhalten (gawịng makahulị) die Eigenschaft, dass das Objunkt seinem Bezugswort unmittelbar nachgestellt wird. Dies entspricht dem Prinzip der Rechsverzweigung in der filipinischen Sprache {1-5.4}.
Wenn die Objunktphrase ein NG-Pronomen ist, kann es enklitisches Verhalten zeigen. In [3] ist dies ein einfaches Enklitgebilde {11-4.1}, in [5 6] ein Objunktinterklit {11-6.4}. Ein besonderes Gebilde ist der Interpotenzial in Sätzen mit Potenzialadverbien [7] {9-6.1.1}.
Nachlaufendes und enklitisches Verhalten ähneln einander. Die Unterschiede werden deutlich in [8], wo eine andere Phrase zwischen Bezugswort und Objunkt geschoben ist, das Verhalten ist also nicht zwingend nachlaufend.
|
(4) Adjunktphrasen mit attributiven Objunktphrasen in der Form sa … ng bezeichnen wir als Pseudopräpositionen [9] {4-3.2}, da sie semantisch die Rolle einer Präposition übernehmen, syntaktisch aber keine sind. Ähnlich sind Gebilde mit nasa … ng [10]. Idiomatisch sind Personalpronomen mit Objunkt als Attribut [11] {8-4.1 (2)}.
(5) Selten sind Gebilde wie [12b 13b]. Das Objunkt wird dem Verb ohne Bestimmungswort ng vorangestellt. Es ist nicht deutlich, ob dies Gebilde Objunkte sind (möglicherweise Satzbrüche oder disjunktive Nominalphrasen).
|
Das Bestimmungswort ng ist von lautlich gleichen anderen Wörtern [nʌŋ] zu unterscheiden {5-3.4}.
Vergleich von Objunkt- und Adjunktphrase → {3-5}.
In der Regel enthält die Objunktphrase eine Nominalphrase [1-3]. Mit den Artikeln si und sina wird das Bestimmungswort ng zu ni bzw nina (ng) verschmolzen, wenn diese unmittelbar nebeneinander zu stehen kommen würden [1b]. Steht zwischen ng und dem Artikel noch ein Attribut, so bleiben ng und Artikel unverändert [1c]. Mit Personal- und Demonstrativpronomen stehen statt ng deren NG-Pronomen {8-4.5} [2]; die Objunktphrase besteht dann nur aus diesem enklitischen Pronomen. Bei den Pluralbildungen von Demonstrativpronomen wie in [3] werden ANG-Pronomen mit ng mga verwendet {11-2 (2)}.
|
In einer Objunktphrase kann eine Präpositionalphrase mit nasa [1] oder eine Existenzphrase stehen [2]. Seltener sind Präpositionalphrasen der tungkol Gruppe [3].
|
Scheinbar können weitere Phrasen den Inhalt der Objunktphrase [1a 2a 3a] bilden. In Wirklichkeit handelt es sich um "gemeine" Nominalphrasen, die ein Attribut besitzen und deren Kernwort entfallen ist.
|
Im Strukturmodell haben wir neben Prädikat und Subjekt vier weitere Funktionsphrasen definiert, eine davon ist die Objunktphrase. Die Objunktphrase kann nicht unabhängig im Satz stehen, sie ist stets Attribut einer Inhaltsphrase. Im Strukturmodell kann die Objunktphrase wie folgt dargestellt werden.
| Objunkt ist | Objunkt besteht aus | ||
| [1] | Argument eines Verbs | Nominalphrase | {6-2.1} |
| [2] | Attribut eines Nomens | Nominalphrase | {8-8.1} |
| [3] | Präpositionalphrase | {3-2.2} | |
| [4] | Attribut eines Adjektivs | Nominalphrase | {9-3.1} |
(1) Im Allgemeinen können Objunkte und Adjunkte nicht gegeneinander ausgetauscht werden. Als Argument in einer Verbphrase ist die Funktion vom Verb festgelegt. Bei einer Gruppe von -um- Verben und bei einigen anderen Verben besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen Objunkt und Adjunkt.
(2) Objunkte und Adjunkte können in Nominalphrasen attributiv verwendet werden. Im Allgemeinen bestimmt die semantische Funktion des Attributs, ob ein Objunkt {8-8.1} oder ein Adjunkt verwendet wird {8-8.2}. Es gibt hier jedoch Gebilde, in denen statt eines Objunktes ein Adjunkt verwendet wird oder verwendet werden kann [1 2].
|
(3) Ist in einer Nominalphrase ein Objunkt ein Attribut und soll das Kernwort Substantiv weggelassen werden, so wird das Objunkt in ein Adjunkt gewandelt. Dies ist häufiger der Fall, wenn die Nominalphrase das Subjekt bildet [3], seltener wenn sie ein Objunkt in einem anderen Objunkt ist [4].
|
Die syntaktischen Unterschiede zwischen Objunkt- {P-W} und Adjunktphrase {P-K} stellen wir nachfolgend dar.
| Prädikat und Subjekt | ||
| {P-W} | Objunktphrasen können nicht Prädikat oder Subjekt des Satzes sein. | |
| {P-K} | Adjunktphrasen sind selten das Prädikat. | |
| Unabhängig oder am Satzanfang | ||
| {P-W} | Die Objunktphrase kann nicht unabhängig im Satz stehen. Sie kann nicht an den Satzanfang kommen. | |
| {P-K} | Adjunktphrasen können den Satz einleiten. | |
| Interklit | ||
| {P-W} | NG-Pronomen können Interklitkurzwort sein. | |
| {P-K} | Die gesamte Adjunktphrase kann enklitisches Bezugswort sein. | |
| Erfragung | ||
| {P-W} | Die Objunktphrase kann nicht erfragt werden. | |
| {P-K} | Adjunktphrasen können direkt erfragt werden mit kanino und saạn. | |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-W.html
Im Strukturmodell haben wir eine Adjunktphrase (Schlüssel {P-K}, pariralang pandako, {1A-201 (3)} ) eingeführt; sa ist das Bestimmungswort dieser Funktionsphrase (Schlüssel {TK}). Vielseitig ist die Verwendung der Adjunktphrase. Sie kann Attribut sein (Argument eines Verbs, Attribut zu Nominal- und Adjektivphrase und Attribut von Präpositionen) oder unabhängige Phrase, selten das Prädikat.
Einen Vergleich von Adjunkt- und Objunktphrase nehmen wir in {3-5} vor. Ein möglicher Wechsel zwischen Adjunkt und Objunkt wird in {3-4} betrachtet.
(1) In Verbphrasen steht die Adjunktphrase als Argument {*}. Abhängig vom Verb, bildet sie die verschiedenen K-Funktionen [1-3] (Empfänger, lokativ, Ursache und Austausch) oder den ausführenden Täter [4] {6-3.1 (2b)}).
|
(2) Adjunktphrasen können unabhängig im Satz stehen [5] {4-4} {*}. Substantive [6] {8-8.2} und weniger häufig Adjektive [7] {9-3.2} werden durch Adjunkte ergänzt. Besondere Gebilde sind Adjunktphrasen als Attribut zu isạ [8] oder anderen Mengenbegriffen [9]. In der Regel ist eine Adjunktphrase das Attribut zu einer Präposition der tungkol Gruppe [10 11]. Seltener (vermutlich nicht in der gehobenen Schriftsprache) steht die Adjunktphrase in verblosen Sätzen als Prädikat [12].
| |||||||||||||||||||
{*} Die Einteilung in Argumente, unabhängige Phrasen und Attribute ist nicht eindeutig. Es gibt fließende Übergange zwischen den drei Gruppen.
(3) SA-Pronomen bilden Adjunktphrasen (Argument von Verb [13], Attribut zu Substantiv [14] und unabhängige Phrase [15]) {8-4.6}.
|
(4) Adjunktphrasen können unmittelbar auf ein anderes Bestimmungswort folgen. Diese Gebilde entstehen, wenn das Kernwort der Phrase des ersten Bestimmungswortes entfallen ist [16 17].
|
(5) Wegen seines schwachen Inhaltes kann das Bestimmungswort sa semantisch präzisiert werden:
Die Adjunktphrase wird von einer Nominalphrase gebildet [1 2]. Das Bestimmungswort sa wird mit dem Artikel si zu kay verschmolzen und mit der Pluralform sinạ zu kinạ [3]. Nicht lokativ werden SA-Demonstrativpronomen als Argument eines Verbs verwendet [4]. Substantivisch verwendete Partizipien können ebenfalls Adjunktphrasen bilden [5].
|
In der filipinischen Sprache werden Ausdrücke der Form sa … ng verwendet, die semantisch die Funktion von lokalen [1 2b 3], seltener temporalen [2a], kausalen oder modalen Präpositionen erfüllen. Syntaktisch sind sie Adjunktphrasen, deren Kernwort durch eine nachfolgende Objunktphrase ergänzt wird. Da diese Gebilde syntaktisch keine Präpositionen sind, jedoch semantisch diese Funktion ausüben, bezeichnen wir sie als SA-NG-Pseudopräpositionen. In bestimmten Fällen wird ein nachfolgendes Objunkt als semantisch unpassend empfunden; dann werden die SA-NG Phrasen abgewandelt (halịp [3 4]).
Phrasen mit nasa .. ng [5] sind Präpositionalphrasen {10-3 (2)}.
|
(1) Die Adjunktphrase kann unabhängiger Bestandteil des Satzes sein [1-4] (Schlüssel {P-K/L}, pariralang pandakong malaya). Sie stellt dann häufig ein lokatives [1b] oder temporales Adjunkt dar [1a], das sich auf den gesamten Satz bezieht und nicht nur auf die Verb- oder eine andere Phrase [2b]. In der Regel steht die unabhängige Adjunktphrase am Satzanfang [3 4] oder an dessen Ende [1a 1b]. Nach einer unabhängigen Phrase vor dem Prädikat besitzt dieses oft sein Bestimmungswort ay [3].
Mit Hilfe des Interrogativpronomens saạn oder des Interrogativadverbs kailạn [5a] können unabhängige Adjunktphrasen erfragt werden.
|
(2) Die (gesamte) unabhängige Adjunktphrase kann als Interklitbezugswort dienen [4 5a 5b 7 8]. Diese Gebilde haben keine Ligatur {11-6.1 (4)}.
| |||||||
(3) Die Gebilde in [9 10] sind Teilsätze mit der Konjunktion tuwịng (keine unabhängigen Phrasen).
|
(1) Im Strukturmodell haben wir neben Prädikat und Subjekt vier weitere Funktionsphrasen definiert, eine davon ist die Adjunktphrase. Sie kann wie folgt dargestellt werden.
| Adjunkt ist | Adjunkt besteht aus | ||
| [1] | Argument eines Verbs | Nominalphrase | {6-2.2} |
| [2] | Attribut zu Nomen | Nominalphrase | {8-8.2} |
| [3] | Attribut zu Adjektiv | Nominalphrase | {9-3.2} |
| [4] | Attribut von Präposition | Nominalphrase | {10-2} |
| [5] | Unabhängige Phrase | Nominalphrase | {4-4} |
| [6] | Prädikat | Nominalphrase | {2-4.6} |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-K.html
Im Strukturmodell haben wir eine Subjunktphrase eingeführt. Darunter verstehen wir Phrasen, die mit der -ng/na Ligatur angeschlossen sind. Wir betrachten die Ligatur als das Bestimmungswort der Subjunktphrase.
Wir haben im Strukturmodell verschiedene Gruppen von Phrasen unter dem Namen Disjunktphrasen zusammengefasst. Darunter verstehen wir Phrasen, die kein Bestimmungswort oder das Bestimmungswort nang besitzen. Diese Phrasen sind syntaktisch unabhängig im Satz, es kann jedoch eine besondere semantische Verbindung zu einer anderen Phrase im Satz bestehen.
Subjunkte und Disjunkte gehören zu den Funktionsphrasen. Eine Mehrheit der Subjunkte und Disjunkte kann als Interklitbezugswort dienen.
(1) Die Subjunktphrase (Schlüssel {P-L} {*}, pariralang panlapạg, {1A-201 (4)) ist eine Funktionsphrase. Die -ng/na Ligatur (Schlüssel {L}, pang-angkọp) ist ihr Bestimmungswort.
{*} In unserem Schlüsselsystem nehmen wir häufig statt der aufwändigen Form {P-L=P-..} eine vereinfachte Darstellung der Subjunktphrase vor wie {…L} oder {.. L}.
(2) Die Ligatur wird verwendet, um zwei Elemente zu verbinden, die auf verschiedenen Niveaus stehen. Die Ligatur zeigt syntaktisch und semantisch eine Stufe an, sie steht zwischen einem unter- und einem übergeordneten Element. Dabei wird kein Unterschied zwischen einer Stufe nach oben oder nach unten gemacht. Sie zeigt nicht an, welches das ergänzte und welches das ergänzende Element ist {5A-201 Θ}. Bei einer nachgestellten Subjunktphrase steht die Ligatur am Anfang, eine vorangestellte Subjunktphrase hat die Ligatur an ihrem Ende (im Gegensatz zu den anderen Bestimmungswörtern).
Morphologie der Ligatur → {11-5.1}.
Wie bei anderen Funktionsphrasen gibt es auch bei Subjunkten welche mit und andere ohne Bestimmungswort.
(1) Eine Gruppe von Subjunkten wird stets mit einer Ligatur verwendet. Dazu gehören:
|
(2) In einer weiteren Gruppe von Subjunkten wird eine Ligatur verwendet oder nicht. Zu dieser Gruppe gehören:
| |||||||||||||||||||||||||
(3) Die Ligatur ist das Bestimmungswort der Subjunktphrase. Keine Ligatur steht bei Nicht-Subjunkten [15 16].
|
(4) In {11-5 (2), (3)} werden Verwendungen der Ligatur betrachtet, die wir nicht zu den Subjunkten zählen.
(1) Subjunkte können ohne Bestimmungswort, also ohne Ligatur, gebildet werden. In nur wenigen Fällen besitzt der Sprecher eine Wahlmöglichkeit; oft bestimmen Regeln, ob eine Ligatur verwendet wird oder wegfällt. Entsprechend dem phonologischen Umfeld wird entschieden, ob die Suffixform -ng oder das separate Wort na verwendet wird. In vielen Fällen gilt die Regel: Eine mögliche -ng Ligatur muss stehen (insbesondere in Interklitgebilden [1]), eine na Ligatur wird nur selten verwendet und darf in vielen Fällen nicht stehen [2].
|
Enklitische Kurzwörter und Ligatur → {11-5.2}
(2) Hinzu kommt, dass bestimmte Wörter und Gebilde mit der Ligatur unverträglich sind, obwohl die Phrasen als Subjunkte zu betrachten sind {5A-221}.
(1) Disjunktphrasen (Schlüssel {P-0} pariralang pang-umpọg, {1A-201 (5)}) stehen unabhängig im Satz. Am Satzanfang besitzen sie kein Bestimmungswort, an anderen Positionen erhält eine Anzahl Disjunkte das Bestimmungswort nang {5-3.3}. Sie sind Funktionsphrasen, besitzen also eine Inhaltsphrase, die Attribute enthalten kann. Wir haben folgende Gruppen von Disjunktphrasen gefunden:
Ein Teil der Disjunktphrasen kann als Interklitbezugswort dienen. Das Interklitkurzwort erhält dann eine Ligatur {5-3.5}.
(2) Unabhängige Phrasen (Schlüssel {P-../L}, pariralang malaya). Im Strukturmodell haben wir diesen Begriff eingeführt {1-5.1 (4)}. Zu ihnen gehören neben den Disjunktphrasen unabhängige Adjunkte {5A-301}. Unabhängige Phrasen stehen vorwiegend am Satzrand.
(3) Adverbialphrasen
(pariralang makaabay).
Unter diesem semantischen Begriff können unabhängige Phrasen und andere Adverbphrasen
zusammengefasst werden. Wir sind uns nicht sicher, ob eine solche Zusammenfassung in
der filipinischen Syntax sinnvoll ist und vermeiden daher diesen Begriff
{5A-302 ![]() }.
}.
Unter disjunktiven Nominalphrasen (Schlüssel {P-0=P-N}, pariralang makangalang pang-umpog) verstehen wir Gebilde, die ein Substantiv als Kernwort besitzen und unabhängig im Satz stehen [1-5]. Wie die meisten Disjunktphrasen stellen sie semantisch eine Zeitbeziehung dar [2-5]. Daneben kommen Disjunktphrasen mit einer modalen Beziehung vor [1]. In Satz [1b] wird das Bestimmungswort nang verwendet.
In der Regel steht die disjunktive Nominalphrase am Satzrand. Wie alle Disjunktphrasen besitzt sie keine Ligatur, diese steht jedoch, wenn die Phrase als Interklitbezugswort dient [5] {5-3.5}.
Das Substantiv der Disjunktphrase besitzt ein vorangestelltes Attribut. Häufig ist es ein Numerale [2 5].
|
Im Satz [6] ist die Nominalphrase das Prädikat, also kein Disjunkt, obwohl es diesen semantisch ähnlich ist.
|
Disjunkte können mit einem Gerundium eingeleitet werden; diese Gerundphrasen (Schlüssel {P-ND}, pariralang pangngaldiwa) {*} besitzen eine temporale Funktion [1-4].
{*} Wir bezeichnen als 'Gerundphrase' die Disjunktphrasen, die von einem Gerundium gebildet werden. Andere Phrasen, die ein Gerundium als Kernwort besitzen, nennen wir Nominalphrasen.
Gerundphrasen sind eine Sonderform der disjunktiven Nominalphrasen, die sich im Bau von jenen unterscheiden. In der Regel stehen sie am Satzanfang [1 2 4] (in [3] am Anfang des Teilsatzes). Sie sind keine verkürzten Teilsätze, da sie nicht zu einem vollständigen Teilsatz erweitert werden können [2a|b]. Ein Komma wird in [1 2] verwendet, um die unabhängige Phrase abzutrennen. Mit perfektiven Gerundien werden ebenfalls Gerundphrasen gebildet [3 4], jedoch nicht mit iterativen Gerundien. Die Gerundphrase kann verkürzt sein, so dass sie nur aus dem Gerundium besteht, das dann wie ein Adverb erscheint [4].
|
Steht ein Disjunkt am Satzanfang, so wird kein Bestimmungswort verwendet. In anderen Fällen kann das Bestimmungswort nang (nang (3), Schlüssel {T0}) vor dem Disjunkt stehen. Da Disjunktphrasen unabhängig im Satz sind, dient nang in erster Linie dazu, die Disjunktphrase von der vorausgehenden Phrase abzutrennen und weniger um anzuzeigen, dass die folgende Phrase ein Disjunkt ist.
In disjunktiven Nominalphrasen und seltener in Gerundphrasen kann nang stehen [1]. In unabhängigen Adverbphrasen wird nang verwendet [2 3]. Die Problematik von unmittelbar auf das Verb folgenden Adverbien wird in {9-5.2 (3)} betrachtet [4]. Die kanino Gruppe bildet Disjunktphrasen ohne das Bestimmungswort nang [5] {9-5.3 (1)}.
|
Zusätzlich zu der oben betrachteten Funktion von nang als Bestimmungswort der Disjunktphrase kann das [nʌŋ] ausgesprochene Wort verschiedene andere Bedeutungen haben {5A-341}.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definitionsgemäß werden Disjunkte ohne Ligatur angeschlossen. Disjunktive Nominalphrasen [1] und disjunktive Adverbphrasen [2-4] können als Interklitbezugswort dienen {11-6.1 (3)}, dann erhält das Enklit häufig eine Ligatur.
In [5] ist ein enklitisches Adverb Attribut in der Disjunktphrase (einfaches Enklitgebilde {11-4.1}). Auch hier steht eine Ligatur.
Wegen der Ligatur betrachten wir diese Phrasen als Subjunkte.
| |||||||||||||
(1) Im Strukturmodell werden die Subjunkte wie folgt dargestellt.
| Subjunkt ist | Subjunkt enthält | ||
| [1] | Attribut zu Nomen | Adjektiv | {8-7.1} |
| [2] | Attribut zu Nomen | SA-Personalpronomen | {8-4.6 (3)} |
| [3] | Attribut zu Nomen | Substantiv | {8-7.4 (1)} |
| [4] | Attribut zu Nomen | ANG-Demonstrativpronomen | {8-7.3} |
| [5] | Attribut zu Nomen | Präpositionalphrase | {8-7.6} |
| [6] | Argument von Verb | Nominalphrase | {6-2.3} |
| [7] | Verb zugeordnet | Verbphrase (verbundene Verben) | {6-7.2} |
| [8] | Attribut zu Verb | Adverb | {9-5.2} |
| [9] | Attribut zu Adjektiv | Verbphrase | {9-3.3 (1)} |
| [10] | Attribut zu Adjektiv | Adverb | {9-3.3 (2)} |
| Ligatur zum Anschluss von Ligatursätzen. | {13-4.3} | ||
Diese Vielseitigkeit in Verwendung und Aufbau der Subjunkte ist ein weiteres Beispiel syntaktischer Gebilde in der filipinischen Sprache, die nicht auf eine bestimmte konventionelle Wortart beschränkt sind.
(2) Im Strukturmodell werden die Disjunkte wie folgt dargestellt.
| Disjunkt ist | Disjunkt enthält | ||
| [11] | Unabhängige Phrase im Satz | Nominalphrase | {5-3.1} |
| [12] | Unabhängige Phrase im Satz | Gerundphrase | {5-3.2} |
| [13] | Unabhängige Phrase im Satz | Präpositionalphrase (tungkol) | {10-2 (2)} |
| [14] | Syntaktisch unabhängige Phrase im Satz | Adverbphrase | {9-5.3} |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-L.html
(1) Die filipinischen Verben (Schlüssel {D}, pandiwa) besitzen ein deutlich ausgeprägtes Flexionsparadigma bezüglich Tempus bzw. Aspekt (banghạy, 'aspect inflection') {6A-101 Θ}. Wir nennen die Verbformen der Flexion Zeitformen. Wegen dieser Flexion können Verben von anderen konventionellen Wortarten unterschieden werden. Person- und Numerusflexion bestehen nicht. Es gibt keine unterschiedlichen Modi (panagano), ein Konjunktiv (pasakali) wird durch Adverbien oder Konjunktionen realisiert (der Ausdruck Indikativ paturọl wird von uns nicht verwendet). Genera (katinigan) werden deutlich durch Affixe unterschieden. In der Regel gibt es mehrere Aktiv- und Passivverben in einer Wortfamilie, die dann jeweils ihre eigene Flexion besitzen.
Verben sind Inhaltswörter mit semantischem Inhalt, die einen Zustand, einen Prozess oder eine Tätigkeit ausdrücken. Es gibt keine Verben ohne Flexion und keine "Hilfsverben".
Auffallend ist die große morphologische Diversität der filipinischen Verben. Mit dieser werden nicht nur Aktiv und Passiv realisiert, sondern auch Art des Passivs und die Modalität der Verben. Die einzelnen morphologischen Gruppen besitzen häufig eine syntaktische Grundfunktion. Wir betrachen diese morphologische Einteilung jedoch nur als eine der vier wichtigen für die Verben in der filipinischen Sprache.
(2) Filipinische Verben können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden:
Mit anderen Worten können wir sagen, dass die Argumentstruktur das syntaktische Gerüst beschreibt, Fokus und Funktion den semantischen Inhalt, während Affigierung die sprachliche Darstellung des Verbs ist. Wir betrachten für jedes Verb diese Einteilung getrennt, morphologische und syntaktische Verbgruppen sind - von Ausnahmen abgesehen - eindeutig festzulegen, diese Eigenschaften sind in unserem Schlüsselsystem enthalten. Ebenso haben wir die Fokusklassen dort aufgenommen, während die semantische Einteilung nach Modalität weniger eindeutig ist.
Ein Schwerpunkt unserer Betrachtungen über die filipinischen Verben ist, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der entsprechenden Gruppen in den verschiedenen Kategorien deutlich zu machen {6A-102}. Die Einzeldarstellung der Verbgruppen wird in Kapitel {7} entsprechend ihrer Affigierung vorgenommen.
Eine Sonderstellung nehmen die Verben des Stammes bilị ein, die wir als atypisch betrachten.
(3) Neben den Vollverben {2-4.3} führen wir den Begriff Partizip ein. Unter Partizipien verstehen wir Zeitformen der Verben, die ihre globale Wirkung im Satz abgelegt haben. Somit besteht kein morphologischer Unterschied zwischen Vollverben und Partizipien {6A-103 Θ}.
(4) Morphologisch sind filipinische Gerundien abgeleitete Verbformen, stehen jedoch syntaktisch und semantisch den Substantiven viel näher als den Verben.
(5) Die Modalwörter wie gustọ sind keine Verben, da sie keine Flexion besitzen. Wir ordnen sie als Potenzialadverbien dieser Wortart zu {9-6.1}.
(1) Bildet das Verb den Kern des Prädikats, so stehen Subjekt, Objunkt-, Adjunkt- und Subjunktphrasen in besonderer Beziehung zum Verb. Das Verb besitzt eine globale Wirkung im Satz, es ist Vollverb {2-4.3}. Wir bezeichnen diese dem Verb zugeordneten Phrasen als Argumente des Verbs (kaganapan ng pandiwa) {6A-201 Θ}. Objunkte, Adjunkte und Subjunkte sind Bestandteil der Verbphrase, während das Subjekt außerhalb dieser steht.
(2) Die 'Argumentstruktur' (kayariạn ng kaganapan), die Zahl und Art der Argumente, ist die wichtigste syntaktische Eigenschaft des Vollverbs. Mit Ausnahme einiger Adjunkte ist diese deutlich und eindeutig sichtbar, sie ist Bestandteil unseres Schlüsselsystems {6A-202}.
Die Begriffe 'direktes' und 'indirektes Objekt', 'transitives' und 'intransitives Verb' werden von uns nicht verwendet, da sie nicht gut zur syntaktischen Beschreibung filipinischer Verben geeignet sind.
(3) Die morphologische Realisierung des Verbs kommt in der Argumentstruktur nicht vor, Syntax und Morphologie sind getrennt. Dies erscheint uns für eine morphosyntaktische Betrachtung von Vorteil, es können Relationen zwischen syntaktischer Gruppe und morphologischer Realisierung empirisch ermittelt werden. Dazu ein Beispiel:
Die morphologisch unterschiedlichen Verben isipin, buksạn und isulat besitzen die gleiche Argumentstruktur {DB10/ft|fg}. Andererseits gibt es in der morphologischen Gruppe der i- Verben nahezu alle verschiedenen Passivargumentstrukturen.
(4) In der Regel bilden Phrasen die Argumente der Verben. Stattdessen kann auch ein Ligatur- oder Konjunktionssatz ein Argument sein {6-2.5}.
(1) Objunkte {P-W} sind Attribute in Nominalphrasen oder Argumente von Verben. Als Argument steht das Objunkt nach dem Verb [1], es besitzt nachlaufendes Verhalten. Wenn das Objunkt ein Pronomen ist, kann ein Objunktinterklit gebildet werden [2] {11-6.4}. Diesem ähnlich ist ein Interpotenzial [3] {9-6.1.1}.
| |||||||||
(2) Ein Verb kann bis zu drei Objunkte als Argument besitzen.
Adjunkte {P-K} können Argument des Verbs sein, in der Regel besitzt der Satz nur ein Adjunkt. Empfänger [1], lokativ [2], ausführender Täter [3], Ursache oder Austausch sind die semantischen Funktionen des Adjunkts. Andererseits kann die Adjunktphrase unabhängig im Satz stehen {4-4}. Beide Begriffe sind semantisch; syntaktisch verhält sich das Adjunkt in beiden Verwendungen nahezu gleich.
Das Argument Adjunktphrase kann mit den SA-Interrogativpronomen kanino und saạn (sa) [7 8] erfragt werden.
| ||||||||||||||||||||||||||
(1) Eine Nominalphrase kann als Subjunkt {P-L=P-N} mit dem Verb verbunden werden. In der Regel steht das Subjunkt unmittelbar nach dem Verb [1 2], kann jedoch auch nach einer anderen Phrase stehen [3].
Semantisch ist das Subjunkt als Argument in enger Beziehung zum Subjekt (in [1b] siya und Joe Carter). Obwohl das Subjunkt Argument ist, kann es im Allgemeinen nicht durch Änderung der Affigierung des Verbs in den Fokus gesetzt werden. Wir haben die Funktion Subjunkt nicht in das Fokussystem der Verben aufgenommen.
| |||||||||||
(2) In einfachen Sätzen kann das untergeordnete Verb von verbundenen Verben als Argument (Subjunkt, {P-L=P-D}) betrachtet werden {13-4.6.2}.
(3) Neben dem Subjekt besitzt das Verb magịng ein zweites Argument. Dies ist eine Nominal- oder Adjektivphrase [4 5], die ohne Ligatur angeschlossen wird. Wir betrachten dieses Argument als Subjunkt ohne Ligatur.
|
Bezüglich der Reihenfolge von Objunkten und Adjunkten gibt es wenig feste Regeln. Kurze Phrasen kommen in der Regel vor längeren. Wenn die Phrasen etwa gleichlang sind, gilt im Allgemeinen die Reihenfolge Objunkt(e) - Adjunkt - Subjekt [1]. Feste Regeln gelten, wenn dem Verb enklitische ANG- oder NG-Pronomen folgen {*}, diese müssen unmittelbar hinter dem Verb stehen [2]. Dies gilt auch für das Subjekt [3]. Bezüglich der Reihenfolge der Pronomen siehe {11-4.3}.
{*} Bildet ein SA-Pronomen ein Argument, so besitzt es das Bestimmungswort sa und hat kein enklitische Verhalten.
|
Objunkte sind dem Verb enger verbunden als Adjunkte:
Neben Phrasen kann auch ein Teilsatz {S-..} als Argument dienen, vorwiegend als Subjekt [1a|b] {2-4.9 (1)}. Auch kann ein Objunkt [2a|b] oder ein Adjunkt [3a|b] durch einen Teilsatz ersetzt werden, in der Regel durch einen Ligatursatz. Diese Sätze werden selten gebildet, häufiger sind Sätze, in denen das Subjekt durch einen Teilsatz ersetzt wird.
|
(1) In Sätzen mit Verb als Prädikat wird die semantische Rolle des Subjekts durch die Wahl des Verbs bestimmt. Da in der filipinischen Sprache das Subjekt einen besonderen Fokus besitzt, wird dies als Fokus der Verben (fokus ng pandiwa) bezeichnet [1]. Der Fokus der Verben steht als semantischer Begriff in Zusammenhang mit der syntaktischen Argumentstruktur der Verben. Bildet die Verbphrase das Subjekt des Satzes {2-2.3}, so kann der Begriff Fokus der Verben sinngemäß auf die das Prädikat bildende Nominalphrase angewandt werden, obwohl diese nicht das Bestimmtheit besitzende Subjekt ist [2].
|
Wir können unterscheiden {6A-311
![]() }:
}:
| (1a) Fokus (Subjekt) | Genus verbi | |||
| {../f0} | Kein Fokus | {D} | Fokuslose Verben | {6-3.4.1} |
| {../fg} | Täter (tagaganap) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.2 (2)} |
| Ausführender Täter (tagagawa) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.2 (2)} | |
| {../fh} | Veranlasser (tagahimok) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.2 (5)} |
| {../fa} | Erwäger (tagaakala) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.2 (6)} |
| {../fr} | Reziprok (resiprokal) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.2 (4)} |
| {../fy} | Besitzer Zustand (panlagay) | {DT} | Zustandsv. (Aktiv) | {6-3.4.3} |
| {../ft} | Tatobjekt (tagatiis) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.4} |
| {../fp} | Empfänger (tagatanggap) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.5} |
| {../fn} | Ort (lunan) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.6} |
| {../fs} | Ursache (sanhi) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.7} |
| {../fl} | Austausch (pagpalit) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.8} |
| {../fm} | Werkzeug (kagamitan) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.9} |
(2) Definitionsgemäß bezieht sich der Fokus der Verben auf das Subjekt bzw. auf das Prädikat. Wir können jedoch dieses System für alle Argumente des Verbs erweitern und so auch die dem Verb zugeordneten Objunkt- und Adjunktphrasen semantisch bewerten. Wir nennen dies (semantische) Funktion eines Argumentes (katungkulan ng kaganapan). Der Fokus wird dann ein Sonderfall, er ist die semantische Funktion des Subjekts. Für alle Funktionen verwenden wir die gleichen Schlüsselbezeichnungen, jedoch steht bei Nicht-Fokus f für Funktion an Stelle von Fokus [3]:
|
In unserem Schlüsselsystem geben wir die Funktion aller Argumente gleichzeitig an (Beispiel {../fp|fa|fb}, Reihenfolge ist Subjekt | Objunkt(e) | Adjunkt) {6A-202}.
Die verschiedenen Funktionen können in folgender Tabelle dargestellt werden:
| (2a) Funktion des Objunktes | Genus verbi | |||
| {P-W/ft} | Tatobjekt (tagatiis) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.4} |
| {P-W/fg} | Täter (tagaganap) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.2 (3)} |
| {DP} | Katatapos | {6-6.6} | ||
| Ausführender oder potenzieller Täter (tagagawa) |
{DT} | Aktivverben | {6-3.4.2 (3)} | |
| {DB} | Passivverben | {6-3.4.2 (3)} | ||
| {P-W/fh} | Veranlasser (tagahimok) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.2 (5)} |
| {P-W/fa} | Erwäger (tagaakala) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.2 (6)} |
| {P-W/fy} | Besitzer Zustand (panlagay) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.3} |
| {P-W/fn} | Ort (lunan) | {DT10} | Aktivverben | {6-3.4.6} |
| {P-W/fl} | Austausch (pagpalit) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.8} |
| {DB} | Passivverben | {6-3.4.8} | ||
| {P-W/fm} | Werkzeug (kagamitan) | {DB} | Passivverben | {6-3.4.9} |
| (2b) Funktion des Adjunktes | Genus verbi | |||
| {P-K/fg} | Ausführender Täter (tagagawa) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.2 (3)} |
| {DB} | Passivverben | {6-3.4.2 (3)} | ||
| {P-K/fp} | Empfänger (tagatanggap) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.5 (2)} |
| {DB} | Passivverben | {6-3.4.5 (2)} | ||
| {P-K/fn} | Ort (lunan) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.6 (2)} |
| {DB} | Passivverben | {6-3.4.6 (2)} | ||
| {P-K/fs} | Ursache (sanhi) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.7} |
| {P-K/fl} | Austausch (pagpalit) | {DT} | Aktivverben | {6-3.4.8} |
| {DB} | Passivverben | {6-3.4.8} | ||
Zur Vereinfachung bezeichnen wir die Gesamtheit der durch Adjunkte dargestellten Funktionen, also Empfänger, lokative Funktion, Ursache und Austausch, als K-Funktion (mit Schlüssel {../fK} als Abkürzung, (pandako)); ebenso sprechen wir von K-Fokus (wobei wir hier Werkzeugfokus einschließen {6-3.4.9}).
(3) Die Einteilung nach Fokus und Funktion ist semantisch. Daher gibt es hier Abgrenzungsprobleme. Täter und Veranlasser lassen sich in der Regel gut trennen {6A-3421}. Die Zuordnung zu Erleider eines Zustandes oder Tatobjekt ist vielfach nicht eindeutig {6A-3431 (4)}. Zwischen Tatobjekt und Empfänger kann es dann Probleme geben, wenn eine einzige Phrase zuzuordnen ist (Beispiele umakyạt, iwan). Wenn mehrere Phrasen vorhanden sind, sind in der Regel die Zuordnungen eindeutig (Beispiel magbigạy, iwanan). In undeutlichen Fällen wenden wir die Regel an, von Empfänger zu sprechen, wenn die entsprechende Phrase ein Lebewesen ist und anderenfalls von lokativem Fokus bzw. Tatobjekt.
Einige Fälle von K-Fokus bzw. K-Funktion sind nur schwer einer der oben angegebenen Gruppen zuzuordnen. Wir erweitern daher den Begriff des lokativen Fokus bzw. der lokativen Funktion, um dort Gebilde einordnen zu können, die nur in einem sehr weit übertragenem Sinn als lokativ betrachtet werden können {6-3.4.6 (3)}.
(4) Im Allgemeinen können innerhalb der Wortfamilie Verben gebildet werden, mit denen aus dem im Fokus stehenden Subjekt ein Komplement oder Adjunkt wird. Das ist jedoch nicht bei allen Verben der Fall. Es gibt Verben, die nur Entsprechungen mit einem Disjunkt besitzen [4a|b]. Einige Verben besitzen keine Entsprechungen in der Wortfamilie [5b 6].
|
(5) Die Begriffe Fokus und Funktion können für das Katatapos verwendet werden, da dieses eine Verbform ist {6-6.6}.
(1) Verben können als Genera verbi in Passiv (Schlüssel {DB}, balintiyạk) und Aktiv ({DT}, tahasan; katinigan = 'genus verbi', Diathese) eingeteilt werden. Mit Aktiv bezeichnen wir Gebilde, bei denen der Täter, Veranlasser oder Erwäger das Subjekt des Satzes ist. Mit Passiv bezeichnen wir die davon abweichenden Gebilde. Die Einteilung in Aktiv und Passiv ist möglich, wenn es zu dem Verb ein Subjekt im Satz gibt.
(2) In der filipinischen Sprache gibt es keinen deutlichen syntaktischen Unterschied zwischen Passiv und Aktiv. Beide Arten von Sätzen sind gleichermaßen einfach zu bilden [1 2] (im Gegensatz zu den europäischen Sprachen, in denen Passivsätze komplizierter sind).
|
Jedoch gibt es eine bemerkenswerte Abweichung: Gerundien besitzen eine deutliche Zuordnung zu den Aktivverben, jedoch keine zu Passivverben {6-4.2.2 Θ}.
(3) Alle Verben besitzen Affixe, und es gibt keine offensichtlichen morphologischen Gründe, Affixe dem Passiv oder dem Aktiv zuzuordnen (Beispiel: -in für Passiv und -um- für Aktiv). Trotzdem sind beide Genera gut zu unterscheiden: Nicht nur einige -um- Verben, sondern alle sind Aktivverben und alle -in Verben Passivverben. Es ist nicht deutlich einsichtig, warum das Affix -um- Aktivverben markiert und -in Passivverben.
(4) In der filipinischen Sprache sind Passiv und Aktiv ausschließlich semantische Begriffe. Regelmäßig wird das Passiv vorgezogen {6A-321}. Aktivverben werden hauptsächlich dann verwendet, wenn bestimmte Gründe dafür vorliegen:
| |||||||||||||||||||||||||||
(5) In vielen Passivsätzen ist das Tatobjekt das Subjekt und der
Täter ein Objunkt (Fokus {DB../ft}); während in Aktivsätzen der Täter als Subjekt im Fokus
steht und das Tatobjekt ein Objunkt ist. Trotzdem ist in der Regel der Täter in einem
Aktivsatz (Subjekt) semantisch weniger aktiv (di-masikap) als der syntaktisch
passive Täter in Passivsätzen [8 9] {![]() Nolasco 2006 p. 7}. In
beiden Beispielpaaren ist es die Bestimmtheit des Subjekts ang librọ bzw.
ang ilog, die den Passivsatz semantisch aktiver macht als der Aktivsatz mit
nicht im Fokus stehender Phrase ist (Objunkt ng librọ bzw. dem Satz
zugehöriges Adjunkt sa ilog).
Nolasco 2006 p. 7}. In
beiden Beispielpaaren ist es die Bestimmtheit des Subjekts ang librọ bzw.
ang ilog, die den Passivsatz semantisch aktiver macht als der Aktivsatz mit
nicht im Fokus stehender Phrase ist (Objunkt ng librọ bzw. dem Satz
zugehöriges Adjunkt sa ilog).
|
Vorbemerkung
Von der Semantik aus betrachtet, gibt es Übergangssituationen zwischen Aktiv und Passiv. Ein Verursacher kann eine Tätigkeit auslösen ('Ich zünde das Holz an.') Der Ausführende der Tätigkeit kann als aktiv ('Das Holz brennt.') oder passiv ('Das Holz wird verbrannt.') betrachtet werden. In den europäischen Sprachen besteht eine deutliche syntaktische Trennung zwischen Aktiv und Passiv. Diese fehlt im Filipino, und so kann der semantisch fließende Übergang auch in der Syntax fließend bleiben.
(1) In der filipinischen Sprache besteht bei der Flexion der Verben kein prinzipieller Unterschied zwischen Aktiv und Passiv, beide Genera folgen den gleichen Regeln. Eine Unterscheidung zwischen Aktiv- und Passivgebilden wird dadurch vorgenommen, dass Affixe bzw. Affixkombinationen entweder Aktiv oder Passiv zugeordnet werden.
(2) Verben in einem Übergangsbereich werden mit dem unbetonten Präfix ma-, mit betontem ma- und mit mapa- gebildet. Die ma- Aktivverben sind meist Zustandsverben und seltener Verben für zumeist einfache Tätigkeiten {7-1.1}, während die ma- Passivverben die Modalität der Fähigkeit besitzen {7-3.1}. Dazwischen finden sich Verben im Übergangsbereich. Bei den ma- und mapa- Verben überwiegen Passivverben mit der Modalität des Zufalls {7-3.5.1}, einige Aktivverben und Verben des Übergangsbereichs besitzen ebenfalls diese Modalität.
Beispielsätze → {7A-311}
In Sätzen ohne Subjekt, deren Prädikat ein Verb ist, besitzt letzteres keinen Fokus [1-3] (Schlüssel {../f0}) {13-2.2.2}. Satz [3] besitzt kein Subjekt, und das Verb bilisạn hat hier keinen Fokus, obwohl es in anderem Zusammenhang einen solchen besitzen kann. Wegen des Potenzialadverbs dapat ist der subjekt- und fokuslose Satz [4] eine allgemeingültige Aussage.
|
Bei fokuslosen Verben kann man nicht von Aktiv oder Passiv sprechen, die entsprechende Angabe fehlt im Schlüssel. Fokuslose Verben sind Vollverben {2-4.3}, selbst wenn sie keine Argumente besitzen.
(1) Der Begriff des Täters bedarf einer genaueren Betrachtung.
(2) Ein Großteil der Aktivverben haben den Täter als fokustragendes Subjekt. Wichtigste Affixe mit Täterfokus sind mang-, -um- und mag- [1-3]; hinzu kommen zusammengesetzte Aktivaffixe [4-7]. Bei bestimmten Passivverben kann der ausführende Täter in den Fokus gesetzt werden [8-11], während der Veranlasser zum Objunkt ohne Fokus wird. In Sätzen mit Potenzialadverbien kann der potenzielle Täter als fokustragendes Subjekt dargestellt werden [12].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) In Sätzen mit einfachen und vielen anderen Passivverben hat ein Objunkt die Täterfunktion [13]. Bei Verben der Veranlassung kann ein Adjunkt [14 15] oder ein Objunkt [16] die Funktion des ausführenden Täters ausüben. In Sätzen mit Potenzialadverbien kann der potenzielle Täter als Objunkt ausgedrückt werden [17]. Im Katatapos ist der Täter ein Objunkt [18].
| |||||||||||||||||||||||||||||
(4) Der reziproke Fokus (Schlüssel {../fr}, fokus na resiprokal) ist eine Form des Täterfokus, der eine besondere Modalität besitzt [19 20]. Zwei Personen oder zwei Gruppen führen eine Tätigkeit füreinander oder miteinander aus. Reziproker Fokus wird vorwiegend mit mag--an [19] und maki- Präfixen [20] gebildet.
Einer der Beteiligten kann neben dem oder den anderen Beteiligten, die im Fokus stehen, als zweites Argument in den Satz eingefügt werden (reziproke Funktion [21]).
| ||||||||||||||||
(5) Aktivverben der Veranlassung haben den Initiator der Tätigkeit als fokustragendes Subjekt. Sie werden in der Regel mit Affix magpa- gebildet [22 23], seltener mit anderen Affixen [24]. In Passivsätzen übt in der Regel ein Objunkt die Veranlasserfunktion aus [25-29].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Bei Potenzialadverbien wird der Täter zum Erwäger [30 31]. In bestimmten Fällen kann zusätzlich der potenzielle Täter dargestellt werden (si Rita in [31]). Bei nichtnominalem Verhalten der Potenzialadverbien ist der Erwäger bei Aktivverben im Fokus [30]. Bei Passivverben und bei nominalem Verhalten ist er ein Objunkt [31].
| ||||||||||||
Zustandsverben beschreiben einen Zustand oder ein Gefühl [1 2]. Der Besitzer oder Erleider wird in den Fokus gesetzt (Schlüssel {../fy}, fokus na panlagạy). Ebenfalls betrachten wir hier kleine Veränderungen eines Zustands und auch von selbst ablaufende Prozesse (die nicht rein 'statisch' sind) [4]. Bei einigen Verben ist eine solche Trennung fast nicht möglich [5 6] {6A-3431}.
Zustandsverben werden mit ma- [1 2], aber auch mit anderen Affixen gebildet [3-6]. Zustände können in Passivsätzen ausgedrückt werden, so dass es passive Zustandsverben mit der Funktion des Besitzers des Zustandes gibt [7].
|
(1) Eine große Gruppe von Passivverben setzen das semantische Tatobjekt in den Fokus ('patient focus', Schlüssel {../ft}, fokus na tagatiịs). Bei -in [1], i- Verben [2], ma- [3] und ma- Passivverben [4] ist dies die Regel, seltener bei -an Verben [5 6]. Ähnliches gilt für Affixkombinationen [7-10]. Eine eindeutige Zuordnung zu Tatobjekt oder Ort ist nicht immer möglich [6].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) In Aktivsätzen wird die Tatobjektfunktion durch ein Objunkt ausgedrückt [11-13]. Nicht bei allen Passivverben steht das Tatobjekt im Fokus. Besitzen Passivverben mit Affix -an und dessen Kombinationen solch ein Tatobjekt (das nicht Subjekt ist [5 6]), so ist es ein Objunkt [14 17] oder seltener ein Adjunkt [15]. Auch andere Passivverben, bei denen das Tatobjekt nicht im Fokus steht, können die Tatobjektfunktion als Objunkt besitzen [18]. Wenn das Katatapos eine Tatobjekt besitzt, so ist ebenfalls in der Regel ein Objunkt [16].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_01.html
(1) Eine Gruppe von Passivverben setzt den Empfänger, Begünstigten oder Adressaten der Tätigkeit in den Fokus ('beneficiary focus', Schlüssel {../fp}, fokus na tagatanggạp). Die große Mehrheit dieser Verben hat eine {DB20} Syntax; Empfängerfokus wird vorwiegend mit -an [1 2], aber auch mit i- [3] Verben und deren Affixkombinationen gebildet [4-6].
| |||||||||||||||||||||||||||||
(2) Empfängerfunktion wird durch ein Adjunkt ausgedrückt. Sätze [7 8 10] sind mit Aktivverben mit Täterfokus gebildet. Auch Passivsätze (Verben mit i- Affixen) [9 11] werden mit Adjunkt in Empfängerfunktion gebildet.
| ||||||||||||||||||||||||
(1) Eine Gruppe von Verben besitzt einen lokativen Fokus (Schlüssel {../fn}, fokus na panlunạn). Dies kann der Ort der Tätigkeit [1], deren räumlicher Ausgangs- oder Endpunkt sein [2]. Diese Verben werden nahezu stets mit Suffix -an gebildet [1 2], manchmal zusammen mit einem anderen Affix [3].
| |||||||||||||||||||||
(2) Lokative Funktion wird bei Aktivverben nahezu regelmäßig mit einem Adjunkt [5 6 9] und bei wenigen -um- Verben mit einem Objunkt ausgedrückt [7]. Passivverben mit Adjunkt in lokativer Funktion sind vorwiegend Verben mit Affix i- und dessen Kombinationen [8 10].
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Einige Gebilde werden von uns dem lokativen Fokus bzw. der lokativen Funktion zugeordnet, wenn sie in einem erweiterten oder übertragenen Sinn als lokativ betrachtet werden können und in keine der anderen Gruppen passen [12-15].
| ||||||||||||||||||||
Einige Präfixe können Verben bilden, bei denen die Ursache (Schlüssel {../fs}, fokus na sanhị) in den Fokus gesetzt wird [1-3]. Die Präfixe dieser Verben sind mehrheitlich ka--an und ika- [1 2]. Seltener sind Sätze mit einem iterativen Gerundium als Subjekt mit Ursachefokus [3]. Ursachefunktion wird durch ein Adjunkt ausgedrückt [4 7 8]. Adjunktphrasen mit iterativen Gerundien besitzen Ursachefunktion [5].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei dem seltenen Austausch- oder Vergleichsfokus (Schlüssel {../fl}, fokus na pagpalịt) wird einer der Partner des Vergleichs in den Fokus gesetzt, während der andere Partner Austauschfunktion besitzt und ein Objunkt [1] oder Adjunkt bildet [2 4] (oder Objunkt und Adjunkt [3]). Wir bezeichnen daher den ursprünglichen Partner mit Schlüssel {../fl1} und den eingetauschten Partner mit {../fl2}.
| ||||||||||||||||
Eine Anzahl Präfixe können Verben bilden, bei denen das Werkzeug (instrumentaler Fokus, Schlüssel {../fm}, fokus na kagamitạn) in den Fokus gesetzt werden. Diese weniger häufig verwendeten Verben werden vorwiegend mit Präfix ipang- [1] gebildet. Eine Werkzeugfunktion wird in der Regel mit der Pseudopräposition sa pamamagitan ng dargestellt [2], in wenigen Fällen als ein zweites Objunkt [3]. Syntaktisch verhält sich Werkzeugfokus wie ein K-Fokus, so dass wir ihn zu dieser Gruppe zählen. Da die Werkzeugfunktion durch ein Objunkt dargestellt wird, ist sie keine K-Funktion.
| |||||||||||||||||||||
(1) In der filipinischen Sprache spielt der Täter eine weitaus geringere Rolle als z.B. in
europäischen Sprachen. Insbesondere besteht in Filipino kein regelmäßiger Zusammenhang
zwischen Subjekt und Täter, was zu ausführlichen Diskussionen in der linguistischen
Literatur geführt hat (siehe die kritische Darstellung bei
{![]() Kroeger 1991 p. 25 ff.}). Fokus und Funktion des Verbs in
Zusammenhang mit Fokus und Bestimmtheit des Subjekts können dazu dienen, den Täter
hervorzuheben oder in den Hintergrund treten zu lassen.
Kroeger 1991 p. 25 ff.}). Fokus und Funktion des Verbs in
Zusammenhang mit Fokus und Bestimmtheit des Subjekts können dazu dienen, den Täter
hervorzuheben oder in den Hintergrund treten zu lassen.
(2) Die stärkste Hervorhebung des Täters wird erreicht, wenn ein Verb mit Täterfokus gewählt wird und der Täter das fokustragende Subjekt des Satzes bildet, das diesem eine hohe Bestimmtheit zuweist. Die syntaktische Markierung erfolgt durch das Bestimmungswort ang [1], einen Artikel wie si oder durch Verwendung eines Pronomens [2]. Dem Täter kann seine Bestimmtheit genommen werden, indem Prädikat und Subjekt getauscht werden [1|3]. In diesen Sätzen ist der Täter nicht länger fokustragendes Subjekt, bleibt aber im Fokus des Verbs. Diese Satzform ist kanonisch für die Erfragung des Täters [4]. In Satz [5] wirkt der Artikel si als Bestimmtheitsmarkierer. Ist der Täter ein Pronomen, so kann er durch Bildung eines Subjektinterklits innerhalb des Prädikats "versteckt" werden [6].
|
(3) Der Täter tritt in den Hintergrund, wenn er weder fokustragendes Subjekt ist noch im Fokus des Verbs steht. In der Regel wird der Täter zum Objunkt [7]; diesem Satzbau wird in der filipinischen Sprache der Vorzug gegeben. Seltener ist der Täter ein Adjunkt [8]. Der Täter kann weggelassen werden [9b 10]; davon wird bei allgemeingültigen Aussagen Gebrauch gemacht [10]. Auch kann der Täter als nicht vorhanden betrachtet werden [11]. Regelmäßig ist eine Wiederholung des Täters überflüssig, wenn er nicht Subjekt des Satzes bzw. Teilsatzes ist [12].
| ||||||||||||||||||
(1) Alle Flexionsformen der Verben werden mit Hilfe von Affixen von einem Wortstamm abgeleitet, der niemals ein Verb ist. Daher ist auch nicht möglich zu sagen, dass Passivverben von Aktivverben abgeleitet sind oder umgekehrt.
Nur zwei Suffixe, -an und -in, werden verwendet. Die große Anzahl Präfixe kann allein stehen oder mit anderen Präfixen kombiniert stehen. Dadurch entsteht eine große Diversität an morphologischen Verbgruppen.
Allgemein kann über die Affixe gesagt werden:
(2) Einige Gruppen von Verben, die nur ein Affix besitzen und häufig gebildet werden, bezeichnen wir als einfache Verben (pandiwang payạk), ohne dass sie deutlich eine besondere Syntax besitzen [1] . Sie sind auch bezüglich der Modalität als einfach zu bezeichnen (Zustand und Tätigkeit). Daneben verwenden wir den Begriff einer einfachen Tätigkeit (kilos na katamtaman). Darunter verstehen wir Verben, die eine Tätigkeit mit keinem oder nur einem Argument beschreiben (Beispiele sind umulạn und matulog).
(3) Die folgende Tabelle stellt die Vielfalt von mehr als 60 Affixkombinationen dar, obwohl sie vermutlich noch unvollständig ist. Die Anordnung erfolgt nach morphologischen Ähnlichkeiten. In den Einzeldarstellungen in Kapitel {7} wird der Zusammenhang zwischen syntaktischen, morphologischen und semantischen Verbgruppen betrachtet. Von einem Wortstamm werden bei weitem nicht alle möglichen Ableitungen gebildet, es handelt sich um einen Derivationsprozess (und kein Paradigma).
| Aktiv | || | Passiv | ||||||
| [1] | ma- {7-1.1} |
mang- {7-1.2} |
-um- {7-1.3} |
mag- {7-1.4} |
-in {7-2.2} |
-an {7-2.3} |
i- {7-2.4} | |
| [2] | makapang- {7-3.4} |
maka- {7-3.4} |
makapạg- {7-3.4} |
ma- {7-3.1} |
ma--an {7-3.2} |
mai- {7-3.3} | ||
| [3] | maka- {7-3.5.2} |
ma- mapa- {7-3.5.1} |
ma--an {7-3.5.1} | |||||
| [4] | magpa- {7-4.1} |
pa--in {7-4.1} |
pa--an {7-4.1} |
ipa- {7-4.1} | ||||
| [5] | makapạgpa- {7-4.2} |
mapa- {7-4.2} |
mapa--an {7-4.2} |
maipa- {7-4.2} | ||||
| [6] | pag--in {7-5.1} |
pag--an {7-5.2} |
ipag- {7-5.3} | |||||
| [7] | mapạg- {7-5.4} |
mapạg--an {7-5.4} |
maipag- {7-5.4} | |||||
| [8] | mapag- {7-5.5} |
mapag--an {7-5.5} | ||||||
| [9] | pang--in {7-6.3} |
pang--an {7-6.2} |
ipang- {7-6.1} | |||||
| [10] | mapang--an {7-6.2} |
maipang- {7-6.1} | ||||||
| [11] | magsa- {7-7.1} | isa- {7-7.1} | ||||||
| [12] | magka- {7-8.1} |
ka--an {7-7.2} |
ika- {7-7.2} | |||||
| [13] | ikang- {7-7.2} | |||||||
| [14] | magsipang- {7-8.5} |
magsi- {7-8.5} |
magsipag- {7-8.5} |
|||||
| [15] | ma--an {7-3.6} |
mag--an {7-8.2} |
magka- {7-8.1 (2)} |
magkang-&- {7-8.1 (4)} |
|| || | ipagpa- {7-5.2} | ||
| mag-um- {7-8.3} |
magpaka- {7-8.4} |
|| || | ||||||
| [16] | maki- {7-9.1} |
makipạg- {7-9.1} |
makipạg--an {7-9.1} | || || || |
[paki-] [paki--in] {7-9.2} |
[paki--an] {7-9.2} |
[ipaki-] {7-9.2} | |
| [17] | || | maka- | maka--an | ma--in | ||||
| Die Affixe [17] sind i.A. keine Verbaffixe bzw. -affixkombinationen (Beispiele makausap |ma+kausap|, mabutihin |mabuti+in|). | ||||||||
(1) Die Affigierung bestimmt, wie das Verb phonologisch gebildet wird. Die Argumentstruktur bestimmt, von welchen Phrasen das Verb im Satz umgeben ist. Beides sind also deutlich erkennbare Strukturen in der Sprache. Nun stehen einer Vielzahl von Affigierungsmöglichkeiten eine sehr beschränkte Anzahl Wahlmöglichkeiten für die Argumentstruktur gegenüber. Ein Teil der Affixkombinationen wird ausschließlich (oder überwiegend) verwendet, um die Modalität der Verben auszudrücken. Ihre Verwendung ist daher weitgehend festgelegt und soll jetzt nicht betrachtet werden. Es verbleiben also Affigierungsmöglichkeiten, die keine oder "normale" Modalität bezeichnen. Dies sind im wesentlichen die Verben, die wir als einfache Verben bezeichnen.
Bei den einfachen Verben macht die Sprache von einer großen Anzahl Kombinationen von Argumentstruktur und Affix Gebrauch, wie die folgende Übersicht zeigt.
| D..00 P-T ang | D..10 P-T P-W ang ng |
D..01 P-T P-K ang sa |
D..11 P-T P-W P-K ang ng sa |
D..20 P-T P-W P-W ang ng ng | |
| [1] | mabuhay | manoọd | mabahala | ||
| [2] | mamulạ | mamahala | manggaling | mamigạy | |
| [3] | tumayọ | bumilị | pumuntạ | bumaling | |
| [4] | magkita | magbilị | magpuntạ | magbigạy | |
| [5] | anayin | gawịn | sabihin | ||
| [6] | kilabutan | bayaran | bigyạn | ||
| [7] | itulọy | ilabạs | ibigạy | ibilị | |
(2) Ein Vollverb ist von Argumenten umgeben, dem Subjekt, Objunkten und Adjunkten; diese sind durch ihre Bestimmungswörter deutlich markiert. Die Affixe der Verben haben in erster Linie zwei Funktionen. Die wichtigste ist, das Verb als solches zu kennzeichnen. Die zweite wichtige Funktion ist anzuzeigen, ob es sich um ein Aktivverb oder ein Passivverb handelt. Dies ist für das semantische Verständnis wesentlich, um die Argumente richtig zu deuten.
Wenn man von den Zustandsverben absieht, ist bei einfachen Aktivverben der Täter im Fokus, bildet also das Subjekt. Deshalb ist es nahezu unwichtig, welches Aktivaffix verwendet wird, da die Bestimmungswörter der Argumente den Satz bereits ausreichend verständlich machen [1-4]. Die Wahl des Affixes kann also weitgehend zum Ausdruck lexikalischer Feinheiten innerhalb einer Wortfamilie dienen.
Bei den einfachen Passivverben ist die Situation bereits anders. Das Verb muss nicht nur das Passiv anzeigen, sondern auch entscheiden, ob es sich um einen Tatobjekt- oder K-Fokus handelt [5-7] (der Argumentstruktur ist dies oft nicht zu entnehmen). Dazu ist die richtige Wahl des Affixes zum grundsätzlichen Verständnis des Satzes wichtig, sodass der lexikalische Spielraum viel geringer ist.
(3) Diese etwas formale Darlegung möchten wir durch eine Betrachtung ergänzen, die den semantischen Inhalt in den Mittelpunkt setzt. In den Abschnitten {6-3..} haben wir Fokus und Funktion eingeführt zur Beschreibung des Zusammenhanges zwischen Semantik und syntaktischer Struktur. In dieser Darstellung des Fokus spielt die morphologische Realisierung keine Rolle.
Wir gehen von der Semantik aus, dem Wunsch, eine Tätigkeit (oder Ähnliches) auszudrücken. Dazu wird ein Wortstamm gewählt und dieser legt bereits fest, welche Beteiligte als Argumente der Tätigkeit regelmäßig zugeordnet werden sollen. In der entsprechenden Wortfamilie werden Verben gebildet, die jeweils einen der wesentlich Beteiligten in den Fokus setzen können. Dies sei an einem Beispiel erläutert: Dem Wort 'Ei' wird eine Tätigkeit 'Eier legen' zugeordnet, aber kein 'Eier legen für jemandem'. Dem Wort 'geben' wird jedoch eine Tätigkeit 'jemandem etwas geben' zugeordnet, da es wesentlich ist, den Akt des Gebens mit dem Empfänger in Verbindung zu bringen.
Um die Festlegung und Ordnung der Argumente zu regeln, bedient sich die filipinische Sprache der Affixe für Verben. In gewissem Maße steht es dem Sprecher frei, sich für einen bestimmten Fokus (und für eine bestimmte Argumentstruktur) aus dem "Korb" der Affixe eines auszusuchen, das in dieser Wortfamilie das passendste ist. Es ist naheliegend, dass man für vergleichbare Wortfamilien eine ähnliche Wahl trifft, aber das ist nicht zwingend. In dieser Betrachtungsweise haben Affixe keine vollständig feste Bedeutung, sie können in verschiedenen Wortfamilien in gewissen Grenzen unterschiedlich verwendet werden. Diese Grenzen werden im Allgemeinen durch die Verständlichkeit des Ausdruckes bestimmt.
(4) Dazu einige Beispiele: Da bei dem Stamm
puntạ keine Verwechselung möglich ist,
können pumuntạ und magpuntạ verwendet werden.
Ebenso schafft buksạn kein
Problem, da der Stamm bukạs keinen semantisch wesentlichen lokalen
Fokus besitzt. Damit ist allerdings nicht erklärt, warum die Sprache
buksin nicht bildet. Und in der Wortfamilie
tawag (ebenso ohne wesentlichen
lokalen Fokus) besteht eine Konvention, tawagin zu verwenden, wenn der
Gerufene in Sichtweite ist und tawagan außerhalb (früher zur
Götteranrufung, heute am Telefon).
Wenn man ein vom Allgemeinen abweichendes Gebilde wählen will, so macht man in dem "Korb" eine sorgfältigere Wahl, die dem besonderen Gebilde entspricht. So ist es nicht verwunderlich, dass der seltene Werkzeugfokus (nahezu) stets mit den Affixen ipang- oder i- gebildet wird. Aber auch hier gibt es einige ipang- Verben, die keinen Werkzeugfokus besitzen {7-6.1}, ebenso wie die meisten i- Verben.
Diese Korbhypothese wird quantitativ unterstützt, wenn man betrachtet, wieviel unterschiedliche Affixe oder Affixkombinationen zur Darstellung eines bestimmten Fokus verwendet werden können. Nach den Daten der Abschnitte {6-3..} sind dies 23 für Tatobjektfokus, 10 für Empfängerfokus und nur 7 für Werkzeugfokus.
Die Bildung der Verbformen erfolgt in zwei Schritten. In einer Derivation werden vom Wortstamm durch Affigierung Verben gebildet. In einem zweiten Schritt werden die Zeitformen der Verben durch eine veränderte Affigierung gebildet.
| Wortstamm | ||||||||||||
| ↓ ↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ | |||||||||||
D | Aktivverben | Passivverben | ||||||||||
| mang- Verben | -in Verben | |||||||||||
| magpa- Verben | pag--an Verben | |||||||||||
| … Verben | … Verben | |||||||||||
| ↓ ↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ | |||||||||||
F | Flexion | Flexion | ||||||||||
| Präteritum | Präteritum | |||||||||||
| Präsens | Präsens | |||||||||||
| Futur | Futur | |||||||||||
| Infinitiv | Infinitiv | |||||||||||
| Gerundium | ||||||||||||
(1) Bei der D-Affigierung können nur die Affixe ma-, mang-, mag-, -um-, i-, -an und -in allein Verben bilden. Da wir die Verben in Aktiv- und Passivverben einteilen, können wir diese Affixe den Genera zuordnen. In Affixkombinationen können zwei verschiedene dieser Affixe zu stehen kommen, daher haben wir genauer einzuteilen:
(2) Bei der F-Affigierung werden folgende Wege gegangen.
(3) Ein Verb besitzt kein oder nur eines der Präfixe ma-, mang- oder mag-. Dieses Affix steht – auch in Affixkombinationen – am Anfang des Verbs und ist flexionsfähig. Soll ein weiteres dieser Affixe in der Kombination verwendet werden, so ist ein Allomorph pa-, pang- oder pag- zu wählen. Die Allomorphe pang- und pag- sind keine dominanten Aktivaffixe und können daher auch für Passivverben verwendet werden.
Für Affixkombinationen mit i- gilt nach den obigen Regeln: Enthält die Kombination ma- (mang- und mag- kommen in diesen Kombinationen nicht vor), so wird mai- am Wortanfang gebildet, das als ma- Präfix flexionsfähig ist. In allen anderen Fällen steht i- aufgrund seiner Dominanz vor anderen Affixen und bestimmt damit die Flexion.
Nur -um- oder eines der Affixe ma-, mang- und mag- können Aktivverben bilden.
(4) Die filipinische Sprache erlaubt, Verbformen durch Weglassen aller D- und F-Affixe zu vereinfachen. Dabei wird auf die Anzeige von Merkmalen verzichtet, wenn diese aus dem Sinnzusammenhang erkenntlich sind (Beispiel Argumentstruktur) oder diese nicht wichtig zum Verständnis sind (Beispiel Tempus). Als verkürzte Verbform verbleibt der Wortstamm {6-6.3}. Die Verständlichkeit der verkürzten Form muss gewahrt bleiben; diese Verkürzung ist nicht möglich, wenn der Wortstamm mit abweichender Bedeutung als Stammwort verwendet wird.
(5) Hinzu kommt, dass die Sprache bei der Verbformenbildung Silbendoppelung verwendet:
(6) Eine Besonderheit verdient Beachtung. Bei der Bildung der magpa- Verben ist mag- Allomorph für ma-, mang- und -um- {7-1.4 (6) Θ}.
(7) Für das Präfix pang- besteht eine deutlich sichtbare Homomorphie. Das mang- Allomorph pang- und das Affix pang- mit instrumentaler Bedeutung sind Homomorphe. Die pang- Verben sind zwei getrennte Gruppen, die eine (ausschließlich ipang- Verben) hat instrumentalen Fokus, die andere (alle pang--an, pang--in Verben, makapang- Aktivverben und wenige ipang- Verben) hat Bezug zu mang- Aktivverben in der Wortfamilie.
Zu erwähnen ist die beschränkte Allomorphie von F-Infix -in- nach dem F-Präfix na- {6-6.1.1 4.}.
Syntaktisch und semantisch sind Gerundien Substantive. Morphologisch sind die Teil des Flexionsparadigmas der Aktivverben. Entsprechend deren Affigierung werden die Gerundien von den verschiedenen Aktivverben der Wortfamilie abgeleitet [1a|b 2a|b 3a|b].
|
Wortstamm → Aktivverb → Gerudium ist die Reihenfolge der Ableitung. Nach der D-Ableitung wird vom Aktivverb als Teil des Flexionsparadigmas die F-Ableitung Gerundium gebildet.
Einige mag- und mag--an Verben zeigen Besonderheiten bei der Betonung. Anders als beim Wortstamm, erhält die letzte Silbe dieser Verben die Betonung {7-1.4 *} und {7-8.2 *}. Die Betonung der D-Ableitung und des Gerundiums sind gleich und weicht vom Wortstamm ab (Beispiel: basa, magbasạ → pagbabasạ, aber bumasa → pagbasa).
(1) Die Präfixe pa-, pang- und pag- werden bei der Bildung der Gerundien (F-Ableitung) verwendet. Daneben bilden diese Affixe zusammen mit anderen Affixen Verben (D-Ableitung). Diese sind Aktivverben (Beispiele: magpa-, makapang-, makipag-) oder Passivverben (Beispiele: pa--in, pang--an at ipag-). Ein weiteres Aktiv- oder Passivaffix wird zum Bau des Verbs benötigt. Die Affixe pa-, pang- at pag- sind "neutral", wenn sie als D-Affix verwendet werden. Andererseits sind sie "aktivisch" als F-Affix eines Gerundiums.
(2) Dem D-Affix pa- wird die Modalität der Veranlassung zugewiesen (magpa-, pa--in, pa--an und ipa-). Ein Zusammenhang mit ma- Verben und deren pa- Gerundien besteht offenbar nicht. Wir betrachten daher das F-Allomoph pa- zur Bildung der Gerundien der ma- Verben und das D-Affix pa- für die Modalität der Veranlassung als Homomorphe. Den wenigen pa- Gerundien stehen viel mehr pa- Verben der Veranlassung in völlig anderen Wortfamilien gegenüber (Beispiel paliligo ↔ magpadalạ).
(3) Die Funktion die D-Affixe pang- und pag- ist wenig deutlich (mit Ausnahme der besonderen Funktion von pang- für instrumentalen Fokus). pang- und pag- treten in Kombination mit anderen D-Affixen auf, ohne dass sie eine Aktiv/Passiv-Zuordnung vornehmen, sondern dies einem anderen D-Affix überlassen. pang- und pag- sind also nur ergänzende Affixe. Die D-Affixe pang- und pag- (mit der Ausnahme von instrumentalem pang-) besitzen keine einheitliche semantische Bedeutung, und das Zufügen von pang- oder pag- ändert das Verb irgendwie, aber nicht in eine für das Affix spezifische Richtung.
(4) Mit den F-Affixen pang- und pag- werden Gerundien gebildet. Hier erhebt sich die Frage, ob sie gleich den D-Affixen pang- und pag- sind. Beide Gruppen sind Allomorphe der D-Affixe mang- und mag- in grundsätzlich verschiedene Richtungen. Wir folgern daraus, dass die Affixe pang- und pag- als F-Affixe der Gerundien und als D-Affixe Homomorphe geworden sind, obwohl sie gleiche Wurzeln besitzen.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_02.html
Unter Modalität der Verben (pagkakabago ng pandiwa) verstehen wir die Bedeutungswandlung von Verben, die durch Affigierung verursacht wird. Mit Hilfe der Modalität werden neue Verben gebildet, die ihre eigenen Flexionsparadigmen besitzen. Die wichtigsten Modalitäten der filipinischen Sprache sind:
| Aktiv | Passiv | |
| Tätigkeit | mang- mag- -um- | -an -in i- ipag- ipagpa- ipang- pang--an |
| Zustand, selbstablaufender Prozess | ||
| ma- mang- -um- ma--an | ||
| Fähigkeit {7A-301} | ||
| maka- makapạg- makapang- | ma- ma--an mai- mapạg- mapạg--an maipag- maipang- | |
| Zufall, fehlende Absicht | ||
| maka- | ma- mapa- ma--an mapag- mapag--an | |
| Aufforderung, Bitte maki- | [paki- paki--an paki--in ipaki-] | |
| Veranlassung, Auftrag, Erlaubnis | ||
| magpa- | pa--an pa--in ipa- pag--in | |
| Fähigkeit zur Veranlassung | ||
| makapạgpa- | mapa- mapa--an maipa- | |
| Teilnahme | maki- makipạg- makipạg--an mag--an | |
| Richtung | magsa- | isa- |
| Ursache | . | ika- ka--an |
| Hervorhebung | magkang- | . |
| Anstrengung | mag-um- magpaka- | . |
| Besitz | magka- | . |
(1) Die filipinischen Verben besitzen eine ausgeprägte Flexion (banghạy). Aktiv- und Passivverben füllen jeweils ein vollständiges Paradigma von vier Formen aus. Drei davon bezeichnen wir als Zeitformen Präteritum (Schlüssel {../N}, pangnagdaạn), Präsens (Schlüssel {../K}, kasalukuyan) und Futur (Schlüssel {../H}, panghinaharạp). An dieser Stelle lassen wir die Frage offen, ob dieses Paradigma Tempora oder Aspekte beschreibt {6-6.2.5 Θ}. Eine vierte Form wird traditionell als Infinitiv bezeichnet (Schlüssel {../W}, pawatạs). Der Infinitiv kann als vierte Zeitform des "Irgendwann, jederzeit" betrachtet werden und gehört somit in das Paradigma der Flexion.
(2) Eine eigenständige morphologische Form des Imperativs besitzt die filipinische Sprache nicht. In Imperativsätzen wird der Infinitiv verwendet. Weiterhin besitzt die filipinische Sprache keine morphologischen Formen, die die Funktion eines Konjunktivs o.ä. ausüben. Hypothetische Tatbestände werden mit Hilfe von Adverbien dargestellt (sakali, sana). Auch können Futurformen (kontemplativer Aspekt) dienen, um hypothetische Tatbestände darzustellen. Daher gibt es wenig Sinn, die Begriffe Modus (panagano), Indikativ (paturọl) und Konjunktiv (pasakali) einzuführen.
(3) Bei Aktivverben ist das Flexionsparadigma um verbale Substantive, die Gerundien, zu ergänzen. Wenn sie auch keine Zeitformen sind, sind sie doch Teile dieses Paradigmas {6-4.2.2 Θ}. Eine weitere Form, das Katatapos, kann in einer Wortfamilie nur einmal gebildet werden, gehört also nicht dem Flexionsparadigma an. Damit kommen wir zu folgender Übersicht der Flexionsformen der filipinischen Verben:
| Flexions- paradigma | Zeitformen [Partizipien] | Infinitiv |
| Präteritum | ||
| Präsens | ||
| Futur | ||
| Gerundium | ||
| Katatapos | ||
(4) Die filipinischen Verben besitzen keine Genus- und Numerusflexion. Zeitformen und Infinitiv zeigen bei der Flexion gleiches Verhalten. Daher sind die Begriffe 'finit' und 'infinit' nicht geeignet.
Die Tempusflexion wird durch Affixe und Silbendoppelung realisiert, dabei gelten die gleichen Regeln für Aktiv- und Passivverben.
Wird ein Verb von einem bereits affigierten Wort abgeleitet, so gelten die Affixe der ersten Ableitung nicht als Verbaffixe (Beispiel: Bei magmakaawa |mag-makaawa| ist ma- kein Verbaffix, sondern wird als doppelungsfähiges Stammaffix betrachtet; die Futurform ist magmamakaawa).
Tabelle der Flexionsformen → {6A-611}
Bezüglich der Affixe lauten die Regeln wie folgt:
Diese Regeln besitzen eine abnehmende Priorität und schließen sich in Affixkombinationen gegenseitig aus, so dass nur eine Regel mit höherer Priorität zur Anwendung kommt.
Für die Silbendoppelung gelten folgende Regeln, wiederum mit abnehmender Priorität:
Für die Betonung gelten folgende Regeln:
Die Zeitformen werden zur Darstellung von Tempus und Aspekt verwendet. Um dies näher zu betrachten, haben wir ein Romankapitel und eine Kurzgeschichte untersucht {6A-621}. Die Ergebnisse werden in den nächsten Abschnitten verwendet. Eine Zusammenfassung zu Tempus und Aspekt findet sich in Abschnitt {6-6.2.5 Θ}.
Wir bezeichnen die Flexionsformen als Zeitformen, ohne entscheiden zu wollen, ob Verwendung als Tempus oder Aspekt vorliegt.
Die Formen des Präteritum beschreiben Vorgänge, die in der Vergangenheit abgeschlossen sind [1] (Tempus Vergangenheit und perfektiver Aspekt). Ebenfalls wird das Präteritum verwendet, wenn Vorgänge in der Vergangenheit betrachtet werden, die nicht abgeschlossen sind [2-4] (Tempus Vergangenheit und imperfektiver Aspekt). Dies ist besonders dann der Fall, wenn ein temporales Adverb zusätzlich die Vergangenheit anzeigt [3 4b]. In Satz [5] wird eine Tätigkeit beschrieben, die sich in der Vergangenheit oft wiederholt hat; hier liegt die Betonung darauf, dass die Tätigkeit nicht mehr stattfindet (iterativer Aspekt in der Vergangenheit).
| |||||||||||||||||||||||||||||
Die Formen des Präsens werden verwendet, wenn ein Vorgang jetzt stattfindet und noch nicht abgeschlossen ist [1]. Für Vorgänge, die in der Vergangenheit regelmäßig wiederholt wurden und in der Zukunft wiederholt werden sollen, werden ebenfalls die Präsensformen verwendet [2]. Ähnliches gilt, wenn die wiederholten Tätigkeiten nicht mehr stattfinden [3 4] Weiterhin können die Präsensformen verwendet werden, wenn Tätigkeiten im Rahmen einer Geschichte in der Vergangenheit liegen, aber damals noch nicht abgeschlossen sind [5 6]. In den Sätzen [7 8] zeigt die Form natutulog das Tempus Gegenwart an, während die Adverbien na und pa zusätzlich Aspekt realisieren.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Formen des Futur werden verwendet, wenn Vorgänge noch nicht stattgefunden haben [1 2] (Tempus Zukunft und kontemplativer Aspekt). Satz [3] besitzt ein "relatives" Tempus Zukunft in der Vergangenheit. In [4-6] wird die Futurform verwendet, um eine irreale bzw. beschränkt reale Aussage zu machen. Es ist möglich, eine Futurform statt des Infinitivs zu verwenden [2].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Der Infinitiv wird verwendet, wenn der genaue Ablauf bezüglich Tempus oder Aspekt nicht wichtig ist. Er beschreibt dann eine allgemeine Zeit des "Irgendwann, jederzeit" [1-3].
| |||||||||||||||||||||
(2) Weitgehend ist die Verwendung des Infinitivs durch grammatische Regeln vorgegeben {*}; nur in wenigen Fällen hat der Sprecher semantisch eine Wahl.
{*} Damit unterscheidet sich der Infinitiv syntaktisch von den drei anderen Zeitformen. Morphologisch besteht kein prinzipieller Unterschied, da auch die anderen Zeitformen keine Person-Numerus-Flexion besitzen.
(3) Eine besondere Verwendung des Infinivs besteht, wenn eine Kombination von Adjektiv und Verb eine Fähigkeit, Gewohnheit oder Eigenschaft ausdrückt [9 13a]. Es wird keine tatsächliche Tätigkeit beschrieben. Häufig besitzen diese Gebilde keine Ligatur. Ohne dieses Adjektiv wird der Satz sinnleer [13a|b|c].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Als Zusammenfassung der vorigen Abschnitte möchten wir abschließend betrachten, ob
und wann die Zeitformen der Verben zur Beschreibung von Tempus oder Aspekt verwendet
werden {6A-6251 ![]() }. Wir verwenden die folgenden Begriffe:
}. Wir verwenden die folgenden Begriffe:
| Zeit {*} | Nakaraan - Kasalukuyan - Kinabukasan, panghinaharap Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft |
| Zeitformen | Anyong pangnagdaan - Anyong kasalukuyan -
Anyong panghinaharap - Pawatas Präteritum - Präsens - Futur - Infinitiv |
| Tempus | Pangnagdaan - Kasalukuyan - Panghinaharap -
Kahit kailan, palagi Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft - Irgendwann/Jederzeit |
| Aspekt | Pangganap - Di-pangganap - Pang-ulit
{**} - Mapagdili-dili Perfektiv - Imperfektiv - Iterativ {**} - Kontemplativ |
{*} Im bürgerlichen Leben.
{**} Iterativer Aspekt wird i. Allg. als Sonderform des Imperfektivs betrachtet.
(2) Aus den Tabellen der vorigen Abschnitte sind folgende Beziehungen ersichtlich.
(3) Trotz des prinzipiellen Unterschiedes der Betrachtungsweisen von Tempus und Aspekt ist festzustellen, dass in der übergroßen Zahl der Fälle kein Unterschied zwischen beiden besteht. Das ist dann der Fall, wenn Tätigkeiten in der Vergangenheit abgeschlossen wurden, wenn Tätigkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch andauern und wenn Tätigkeiten bis jetzt noch nicht begonnen wurden [1-3]. Nur dann besteht ein Unterschied, wenn ausgedrückt werden soll, dass ein Vorgang zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit noch nicht abgeschlossen oder noch nicht begonnen war [4 5]. Hinzu kommen die (wenig wahrscheinlichen) Fälle, dass genau im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Tätigkeit abgeschlossen oder begonnen wird [6 7]. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass für eine noch nicht begonnene Tätigkeit deren Andauern oder Abschluss dargestellt werden soll [8 9]. Häufiger kommen die Fälle [4 5 8 9] in zusammengesetzten Sätzen vor, bei denen der eine Teilsatz den Betrachtungszeitpunkt festlegt, und der andere eine Tätigkeit mit dazu relativem Aspekt darstellt.
| Zeitpunkt bzw.Tempus | Aspekt | ||
| Kein Unterschied zwischen Tempus und Aspekt | |||
| [1] | Vergangenheit | Perfektiv | |
| [2] | Gegenwart | Imperfektiv | |
| [3] | Zukunft | Kontemplativ | |
| Unterschied zwischen Tempus und Aspekt | |||
| [4] | Vergangenheit | Imperfektiv | |
| [5] | Vergangenheit | Kontemplativ | |
| [6] | Gegenwart | Perfektiv (Abschluss) | |
| [7] | Gegenwart | Kontemplativ (Beginn) | |
| [8] | Zukunft | Imperfektiv | |
| [9] | Zukunft | Perfektiv | |
(4) Diesen neun Tempus-Aspekt-Beziehungen stehen nur vier
Zeitformen gegenüber, den Infinitiv eingerechnet. Zusätzlich müssen sich wiederholende und
gewohnheitsmäßige Tätigkeiten (iterativer oder habituativer Aspekt) beschrieben werden. Wie
die Beispiele in den vorigen Abschnitten zeigen, sind Mehrfachverwendungen unvermeidbar.
Adverbien werden zu Hilfe genommen, um diese Ausdrücke getrennt vornehmen zu können.
Temporale Adverbien können das Tempusgewicht verstärken und den Aspekt zurücktreten lassen,
während die Adverbien na und
pa Aspektfestlegungen ermöglichen (wir bezeichnen sie
daher als aspektale Adverbien, vgl. na als 'perfective aspectual
particle' bei {![]() Kroeger 1991 p. 238}). Ein temporales Adverb
kann die Verwendung der dem Tempus entsprechenden Form erzwingen. Nur in zusammengesetzten
Sätzen mit mehreren Verben bestehen zusätzliche Möglichkeiten, Tempus und Aspekt getrennt
darzustellen.
Kroeger 1991 p. 238}). Ein temporales Adverb
kann die Verwendung der dem Tempus entsprechenden Form erzwingen. Nur in zusammengesetzten
Sätzen mit mehreren Verben bestehen zusätzliche Möglichkeiten, Tempus und Aspekt getrennt
darzustellen.
Eine zusätzliche Form in der filipinischen Sprache ist das Katatapos, das eine besondere perfektive Vergangenheit des "gerade eben Geschehenen" bezeichnet (und mit dem aspektalen Adverb na inkompatibel ist) {6-6.6}.
(5) In verblosen Sätzen ist eine Tempus- oder Aspektanzeige beim Verb ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn der flexionslose Wortstamm des Verbs statt einer Zeitform verwendet wird. Hinzu kommt, dass syntaktische Gründe die Verwendung des Infinitivs erfordern können, so dass auch hier eine Tempus- oder Aspektanzeige nicht vorgenommen werden kann.
(6) Die Darstellung von Tempus und Aspekt ist nicht auf Verben beschränkt (vgl. die aspektalen Adverbien na und pa {9-4.1.1}). Für Verben ziehen wir für die morphologischen Formen die Bezeichnungen der Zeitformen vor. Dabei ist jedoch im Auge zu behalten, dass sie vom Tempus abweichende Aspekte darstellen können.
An Stelle der Zeitformen kann der Wortstamm ohne Affixe verwendet werden (Schlüssel {DT//X}, wenn ein Aktivverb ersetzt wird und {DB//X} für ein Passivverb {6A-631 Θ}). In der Schriftsprache ist der Gebrauch des Wortstammes statt einer Zeitform weitgehend auf -in Passivverben beschränkt [1 2]. In der Umgangssprache wird diese Verkürzung zum Wortstamm häufig vorgenommen, insbesondere in Imperativsätzen mit tayo [3]. mag- Verben werden in der Regel nicht verkürzt (Ausnahme [4]). Wortstämme können auch als Partizipien verwendet werden [5].
|
Siehe auch {6-4.2.1 Θ (4)}.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_03.html
(1) Unter Partizipien verstehen wir Zeitformen der Verben, die ihre globale Wirkung im Satz abgelegt haben, also keine Vollverben sind {*} {2A-431 (2)}. Partizipien besitzen also keine Argumente. Damit können Partizipien im Satz untergeordnete Stellungen einnehmen und als Adjektiv, Adverb oder Substantiv verwendet werden {**}. Da Partizipien keine globale Wirkung besitzen, entfällt im Schlüsselsystem die Angabe der Argumentstruktur.
Somit besteht kein morphologischer Unterschied zwischen Zeitformen für Vollverben und Partizipien. Filipinische Partizipien bilden also keine morphologische Klasse, sondern üben besondere syntaktische Funktionen aus.
{*} Die Verbeigenschaften 'genus verbi', Modalität und Tempus sind im Partizip unverändert enthalten.
{**} {Θ} Genau betrachtet, bleiben Partizipien Verben. Da in der filipinischen Sprache nahezu jede Inhaltsphrase zu jeder Funktionsphrase "passt", sind Partizipien Verben in Funktionsphrasen, deren Inhaltsphrase üblicherweise mit einem Adjektiv, Adverb oder Substantiv gebildet wird.
(2) Alle Zeitformen der Verben können als Partizipien dienen. Dies wird dadurch erleichtert, dass es keine Person- und Numerusflexion gibt. Somit hat jedes Aktiv- oder Passivverb drei Partizipien: des Präteritum, des Präsens und des Futur (die Verwendung des Infinitivs als Partizip ist nur sehr beschränkt möglich).
Ähnlich einem Adjektiv, können Partizipien als Attribute von Substantiven verwendet werden [1-3] (Schlüssel {U//D}, pandiwaring makauri). Sie erhalten eine Ligatur und sind deshalb Subjunkte. Attributiv gebraucht, stellt das Partizip einen Prozess oder einen Zustand dar, jedoch nicht eine Person (oder einen Gegenstand), die an dem Prozess oder Zustand beteiligt ist.
|
(2) In [4 5] können die Gebilde als Verbphrasen, die ein Substantiv ergänzen, angesehen werden. Das Partizip ist das Kernwort der Phrase, es ist kein Vollverb. In der Regel werden jedoch diese Gebilde als Ligatursätze betrachtet {13A-451 Θ}.
|
Partizipien werden als Adverb nur selten verwendet (Schlüssel {A//D}, pandiwaring makaabay) [1]. Die morphologische Gleichheit mit den Zeitformen der Vollverben schafft Undeutlichkeiten [1]. Um diese zu vermeiden, werden verkürzte Nebensätze gebildet [2 3]. Eine Ausnahme ist der idiomatische Gebrauch von umanọ [4].
|
(1) Partizipien können als Substantiv verwendet werden (Schlüssel {N//D}, pandiwaring makangalan). Um eine Verwechselung mit einem Vollverb zu vermeiden, werden Gebilde vorgezogen, die wie "gemeine" Substantive gebaut sind; insbesondere, wenn das Partizip Subjekt oder Prädikat bildet:
(2) Ein Partizip als Substantiv kann als Subjekt [1 2], Objunkt [3], Adjunkt [4] und in einer Präpositionalphrase [5] verwendet werden. Eine Verwendung als Prädikat ist nur dann möglich, wenn keine Verwechselungsgefahr mit einem Vollverb besteht. Substantivisch verwendete Partizipien bilden keine Subjunkte (stets adjektivische Verwendung {6-6.4.1}) und Disjunkte (Verwechselungsgefahr wie bei Prädikat). In der Regel wird eine Zeitform des Partizips verwendet, der Infinitiv ist selten.
| ||||||||||||||
(3) Das als Substantiv verwendete Partizip kann durch Objunkte [1 3], Adjunkte [2] und Subjunkte [5] ergänzt werden. Diese sind Attribute und keine Argumente, da das Partizip die globale Wirkung eines Verbs abgelegt hat. Substantivische Partizipien können die Pluralanzeige mga besitzen [1 4 5].
(4) Semantisch bezeichnen diese Partizipien nicht länger eine Tätigkeit, einen Prozess oder Zustand. Vielmehr ist dies oft bei von Aktivverben abgeleiteten Partizipien die ausführende Person [4], bei Passivverben (insbesondere Präteritumformen) der Gegenstand, der duch den Prozess entstanden ist [1-3 5]. So werden einige Partizipien nicht länger als solche, sondern als Substantive angesehen (Beipiele: tinapay, sinigạng, nilikhạ).
Als Substantiv gebrauchte Partizipien in Existenzphrasen → {10-4.1}
(1) Morphologisch sind filipinische Gerundien (pangngaldiwa) abgeleitete Verbformen, syntaktisch und semantisch sind sie jedoch Substantive [1-3 4a]. Wir ordnen ihnen daher den Schlüssel {ND} zu. In diesem Abschnitt betrachten wir die aspektlosen Gerundien, während wir die perfektiven und iterativen Gerundien in den folgenden Abschnitten {6-6.5.1} und {6-6.5.2} behandeln. Semantisch stellen die Gerundien einen Prozess dar. Von Verben mit der Modalität Fähigkeit werden keine Gerundien gebildet.
|
(2) Morphologisch können die Gerundien
den Aktivverben zugeordnet werden. Das Präfix des Aktivverbs bestimmt, wie das Gerundium
gebildet wird. Bei Silbendoppelung bleibt die gedoppelte Silbe unbetont (im Gegensatz zu
den Zeitformen). Von Passivverben werden keine Gerundien abgeleitet. Besitzt die Wortfamilie
kein Aktivverb, so hat sie auch keine Gerundien
(pag-iwan, pag-iiwan).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Gerundien können ergänzt werden durch Objunkte und Adjunkte. Entsprechend den Argumenten des Aktivverbs, wird aus dem Subjekt ein Objunkt des Gerundiums [5a|b 6a|c], während Objunkt [6b|d] und Adjunkt [7a|b] unverändert bleiben. Besondere Gebilde sind unabhängig im Satz stehenden Gerundphrasen [8] {5-3.2}.
| ||||||||||||||||||||
(4) Eine deutliche Abgrenzung zwischen Gerundien und Substantiven mit Affixen ist kaum möglich. Einige Gerundien haben sich so weit von ihrer Herkunft als Verb entfernt, so dass sie als Substantiv einen Gegenstand darstellen (pagkain). In diesen Fällen werden die gerundiumspezifischen Affixe zu Substantivaffixen.
Die im vorigen Abschnitt dargestellten Gerundien beschreiben keinen besonderen Aspekt. Daneben besitzt die filipinische Sprache weitere Gerundien, mit denen eine abgeschlossene Tätigkeit in der Vergangenheit beschrieben wird. Wir bezeichnen sie als perfektive Gerundien (Schlüssel {ND/G}, pangngaldiwang pangganạp). Sie werden als Subjekt [1], Objunkt [2], Adjunkt [3] und häufig als disjunktive Gerundphrase [4] verwendet. Letztere kann aus nur dem Gerundium bestehen, das dann einem Adverb ähnelt [5].
| ||||||||||||||||
(2) Wie die einfachen Gerundien sind die perfektiven Gerundien den Aktivverben zugeordnet. Die perfektiven Gerundien werden mit dem Gerundaffix pag- und mit ka- gebildet, das gedoppelt werden kann.
| |||||||||||||||||||||||
(3) Nicht alle mit pagka- und pagkaka- gebildeten Wörter sind perfektive Gerundien. Mit diesen Affixen werden ebenfalls einfache Gerundien (magkaroọn → pagkakaroọn (dito)) und Substantive gebildet (pagkatao). Deutlich wird dies, wenn die Wortfamilie keine entsprechenden Verben besitzt: pagkatatlọ [6] kann kein Gerundium sein, da der Stamm tatlọ keine Verben bildet. Das perfektive Gerundium pagkatapos wird auch als Konjunktion verwendet.
|
Mit dem betonten Präfix ka- werden iterative Gerundien (Schlüssel {ND/U}, pangngaldiwang pang-ulit) gebildet {6A-6521}. Sie stellen häufig wiederholte oder gewohnheitsmäßige Tätigkeiten (iterativer Aspekt) in der Vergangenheit dar. Daher werden sie vorwiegend in Adjunktphrasen verwendet, die bezüglich des Verbs im Satz eine Ursachefunktion besitzen [1]. In seltenen Fällen werden sie in Passivsätzen verwendet, in denen sie das Subjekt mit Ursachefokus bilden [2].
| ||||||||
Wie die anderen Gerundien, können die iterativen Gerundien den Aktivverben zugeordnet werden. Das Präfix des Aktivverbs bestimmt, wie das Gerundium gebildet wird. Bei den ka- Gerundien findet Doppelung der ersten Stammsilbe oder des Präfixes ka- statt, die gedoppelte Silbe bleibt unbetont. Die iterativen Gerundien unterscheiden sich in der Betonung von den Katatapos-Formen.
| ||||||||||||||||||||||||||
Bezüglich einer möglichen Ergänzung durch Subjekt, Objunkt oder Adjunkt verhalten sich die iterativen Gerundien wie die anderen Gerundien [3 4].
|
(1) Das Katatapos ist eine Verbform mit besonderen morphologischen, syntaktischen und semantischen Eigenschaften (Schlüssel {DP}). Eine Wortfamilie bildet nur ein Katatapos, es wird vom Aktivverb mit Affix -um- abgeleitet [1-3]. Das Affix -um- entfällt, die Form wird mit Präfix ka- und betonter Doppelung der ersten Stammsilbe [1b] oder des Präfixes [1c] gebildet.
| ||||||||||||
(2) Syntaktisch ähnelt das Katatapos einem Passivverb, es bildet das Prädikat des Satzes. Das Subjekt des -um- Aktivverbs (der Täter) wird ein Objunkt, der Satz ist fokuslos (subjektlos). Im Allgemeinen wird das Katatapos von {DT00} Verben gebildet [1], bei den wenigen Bildungen mit {DT10} und {DT01} Verben bleibt das Objunkt [2] bzw. Adjunkt [3] des -um- Satzes erhalten. In Verbindung mit dem Katatapos entfällt das Adverb na; lamang, lang steht jedoch häufig [1b 1c 2b 3b 4]. Die subjektlosen Sätze mit Katatapos sind Nicht-Regelsätze.
(3) Die Bedeutung des Katatapos ist eine Tätigkeit, die gerade eben stattgefunden hat oder abgeschlossen worden ist. Das Katatapos beschreibt also eine besondere, sonst in der filipinischen Sprache nicht übliche Kombination von Tempus und Aspekt, ein perfektives Präteritum. Häufig wird das Katatapos verwendet, um eine Tätigkeit zu beschreiben, die vor dem Eintritt eines anderen Ereignisses stattgefunden hat [4].
|
{Θ} Anzumerken ist, dass das Katatapos keine Zeitform des Flexionsparadigmas ist. Es wird nur einmal in einer Wortfamilie gebildet, und es hat eine von den Zeitformen abweichende Syntax.
Unter Verbphrasen (Schlüssel {P-D}, pariralang pandiwa) verstehen wir Phrasen, die ein Verb als Kernwort besitzen. Die Verbphrase kann das Prädikat oder Subjekt des Satzes bilden [1a 1b], dann besitzt sie eine globale Wirkung im Satz, das Verb ist ein Vollverb. Unter verbundenen Verben verstehen wir zwei aufeinander bezogene Verben in einem Satz {6-7.2}. Gleich mit Verbphrasen können verkürzte Ligatursätze sein, in denen das Subjekt weggelassen ist [2] {13-4.6}.
|
Phrasen mit Partizipien sind ebenfalls Verbphrasen.
(1) Vollverben besitzen Argumente:
(2) Neben Argumenten können weitere Attribute Verben ergänzen. In der Regel sind dies Subjunkte mit einem Adverb (oder einem adverbial gebrauchten Adjektiv) [1] {9-5.2}. Auch sind Kurzwörter Attribute [2].
| |||||||
(3) Auch die Argumente Objunkt, Adjunkt und Subjunkt sind Attribute, da sie Bestandteile der Verbphrase sind {6A-201 Θ}.
(1) Ein Verb kann durch ein weiteres Verb ergänzt werden. Wir sprechen von verbundenen Verben (pandiwang nakakabịt), wenn ein Unterordnungsverhältnis zwischen den beiden Verben besteht. Das übergeordnete Verb steht nahezu stets vor dem untergeordneten Verb (Schlüssel {P-D/B}, pandiwang pang-ibabạ) [1-5]. In der Regel steht das untergeordnete Verb im Infinitiv, um die Unterordnung deutlich zu machen [1-4]. Seltener wird eine Zeitform verwendet, wenn die Unterordnung anderweitig deutlich ist [5]. Mit verbundenen Verben werden zusammengesetzte Sätze [1 2 5] {13-4.6.1} und auch einfache Sätze [3-5] {13-4.6.2} gebildet.
| |||||||||||||
(2) Zwischen verbundenen Verben steht eine Ligatur, das untergeordnete Verb bildet im einfachen Satz ein Subjunkt. Weitgehend gelten die Regeln, wann eine Ligatur entfallen kann {5-2.2 (1)}.
Zweites Verb als Subjekt → {2-4.5 (2)}
Im Strukturmodell ist die Verbphrase eine Inhaltsphrase.
| Verbphrase mit Vollverb ist | Verbphrase enthält neben Verb | ||
| [1] | Prädikat {2-4.4} | ||
| [2] | Subjekt {2-4.5} | ||
| [3] | Kein Argument | ||
| [4] | Objunkt (Argument) {6-2.1} | ||
| [5] | Adjunkt (Argument) {6-2.2} | ||
| [6] | Subjunkt (Argument) {6-2.3} | ||
| [7] | Subjunkt (Verbundene Verben) {6-7.2} | ||
| [8] | Subjunkt (Adverbphrase) {9-5.2} | ||
| [9] | Subjunkt (Potenzialadverb) {9-6.1} | ||
| Verbphrase mit Partizip ist | Verbphrase enthält | ||
| [10] | Subjekt | Verb im Infinitiv | {2-4.5 (2)} |
| [11] | Untergeordnetes Verb | Verb im Infinitiv | {6-7.2} |
| [12] | Partizip als Adjektiv | Verb (Zeitform) | {6-6.4.1} |
| [13] | Partizip als Adverb | Verb (Zeitform) | {6-6.4.2} |
| [14] | Partizip als Substantiv | Verb (Zeitform) | {6-6.4.3} |
| [15] | Partizip als Substantiv (Existenzphrase) |
Verb | {10-4.1} |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_04.html
In diesem Kapitel wird in den Verben-Syntax-Tabellen die Häufigkeit der Verben angedeutet. Gezählt werden die Vorkommen der Verbformen einschließlich Partizipien (jedoch keine Gerundien) im Werkstatt-Korpus {1-1.2 (3)}. Ein klein gedrucktes Verb zeigt an, dass das Verb dreimal oder seltener vorkommt. Genauere Angaben finden sich im Wörterbuch. Kommt ein Verb im Werkstatt-Korpus nicht vor, wird es durch eine schwarze Raute ⬧ gekennzeichnet.
(1) Unter einfachen Aktivverben verstehen wir die mit den Affixen ma-, mang-, -um- und mag- gebildeten Aktivverben.
| Affixe | D00 | DT../fy | DT00/fg | DT01 | DT10 | DT11 | |
| ma- | . | +++ | + | (+) | (+) | . | {7-1.1} |
| mang- | . | ++ | +++ | + | + | (+) | {7-1.2} |
| -um- | + | + | ++ | ++ | ++ | + | {7-1.3} |
| mag- | . | (+) | ++ | ++ | +++ | + | {7-1.4} |
Wie die Tabelle zeigt, gibt es keine eindeutige Zuordnung zwischen syntaktischen Verbgruppen und Affigierung. Es sind gewisse Schwerpunkte vorhanden, die jedoch durch die große Bandbreite innerhalb der einzelnen Gruppen nur schwer erkennbar sind {7A-101}.
(2) Eine Gruppe von {DT00} Verben sind syntaktisch eher als {DT10} Verben mit weggefallenem Objunkt zu betrachten. Sie besitzen kein Objunkt, da semantisch das Verb dieses bereits enthält. Sie können mit allen Aktivaffixen gebildet werden (Beispiele magutom, mangitlọg, umitlọg, lumindọl {D00}, magbahay).
(1) Das Präfix ma- wird nicht nur für Aktivverben verwendet, sondern auch für Passivverben und Adjektive {7A-111 Θ}. Für Verben mit dem Präfix ma- besteht ein fließender Übergang zwischen Aktiv- und Passivverben {6-3.3}; ähnliches gilt für Verben mit den Präfixen ma- und mapa- (Absatz (4)).
| DT00 | DT01 | DT00 | DT01 | DT10 | ||
| Affix | Verben | fy | fy | fg | fg | fg |
| ma- (1) | maanọ mabuhay mawalạ (naritọ {*}) | fy | . | . | . | . |
| magalit mahiyạ matakot | fy | fy|fs | . | . | . | |
| maawa | . | fy|ft | . | . | . | |
| makinịg matulog maupọ | . | . | fg | . | . | |
| manoọd | . | . | fg | . | fg|ft | |
| mabahala masanay | . | . | . | fg|ft | . | |
| mainịs makinabang | . | . | . | fg|fs | . | |
| manatili | fy | . | {DT001/fy|P-L} | |||
| magịng | . | . | fg | {DT001/fg|P-L} | ||
| {*} Wegen der Nebenbetonung auf der ersten Silbe gehören naritọ, nariyạn, naroọn eigentlich nach {7-3.5.1 [3*]}. | ||||||
(2) Der erste Schwerpunkt der ma- Verben sind Zustandsverben, die meisten davon benötigen weder Objunkt- noch Adjunktphrase [1] {DT00/fy}. Hinzu kommen einige ma- Zustandsverben mit Adjunkt {DT01/fy|fK}.
Weitere ma- Verben beschreiben einfache Tätigkeiten. In der Regel besitzen sie außer dem Subjekt keine Argumente {DT00/fg} [2], jedoch kommen auch Verben mit Adjunkt und Objunkt vor [3].
Unregelmäßig ist das Verb magịng [4], möglicherweise ist es ein verkürztes ma- Verb. Es hat ein Subjunkt ohne Ligatur als Argument {6-2.3 (3)}. Ein pronominales Subjekt [4] und enklitische Kurzwörter [5] werden nicht zwischen maging und das Subjunkt gestellt. Damit ähnelt des Verb magịng einem Präfix (magindapat {DT00}, magimbata {DT00}).
|
(3) Von Ausnahmen abgesehen, wird kein Aktivverb mit Präfix ma- gebildet, wenn vom Wortstamm ein Adjektiv mit Präfix ma- vorhanden ist {7A-112}. Dann werden für Zustände oder Prozesse mang-, -um- und seltener mag- Verben {DT00/fy} gebildet.
(4) Eine Gruppe von ma-, ma- und mapa- Verben kann wegen des fließenden Übergangs zwischen Aktiv und Passiv beiden Genera zugerechnet werden. Werden ma- Verben des Übergangsbereichs als Aktivverben verwendet, so besitzen sie keine Modalität der Fähigkeit. Demgegenüber drücken die ma- und mapa- Verben in der Regel die Modalität des Zufalls aus, auch wenn sie als Aktivverben verwendet werden.
| Übergangsbereich Aktiv - Passiv mit ma-, ma- und mapa- Verben | |
| Affix | |
| ma- | Aktiv siehe obige Tabelle. |
| Übergang und Passiv → {7-3.1 [2*]} | |
| ma-, mapa- | Passivverben → {7-3.5.1 [1*]} |
| Übergangsbereich → {7-3.5.1 [2*]} | |
| Aktivverben → {7-3.5.1 [3*]} | |
| Anmerkung: ma- und mapa- Verben und ma- Passivverben sind keine einfachen Verben. | |
(5) Zu den ma- Verben gehören von Demonstrativpronomen abgeleitete Formen wie naritọ {7A-113}.
(1) Das Präfix mang- bildet Aktivverben. Durch Lautänderung entstehen die Präfixe mam- und man- neben mang- {7A-121}. Häufig entfällt dabei der erste Konsonant des Wortstammes. Dadurch kann ein scheinbares Präfix ma- entstehen, das von dem der ma- Verben zu unterscheiden ist (Beispiel mamulạ (pulạ) [mʌ.mʊ'lʌ] |mang+pula|).
| DT | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| Affix | Verben | fy | fg | fg | fg | fg |
| mang- (1) | mangilạn-ngilạn (nanditọ) | fy | . | . | . | . |
| mangibabaw mamuhay manginịg mamatạy mamulạ | . | fg | . | . | . | |
| mamalagi |mang+palagi| manirahan |mang+tirahan| | . | . | fg|fn | . | . | |
| maniwala | . | . | fg|fp?ft | . | . | |
| mamahala | . | . | fg|fp?ft | fg|fp?ft | . | |
| mamilị | . | fg | . | fg|ft | . | |
| mamigạy manghingị | . | . | . | fg|ft | fg|ft|fp | |
| mangahulugạn | {DT001/fg|P-L} | |||||
(2) Einige mang- Verben beschreiben Zustände oder vergleichbare Prozesse [1]. Einen Schwerpunkt bilden mang- Verben, die einfache Tätigkeiten darstellen und deshalb ebenfalls keine weiteren Argumente außer dem Subjekt besitzen {DT00/fg} [2]. Hinzu kommen einige mang- Verben mit Täterfokus und Adjunkt oder/und Objunkt [3 4].
|
| Affix | Verben | D00 | D../fy | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 |
| -um- (1) | lumindọl ⬧ kumidlạt ⬧ umulạn | f0 | . | . | . | . | . |
| bumahạ | f0 | . | . | fg|fn | . | . | |
| lumipas | . | fy?fg | . | . | . | . | |
| lumitạw sumagọt tumayọ | . | . | fg | . | . | . | |
| dumaạn sumama sumunọd tumulong | . | . | fg | fg|fK | . | . | |
| tumigil (1) | . | . | fg | fg|ft | . | . | |
| umalịs lumabạs pumasok umuwị | . | . | fg | fg|fn | fg|fn | . | |
| kumain tumawag | . | . | fg | . | fg|ft | . | |
| bumalịk dumatịng lumapit pumuntạ tumigil (2) tumingịn | . | . | . | fg|fK | . | . | |
| umakyạt lumipat | . | . | . | fg|fn | fg|fn | . | |
| bumarịl ⬧ pumatạy | . | . | . | fg|ft | fg|ft | . | |
| bumaling | . | . | . | fg|fn | . | fg|ft|fn | |
| bumilị gumamit gumawạ kumuha | . | . | . | . | fg|ft | . | |
(1) Wie die Tabelle zeigt, gibt es keine eindeutige Zuordnung der -um- Verben zu einer syntaktischen Verbgruppe. {DT01} und {DT10} bilden die Schwerpunkte, wobei es etwa ebenso viele {DT01} Verben mit Affix -um- gibt wie {DT10} Verben. {D00} und {DT../fy} Verben sind selten.
(2) Die filipinische Sprache besitzt einige -um- Verben {D00/f0}, die stets ohne Subjekt gebraucht werden und die Naturereignisse beschreiben [1]. Einige {DT00/fy} Zustandsverben werden mit -um- gebildet. Sie werden dann mit -um- (oder mang-) gebildet, wenn das Affix ma- bereits für ein Adjektiv verwendet wird [2a|b] {7A-112}.
Die -um- Verben der Gruppe {DT00/fg} beschreiben einfache Tätigkeiten, die weder Adjunkt noch Objunkt besitzen [3]. Ebenso werden -um- Verben für einfache Tätigkeiten verwendet [4], auch wenn sie in der Regel Adjunkt oder Objunkt besitzen. Bei einigen {DT00/fg} Verben beschreibt der Wortstamm bereits das Tatobjekt [5].
|
(3) Zu den {DT01} -um- Verben zählen Verben der Bewegung, die ein Adjunkt besitzen (lokative Funktion, [6]). Hinzu kommen Verben, bei denen das Adjunkt den Empfänger bezeichnet [7]. Wird einem {DT01} Verb ein Objunkt (das Tatobjekt) hinzugefügt, so entsteht ein {DT11} Verb [8]. Eine weitere Gruppe sind {DT10} Verben, deren Objunkt das Tatobjekt ist [9]. Einige -um- Verben können statt eines Adjunktes ein Objunkt mit lokaler Funktion besitzen [10a|b]
|
(4) Eine Art Tabu (Meidungsgebot) gibt es bei Verben, die ausdrücken, dass ein Täter einem Tatobjekt großes Leid oder großen Schaden zufügt. Dazu gehören Verben wie bumarịl, pumalo, pumatạy, sumakạl. Diese Verben werden bei Tieren als Tatobjekt nahezu regelmäßig mit Objunkt verwendet, bei Menschen im Allgemeinen weniger, bei einem Menschen sehr selten, und die Nennung eines Namens in diesen Gebilden ist nahezu tabuisiert.
(5) Eine Anzahl Wortfamilien besitzt neben dem -um- Verb ein mag- Verb {7-1.4 (3)}.
(1) Mit mag- gebildete Wörter werden mit Aktivverben identifiziert, da dieses Präfix auch in Affixkombinationen nicht für Passivverben und kaum für andere Wortarten verwendet wird. Alle Flexionsformen von mag- Verben lassen den Wortstamm phonologisch unangetastet (kein Infix im Wortstamm, keine Betonungsänderung). Deshalb werden Bildungen mit mag- stets als Aktivverben verstanden, auch wenn sie im Einzelfall neu und zunächst ungebräuchlich sind; wir bezeichnen diese Verben als uneigentliche mag- Verben.
(2) Übersicht der mag- Verben
| Affix | Verben | DT | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 |
| fy | fg | fg | fg | fg | ||
| mag- (1) | magtakạ magkamalị |mag+kamali| | fy | . | . | . | . |
| magsawa | fy|fs | . | . | . | . | |
| mag-isạ magkita magsalitạ magtrabaho | . | fg | . | . | . | |
| maghintạy magtanọng | . | fg | fg|fK | fg|ft | . | |
| mag-aral magbago | . | fg | . | fg|ft | . | |
| maglingkọd magmulạ magpatulọy |mag+patuloy| | . | . | fg|fK | . | . | |
| magdalạ maghandạ magtapọs {*} | . | . | fg|ft | fg|ft | . | |
| magbayad | . | . | . | fg|ft | . | |
| magbigạy maglagạy | . | . | . | . | fg|ft|fK | |
| mag- | Verben mit -um- Verb in der Wortfamilie | |||||
| magsayạ | fy | . | . | . | . | |
| maglakạd {*} | . | fg | . | . | . | |
| magsulạt {*} | . | fg | . | fg|ft | . | |
| magbalịk magpuntạ magtungo | . | . | fg|fK | . | . | |
| magbilị maghanạp {*} magpasok | . | . | . | fg|ft | . | |
| {*} !! Diese Verben sind endbetont, obwohl ihr Wortstamm auf der vorletzten Silbe betont wird. | ||||||
(3) Einen Schwerpunkt bilden die mag- Verben mit Täterfokus und ohne weitere Argumente [1]. Häufig kommt eine Tatobjektfunktion als Objunkt hinzu {DT10/fg|ft} [2a]. Einige dieser Wortfamilien besitzen ebenfalls -um- Verben [2a|b], die lexikalischen Abweichungen können groß sein (Beispiel bumilị - magbilị).
Werden mag- Gebilde noch mit einem lokativen oder einem Empfängeradjunkt ergänzt, entstehen {DT11/fg|ft|fK} Verben [3].
|
Neben diesem Schwerpunkt gibt es wenige mag- Verben {DT00/fy} und eine größere Anzahl mag- Verben mit Adjunkt; in vielen Fällen werden von einem mag- Verb Adjunkt oder Objunkt gebildet [4a|b].
|
(4) In einer Anzahl von Wortfamilien werden regelmäßig Passivverben verwendet und nur dann ein Aktivverb mit Präfix mag-, wenn die Verwendung eines Aktivverbs zwingend vorgeschrieben ist. So wird in der Familie von sabi das Passivverb sabihin fast ausschließlich verwendet [5b]. In wenigen Fällen steht ein mag-Verb; dazu gehören die Frage nach dem Täter [5a] und die Ableitung des Gerundiums, weil beides mit Passivverben nicht möglich ist {12-4.3} {6-6.5}.
|
(5) mag- Verben können nicht nur vom Wortstamm abgeleitet sein, sondern auch von Verben (Beispiel magpumilit (pilit) |mag+(um+pilit)| {7-8.3}) oder von Adjektiven mit Affix (Beispiel magmalupịt |mag+(ma+lupit)|). Auch können mag- Verben zu Nominalphrasen mit Attribut gebildet werden (magmagandạng umaga, magdalawạng isip (dalawa ) {7A-141 (2)}).
(6) {Θ} Die Affixe mag- und pag-:
| [9] | {6-4 [1]} | ma- | mang- | -um- |
|
mag- (B) | |
| [10] | {6-4 [4]} |
|
mag- (K) | ||||
| [11] | {6-4 [2]} | makapang- | maka- |
|
pag- (B) | ||
| [12] | {6-4 [5]} |
|
pag- (K) | ||||
| [13] | {ND} | pa- | pang- |
|
pag- (B/K) | ||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_09.html
(1) Als einfache Passivverben bezeichnen wir die -in, -an und i- Verben, die keine weiteren Affixe besitzen. Diese Verben können in zwei Gruppen getrennt werden, Verben mit Tatobjektfokus {DB../ft} und Verben mit K-Fokus {DB../fK}.
| Affix | DB10/ft | DB10/fK | DB11/ft | DB20/fK | |
| -in | +++ | (+) | . | (+) | {7-2.2} |
| -an | ++ | +++ | . | ++ | {7-2.3} |
| i- | ++ | (+) | +++ | + | {7-2.4} |
Ähnlich wie bei den einfachen Aktivverben, gibt es keine eindeutige Zuordnung zwischen syntaktischen und morphologischen Verbgruppen. Es sind gewisse Schwerpunkte ersichtlich, die jedoch wegen der großen Bandbreite innerhalb der einzelnen Gruppen nur schwer erkennbar sind.
(2) Verben wie antukịn, gabihịn, lagnatịn, malasin, tamarịn, aber auch pawisan sind semantisch Aktivverben, können jedoch als Passiv im Sinn von 'von etwas befallen werden' erklärt werden.
(1) Den einfachen Passivverben können Aktivverben gegenübergestellt werden {*}.
{*} Wir sagen nicht, dass die Passivverben von den Aktivverben abgeleitet sind.
(2) {DB10/ft|fg} Verben sind Passivverben mit folgender Eigenschaft: Das Objunkt des Aktivsatzes wird das Subjekt des Passivsatzes, und das Subjekt des Aktivsatzes wird zum Objunkt des Passivsatzes. {DB10/ft|fg} entspricht dem klassischen Passiv der europäischen Sprachen ('patient voice'). Semantisch bilden diese Verben Sätze mit Tatobjektfokus; dieses {DB10/ft|fg} Passiv wird vorwiegend mit -in Verben gebildet [1 2], aber auch mit -an [3] und i- Verben [4]. {DB00} Gebilde entstehen, wenn der Täter nicht dargestellt wird [5].
|
(3) Das {DB10/fK|fg} Passiv besitzt neben dem Subjekt ein Objunkt, das im Aktivsatz das Subjekt war. Der Unterschied zum Passiv {DB10/ft|fg} ist, dass das Subjekt des Passivsatzes im Aktivsatz ein Adjunkt, also eine K-Funktion war. In der Regel bilden -an Verben dieses Passiv [6 7], jedoch gibt es auch einige -in Verben mit {DB10/fK} Passiv [8]. Wird der Täter nicht dargestellt, entstehen {DB00} Gebilde [9]. In vielen Fällen ist ein Empfänger oder ein lokaler Begriff im Fokus ('locative voice').
|
(4) Das {DB11} Passiv besitzt einen entsprechenden Aktivsatz vom Typ {DT11}, der also ein Objunkt und ein Adjunkt enthält. Im Passivsatz tauschen Subjekt und Objunkt des Aktivsatzes ihre Rollen, während das Adjunkt erhalten bleibt ('conveyance voice'). Dieses Passiv wird mit i- Verben gebildet [10]. {DB11} Verben besitzen Tatobjektfokus. In diesen Sätzen kann der Täter entfallen, dann entstehen {DB01} Gebilde [11].
|
(5) Eine besondere Bildung ist das Passiv {DB20}. Diese Verben besitzen als Subjekt das Adjunkt des entsprechenden Aktivsatzes. Da das Subjekt des Aktivsatzes ein Objunkt wird, enthält der Passivsatz zwei Objunkte, die semantisch Täter und Tatobjekt darstellen. Dieses Passiv wird vorwiegend mit -an Verben gebildet [12 13], aber auch mit i- Verben [14]. {DB20} Verben haben in der Regel Empfängerfokus [12 14] oder lokativen Fokus [13].
|
| Affix | Verben | DB10 | DB11 | DB20 |
| -in Verben mit Tatobjektfokus | ||||
| -in (1) | gamitin gawịn hanapin hintayịn isipin mahalịn tanggapịn kausapin |kausap+in| | ft|fg | . | . |
| alisịn banggitịn sabihin | ft|fg | ft|fg|fK | . | |
| kilalanin {DB001/ft|P-L} | . | . | . | |
| haluin ⬧ {DB21/ft|fg|fm|fn} | ft|fg | ft|fg|fn | . | |
| -in Verben mit K-Fokus | ||||
| dalawin pukulịn sundịn tanungịn tawagin | fK|fg | . | . | |
| batiin | fp|fg | fp|fg|fs | ||
| alukịn | . | . | fp|fg|ft | |
Im Allgemeinen bringt das Suffix -in das Tatobjekt in den Fokus, während der Täter ein Objunkt ist [1] {DB10/ft|fg}. Bei einigen Verben kann ein Adjunkt zugefügt werden, so dass {DB11} Verben gebildet werden [2]. Damit besitzen -in Verben eine einfache und deutliche Argumentstruktur. Als Ausnahme können -in Verben mit K-Fokus betrachtet werden [3].
|
Erwähnenswert ist der Wortstamm tawag, der neben dem {DB10/ft|fg} Verb tawagin ein weiteres Verb tawagan mit Suffix -an und gleicher Syntax {DB10/ft|fg} bildet. Die beiden Verben unterscheiden sich also nicht in der Syntax und im Fokus. tawagin wird verwendet, wenn der Gerufene in Sichtweite bzw. in der Nähe ist; tawagan wird heute beim Telefonieren verwendet [4a|b].
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 | |
| -an (1) | kilabutan | ft | . | . | . | |
| asahan balikạn daanạn iwan pakinggạn lapitan puntahạn tawagan tingnạn tulungan | . | fK|fg | . | . | ||
| hayaan | . | fp|fg, ft(S-L)|fg | ||||
| saktạn | . | fp|fg | fp|fg|fs | . | ||
| bayaran | . | fp|fg | . | fp|fg|ft | ||
| bawasan bigyạn bilhạn dalhạn lagyạn | . | . | . | fK|fg|ft | ||
| {DB/ft|fg} Verben ohne -in Verb in Wortfamilie | ||||||
| -an | buksạn {*} dagdagạn | . | ft|fg | . | . | |
| palitạn | . | ft|fg | . | fl1|fg|fl2 | ||
| . | bansagạn | . | {DB101/ft|fg|P-L} | |||
| {*} In der Umgangssprache werden gelegentlich -in Verben wie bukasịn gebildet. | ||||||
Schwerpunktmäßig besitzen -an Verben Empfänger- oder lokativen Fokus [1-3], während der Täter ein Objunkt bildet. Häufig sind {DB20} Verben, bei denen noch ein Tatobjekt als zweites Objunkt hinzutritt [2]. Daneben gibt es eine nicht unbeträchtliche Zahl von -an Verben, die Tatobjektfokus besitzen. Die Mehrheit dieser Verben besitzt kein -in Verb in der Wortfamilie (es kann ein -in Adjektiv geben) [3]. Selten sind Verben mit zusätzlichem Werkzeugobjunkt [4]. Eine besondere Argumentstruktur hat das Verb saktạn , das neben dem Täterobjunkt ein Adjunkt mit Ursachefunktion besitzt [5].
| |||||||||||||||||||||
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| i- Verben mit Tatobjektfokus | |||||
| i- (1) | itulọy | ft | ft|fg | . | . |
| ilabạs isulat | . | ft|fg | . | . | |
| iabọt ibalịk ituro | . | ft|fg | ft|fg|fK | . | |
| ibigạy ihatịd ilagạy ipasok itanọng | . | . | ft|fg|fK | . | |
| i- Verben mit Tatobjektfokus ohne -in Verb in der Wortfamilie | |||||
| i- | ihandạ ipangako |i+pangako| isama itapon | . | ft|fg | . | . |
| Uneigentliche i- Verben {7-2.4.1} | |||||
| isarạ i-edit ⬧ i-save ⬧ | . | ft|fg | . | . | |
| i- Verben mit K-Fokus | |||||
| i- | idaạn | . | . | fp|fg|fn | . |
| ihambịng ipalịt | . | . | fl|fg|fl | . | |
| ibilị ihanap | . | . | . | fp|fg|ft | |
(1) i- Verben können in zwei Klassen eingeteilt werden; die übergroße Klasse besitzt Tatobjektfokus und der Täter ist ein Objunkt. Eine mehrheitliche Gruppe dieser Klasse besitzt zusätzlich ein Adjunkt mit lokativer oder Empfängerfunktion, seltener einer anderen A-Funktion; sie sind {DB11/ft|fg|fK} Verben [1]. Die i- Verben sind die einzigen einfachen Verben (mit Ausnahme einiger weniger -in Verben), die dieses Passiv bilden ('conveyance voice').
(2) Eine zweite kleinere Gruppe dieser ersten Klasse besitzt nur ein Objunkt und kein Adjunkt, ihre Argumentstruktur ist also {DB10/ft|fg}. Damit gleichen sie syntaktisch der Mehrheit der -in Verben. Einige Wortfamilien besitzen kein -in Verb und gebrauchen stattdessen ein i- Verb [2]; andere haben neben dem i- Verb ein -in Verb [3a|b], wobei es keine bis größere semantische Unterschiede geben kann. Hinzu kommen uneigentliche i- Verben mit {DB10/ft|fg} Syntax {7-2.4.1}.
|
(2) Kleiner ist die zweite Klasse von i- Verben, die K-Fokus besitzen [4-6]. Es gibt in dieser Klasse Verben mit Empfänger-, lokativem, Ursache-, Werkzeug- und Austauschfokus; der Täter ist ein Objunkt. Eine Gruppe besitzt ein weiteres Objunkt für das Tatobjekt, bildet also {DB20/fK|fg|ft} Verben [4]. Eine kleine Gruppe mit Austauschfokus besitzt neben dem Täterobjunkt ein Austauschadjunkt {DB11/fl|fa|fl} [5]. Andere Verben haben nur das Täterobjunkt und sind {DB10/fK|fg} Verben [6].
|
Mit dem Präfix i- können uneigentliche Passivverben gebildet werden (ähnlich wie die Bildung von uneigentlichen Aktivverben mit mag- {7A-141}). Ihre Bildung ist mehr von der Phonologie und weniger von der Syntax her begründet.
Aus dem Englischen übernommene Fremdwörter passen häufig phonologisch schlecht zur filipinischen Sprache. Werden sie importiert, verlieren sie ihren Wortartcharakter. Um sie als Verben verwenden zu können, müssen sie filipinisch affigiert werden. Bei zwei- und mehrsilbigen englischen Wörtern findet sich meist eine akzeptable Möglichkeit, -in oder -an Verben zu bilden (Beispiele sind kinikidnapped, lipstickan). In einigen Fällen wird statt des Infixes -in- auf das Präfix ni- ausgewichen (Beispiel ni-released).
Vorgezogen werden jedoch i- Verben, insbesondere bei einsilbigen Fremdwortstämmen. i- ist ein Präfix, im Gegensatz zu den alternativen Passivsuffixen -in und -an. So können durch eine Bildung mit i- phonologische Probleme vermieden werden. Phonologisch problematisch bleibt, dass auch i- Verben in Präteritum und Präsens ein Infix -in- erhalten. Dann wird auf die -ni- Form dieses Infixes ausgewichen (Beispiel: ini-save).
(1) In den obigen Abschnitten haben wir dargestellt, welche einfachen Verben die Sprache für welche Funktionen bildet. Im Folgenden versuchen wir, die verschiedenen Bildungen zueinander in Beziehung zu setzen.
Zu einem Vergleich der Aktivverben untereinander kann vereinfachend folgendes Schema herangezogen werden.
| Zustand | Nur Täter | Adjunkt | Objunkt | O. und A. | |
| DT../fy | DT00/fg | DT01 | DT10 | DT11 | |
| ma- | +++ | + | (+) | (+) | . |
| mang- | ++ | +++ | + | + | (+) |
| -um- | + | ++ | ++ | ++ | + |
| mag- | (+) | ++ | ++ | ++ | + |
Die breite Verteilung der mag- Verben findet eine einfache Erklärung. Die uneigentlichen mag- Verben sind naturgemäß ziemlich zufallsverteilt {7-1.4 (1)}. Entfernt man diese Verben, so ergibt sich folgendes Bild:
| Zustand | Nur Täter | Adjunkt | Objunkt | O. und A. | |
| DT../fy | DT00/fg | DT01 | DT10 | DT11 | |
| ma- | +++ | + | (+) | (+) | . |
| mang- | ++ | +++ | + | + | (+) |
| -um- | + | ++ | ++ | ++ | + |
| mag- echt | (+) | ++ | + | +++ | + |
(2) Wir betrachten die wesentlichen Überlappungen.
| Die erste davon liegt bei den Zustandsverben zwischen ma-, mang- Verben und -um- Verben (Syntax {DT/fy}). Ein "Notverb" mit mang- oder -um- wird gebildet, wenn das Affix ma- bereits von einem Adjektiv belegt ist {7-1.1 (3)}. Wann mang- und wann -um- Verben gebildet werden, ist nicht ersichtlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine weitere Überlappung tritt bei einfachen Tätigkeiten zwischen mang- und -um- Verben auf (Syntax {DT00/fg}). Auch hier sind die Gründe für die unterschiedliche Wahl nicht offensichtlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Bildung von {DT01} mag- Verben, die nahezu alle als echt zu betrachten sind, ist keine offensichtliche Begründung anzugeben. Eine Anzahl Wortfamilien bildet neben einem {DT01} -um- Verb ein mag- Verb mit gleicher Syntax und häufig nahezu gleicher Bedeutung. | |||||||||||||||||||||||||
| Eine größere Anzahl Wortfamilien bildet -um- Verben mit {DT10} Syntax. Diese können ein {DT10} mag- Verb ersetzen, oder es sind {DT10} Verben mit beiden Affixen vorhanden. | |||||||||||||||||||||||||
(3) Ein vereinfachtes Schema für die Passivverben sieht wie folgt aus.
| Tatobjektfokus | K-Fokus | |||
| DB10/ft | DB11/ft | DB10/fK | DB20/fK | |
| -in | +++ | . | (+) | (+) |
| -an | ++ | . | +++ | ++ |
| i- echt | ++ | +++ | (+) | + |
(4) Der Schwerpunkt der -in Verben liegt bei {DB10/ft} Gebilden, jedoch gibt es hier Überlappungen mit -an und i- Verben..
| Es können in einer Wortfamilie zwei {DB10/ft} Verben gebildet werden, mit oder ohne semantischen Unterschied. | |||||||||||||||||||||||||||
(5) Erheblich komplizierter liegen die Verhältnisse, wenn man Aktivverben den entsprechenden Passivverben zuordnen will. Bei einem morphologischen Vergleich werden Aktivaffixe und Passivaffixe in Verbindung gebracht.
| A k t i v |
Passiv | |||
| -in | -an | -i | ||
| ma- | + | |||
| mang- | +++ | + | ||
| -um- | +++ | ++ | + | |
| mag- | ++ | ++ | ++ | |
(6) Da dieser Vergleich wenig verständliche Ergebnisse zeigt, nehmen wir stattdessen einen gemischten syntaktisch-morphologischen Vergleich vor. Wir vergleichen den Bau des Aktivsatzes bezüglich seiner Objunkt- und Adjunktphrasen mit dem Affix des Passivverbs. Dieser Methode liegt die Annahme zugrunde, dass die Sprache das Passiv abhängig von ng und sa im Aktivsatz bildet (bzw. umgekehrt das Aktiv abhängig vom Affix des Passiv).
A k t i v |
Passiv | |||
| -in | -an | -i | ||
| DT/fy | ||||
| DT00/fg = |
||||
| DT01
= |
+ | +++ | + | |
| DT10
= {P-W} |
+++ | ++ | ++ | |
| DT11 = {P-W} {P-K} | + | ++ | +++ | |
Diese Darstellung lässt einige Beziehungen deutlich werden. Das Aktivverb mit alleinigem Objunkt (Tatobjekt) bildet den Passivsatz vorwiegend mit einem -in Verb. Besitzt das Aktivverb nur ein Adjunkt, so werden -an Verben gebildet. Besitzt das Aktivverb Objunkt und Adjunkt, so werden vorzugsweise i- Verben gebildet.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_10.html
(1) Die Verben, die mit dem Präfix ma- und dessen Zusammensetzungen gebildet werden, stellen recht inhomogene Gruppen dar. Dies ist verständlich, da das Präfix ma- in der filipinischen Sprache für sehr unterschiedliche Zwecke verwendet wird {7A-111 Θ}. Zunächst ist zwischen unbetontem ma- und betontem ma- zu unterscheiden.
(2) Mehrheitlich besitzen die mit unbetontem ma- gebildeten Verben die Modalität der Fähigkeit {7A-301}. Dazu gehören die Passivverben mit ma- als alleinigem Präfix {7-3.1}; weiterhin die Passivverben mit ma--an {7-3.2} und mai- {7-3.3}. Aktivverben mit der Modalität einer Fähigkeit sind die maka- Verben {7-3.4}.
Die Passivverben mit den Affixen mapa-, mapa--an, maipa- und die makapạgpa- Aktivverben, die die Fähigkeit zu einer Veranlassung ausdrücken, werden als pa- Verben in {7-4.2} behandelt.
Neben den ma-, ma--an, mai- Verben gibt es einige Verben mit der Modalität der Fähigkeit, die ein zusätzliches Affix -pag- erhalten. Diese mapạg-, mapạg--an, maipag- Verben behandeln wir bei den pag- Verben in Abschnitt {7-5.4}. Hinzu kommen einige maipang- und mapang--an Verben, die wir zu den ipang- bzw. pang--an Verben zählen {7-6.1} {7-6.2}.
(3) Verben wie mabutihin, mahalagaịn sind nur scheinbar ma--in Verben, sie sind von einem ma- Adjektiv abgeleitete -in Verben und haben deren Flexion. Die filipinische Sprache besitzt keine ma--in Verben.
(4) Von den Verben mit unbetonten ma- Affixen sind die mit betontem ma- zu unterscheiden. Betontes ma- zeigt eine zufällige oder unbeabsichtigte Tätigkeit an (Modalität des Zufalls) und bildet – auch in Kombination mit anderen Affixen – Passiv- und Aktivverben {7-3.5.1}. Die (wenigen) mapag-, mapag--an und maipag- Verben werden in {7-5.5} behandelt. Die Affixkombination maka- bildet Aktivverben {7-3.5.2}.
(5) Neben diesen mit einer Modalität behafteten Verben gibt es weitere Gruppen von Verben, die das Präfix ma- besitzen. Die einfachen ma- Aktivverben werden in {7-1.1} behandelt. Weitere Aktivverben sind eine kleine Gruppe der ma--an Verben {7-3.6}. Eine Sonderstellung nehmen die aktiven maki- Verben ein, die keine sichtbare Verbindung zu anderen ma- Verben besitzen {7-9.1}.
(6) Das unbetonte Flexionsaffix na- kann das Flexionsaffix -in- in Präteritum und Präsens ersetzen {6A-6112}. Dieses na- steht vermutlich in keinem Zusammenhang mit der Zeitform na- der ma- Verben; insbesondere besitzen die an Stelle von -in- verwendeten Formen keine Modalität der Fähigkeit.
Passivverben mit unbetontem ma- als Präfix zeigen die Fähigkeit an, etwas zu tun [1a] und besitzen in der Regel Entsprechungen mit dem Affix -in [1b]. Daher entspricht die Argumentstruktur dieser ma- Verben der der -in Verben, {DB10/ft|fg} herrscht vor. Verben des fließenden Übergangs von Aktiv nach Passiv fehlt die Eigenschaft der Fähigkeit, vielmehr drücken sie einen Zustand, eine einfache oder unbeabsichtigte Tätigkeit aus [2] {7-1.1 (4)}.
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| [1*] Passivverben der Fähigkeit mit -in Verb in der Wortfamilie | |||||
| ma- | matiyạk | . | ft|fy | . | . |
| mabasa magawạ makuha mapigil mapuntạ masulat matanggạp | . | ft|fg | . | . | |
| magamit | . | ft|fg | {DB001/ft|P-L} | ||
| Passivverben der Fähigkeit ohne -in Verb in der Wortfamilie | |||||
| ma- | maratịng maiwan | . | ft|fg | . | . |
| mapạg- | → {7-5.4}. | ||||
| Affix | Verben | |
| [2*] Verben im Übergangsbereich von Passiv und Aktiv | ||
| ma- | mabasag mahulog malunod matapos | DT00/fg?DB00/ft, DB10/ft|fg |
Beispielsätze mit ma- Übergangsverben →
{7A-311}.
Flexionsformen mit na- statt -in- →
{6A-6112}.
Eine Gruppe der ma--an Passivverben besitzt K-Fokus [1a] mit der Modalität der Fähigkeit. Eine zweite Gruppe besitzt Tatobjektfokus; beide Gruppen können als Ableitung von entsprechenden -an [2a|b] und seltener -in Verben [3a|b] betrachtet werden, um die Modalität der Fähigkeit auszudrücken.
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| Verben der Fähigkeit mit K-Fokus | |||||
| ma--an | maasahan maiwan mapasalamatan | . | fK|fg | . | . |
| maalisạn masaktạn | . | . | . | fp|fg|ft | |
| {DB10/ft|fg} Verben der Fähigkeit, denen {DB10/ft|fg} Verben mit -an entsprechen | |||||
| ma--an | mabalikạn mabayaran masugatan matandaạn | . | ft|fg | . | . |
| {DB10/ft|fg} Verben der Fähigkeit, denen {DB10/ft|fg} Verben mit -in entsprechen | |||||
| ma--an | maintindihạn mapigilan | . | ft|fg | . | . |
| mapạg--an | → {7-5.4}. | ||||
Weiterhin gibt es ma--an Aktivverben {7-3.6}.
Mit Präfix mai- werden Passivverben gebildet, die die Modalität einer Fähigkeit anzeigen [1a]. Sie besitzen entsprechende i- Verben [1b]. In der Regel ist die Argumentstruktur von i- und mai- Verben einer Wortfamilie gleich.
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| mai- | mailabạs maitanọng maitayọ | . | ft|fg | . | . |
| maibalịk maibigạy maituro | . | . | ft|fg|fp | . | |
| maipa- | mapa- → {7-4.2} | ||||
| maipag- | → {7-5.4} | ||||
| maipang- | ipang- → {7-6.1} | ||||
Die Verben mit den Präfixen maka-, makapang- und makapạg- sind eine semantisch homogene Gruppe von Aktivverben und drücken eine Fähigkeit aus. maka- Verben sind nahezu stets Entsprechungen von Aktivverben mit Affixen ma- und -um- [1 2]. makapạg- Verben besitzen eine mag- Entsprechung [4]. Gleiches gilt für mang- und makapang- [3].
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| maka- | makahiyạ makalipas | fy | . | . | |||
| maka- | makabasa makalabạs makapikịt makatulog | fg | . | . | . | ||
| makabalịk makaratịng makapansịn makatulong makaupọ | . | fg|fK | . | . | |||
| makagawạ makakain makasulat | . | . | fg|ft | . | |||
| makapang- | makapaniwala | fg | . | . | . | ||
| makapanghingị | . | . | fg|ft | fg|ft|fp | |||
| makapạg- | makapạgtakạ | fy | . | . | . | ||
| makapạgsalita makapạg-usap | fg | . | . | . | |||
| makapạglingkọd | . | fg|fp | . | . | |||
| makapạg-aral makapạgtindạ | . | . | fg|ft | . | |||
| makapạgbigạy | . | . | . | fg|ft|fp | |||
Die maka- Verben bilden Flexionsformen mit naka- und naka-&-. Diese sind Adjektiven mit gleichen Präfixen ähnlich.
Mit betontem Präfix ma- werden Passiv- und Aktivverben gebildet. Beide Gruppen besitzen in der Regel die Modalität des Zufalls. Sie drücken also aus, dass etwas unbeabsichtigt, versehentlich oder zufällig geschieht.
Um die betonte ma- Vorsilbe nicht zu entwerten, folgen diese Verben bei der Flexion abweichenden Betonungsregeln {6-6.1.3 4.}.
(1) Die betonten Affixe ma-, mapa- und ma--an bilden Passivverben mit der Modalität des Zufalls. Zwischen diesen Affixkombinationen bestehen syntaktisch und semantisch kaum Unterschiede und wir betrachten sie gemeinsam [1]. In der Regel ist {DB10/ft|fg} die Argumentstruktur. Das Präfix mapasa- betrachten wir als Ableitung von mapa- [1d].
(2) Wie bei den Verben mit unbetontem ma- besteht auch bei betontem ma- ein fließender Übergang zu Aktivverben [2]. Andere Verben werden ausschließlich als Aktivverben mit der Modalität des Zufalls verwendet [3].
|
| Affix | Verben | DB00 | DB01 | DB10 |
| [1*] Passivverben | ||||
| ma- | maalaala madamạ marinịg maisip makilala makita {*} mapansịn makausap |ma+kausap| {*} | . | . | ft|fg |
| mapa- | mapatali ⬧ | . | . | ft|fg |
| mapasa- | mapasaakin | ft | . | . |
| ma--an | malaman |ma+alam+an| maramdamạn maranasan matagpuạn matutuhan {*} | . | . | ft|fg |
| mamalayan | . | ft(S-L)|fy | ||
| mapag-, mapag--an, maipag → {7-5.5} | ||||
| Affix | Verben | |
| [2*] Verben im Übergangsbereich von Passiv und Aktiv | ||
| ma- mapa- ma--an |
madapạ | DT00/fg?DB00/ft |
| magulat | DT01/fy|fs?DB01/ft|fs | |
| mabakas mapahiyạ | DT00/fy?DB00/ft | |
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 |
| [3*] Aktivverben | ||||
| ma- mapa- ma--an |
(naritọ) {*} mapaiyạk maibạ malagạy | fy | . | . |
| magisịng malapit mapalundạg | fg | . | . | |
| matuto {*} | fg | . | fg|ft | |
| mapahamak | . | fy|fn | . | |
| maparaạn mapatingịn mauwị | . | fg|fn | . | |
{*} Keine Modalität des Zufalls.
Aktivverben mit einer schwach ausgeprägten Modalität des Zufalls oder der Fähigkeit werden mit der Affixkombination maka- gebildet [1].
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| maka- | makakita | fg | fg|ft | . | |||
| makadamạ makaranas makarinịg makakuha | . | . | fg|ft | . | |||
| maka- {*} | makatulog | fg | . | . | . | ||
| {*} Die maka- Verben sind i.A. ma- Verben, die von Substantiven oder Adjektiven mit Affix ka- abgeleitet sind (makausap {7-3.5.1}). | |||||||
Eine kleinere Gruppe Aktivverben mit der Affixkombination ma--an beschreibt Zustände oder Gefühle, der Besitzer dieses Zustandes oder Gefühles ist im Fokus; im Gegensatz zu den oben behandelten ma- Passivverben besitzen sie keine Modalität der Fähigkeit. Wir betrachten diese Verben als aktive ma--an Verben. Ein Adjunkt kann die Ursache des Gefühles oder Zustandes beschreiben [1].
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 |
| ma--an | maguluhạn mahirapan matigilan | fy | fy|fs | . | . |
| mapilitan mawalạn | . | . | fy|ft | . | |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_11.html
Das Affix pa- wird häufig in Affixkombinationen zur Bildung von Verben verwendet. In der Regel bewirkt das Affix pa-, dass ein Auftrag oder eine Erlaubnis ausgedrückt wird; wir bezeichnen dies als Modalität der Veranlassung (pagkakabago ng paghimok). Von Ausnahmen abgesehen, steht der Veranlasser (Initiator, tagahimok) im Vordergrund {6-3.4.2 (5)}. Der ausführende Täter ist bei diesen Verben oft weniger bedeutend und wird daher seltener ausgedrückt.
Die mit den Affixen magpa-, pa--an, pa--in und ipa- gebildeten Verben einer Wortfamilie stehen häufig in einer engen Beziehung zueinander und sind eine Art einfache Verben mit der Modalität der Veranlassung {7-4.1}. Entsprechend bilden die Präfixe makapạgpa-, mapa-, mapa--an und maipa- Verben, die die Fähigkeit einer Veranlassung ausdrücken {7-4.2}. Das Präfix pa- kann alleiniges Affix sein, diese Gebilde sind als Verkürzungen zu betrachten {7-4.3}.
Ohne Modalität der Veranlassung werden magpaka- Verben gebildet {7-8.4}. Eine Sonderstellung nimmt das Präfix paki- ein, das wir nicht der pa- Gruppe zurechnen {7-9.2}. Die papag--in Formen sind vermutlich keine pa- Verben, sondern Futurformen von pag--in Verben {7-5.1 (3)}. Weiterhin wird das Präfix pa- bei der Bildung der Gerundien der ma- Verben verwendet {6-6.5 (2)}.
(1) Bei den Verben mit den Affixen magpa-, pa--an, pa--in und ipa- wird der Veranlasser (Initiator; Anordnender oder Erlaubender) betrachtet. Im Aktivsatz mit magpa- Verb ist der Veranlasser das fokustragende Subjekt [1], in den Passivsätzen mit pa--an, pa--in oder ipa- Verben ist er ein Objunkt [2-4] (Übersicht {7A-411}). ipa- Verben besitzen Tatobjektfokus, pa--in Verben setzen den ausführenden Täter in den Fokus, während pa--an Verben vorwiegend K-Fokus besitzen.
|
(2) Der Ausführende (Täter) ist bei magpa- und ipa- Verben oft nicht bedeutend und wird dann nicht bezeichnet. Er kann jedoch durch ein zusätzliches Adjunkt dargestellt werden [5 6]. Dieses Gebilde kann damit erklärt werden, dass aus der Sicht des Auftragenden der Täter die Richtung zum ausführenden Täter anzeigt. Um das zusätzliche Adjunkt deutlich zu machen, fügen wir zum Schlüssel des Verbs {..+01} hinzu {*}. Präpositionen werden verwendet, um den Empfänger usw. vom ausführenden Täter zu unterscheiden [5] und damit nur ein Adjunkt als Argument zu haben. Eine Ausnahme ist Satz [7] mit zwei Adjunkten.
{*} Beispiel: {DT10+01} ist ein Verb, das zum ursprünglichen Objunkt noch ein zusätzliches Adjunkt zur Erwähnung des Täters besitzt. Bei der Argumentstruktur wird ein zusätzliches Argument kursiv geschrieben.
Bei einigen magpa- Verben ist der ausführende Täter das Objunkt (Schlüssel {..+10}); in der Regel, wenn diese Verben kein anderes Objunkt besitzen ([8a|b 9]. Einige magpa- Verben werden ohne Objunkt verwendet (als {DT00} Verb), um auszudrücken, dass man etwas an sich selbst geschehen lässt [10] {7A-412}.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Die pa--in Verben setzen den ausführenden Täter in den Fokus, während der Veranlasser ein Objunkt ist [11]. Damit unterscheiden sie sich von einfachen -in Verben mit Tatobjektfokus [12a|b]. In vielen Fällen kann zu einem pa--in Verb ein entsprechender magpa- Aktivsatz gebildet werden, in dem der Täter als zusätzliches Adjunkt (Schlüssel {..+01}) [13a|b] bzw. Objunkt (Schlüssel {..+10}) [14a|b] dargestellt wird.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Die pa--an Verben besitzen in der Regel Empfänger- oder lokativen Fokus. In einigen Fällen kann der ausführende Täter als Adjunkt zugefügt werden [15].
| |||||||||||||
(5) {Θ} Wenn man die magpa- Verben mit den einfachen Aktivverben vergleicht, so stellt man fest, dass den vier Affixen ma-, mang-, -um- und mag- nur das Präfix magpa- gegenübersteht; magpa- hat also nicht nur mag- Entsprechungen {7-1.4 (6) Θ}. Bei den Passivverben haben die pa--in Verben in der Regel -in Entsprechungen, desgleichen pa--an ↔ -an, ipa- ↔ i-; dabei gibt es Ausnahmen.
(6) Umgangssprachlich können die Affixe magpa-, pa--an, pa--in und ipa- zu pa- verkürzt werden {7-4.3}.
| (7) Aktivverben | DT00 DT00+ |
DT01 DT01+ | DT10 DT10+ |
DT20 | |
| magpa- | |||||
| magpa- Verben mit entsprechendem ma- Verb | |||||
| magpawalạ | fh|fg | . | . | . | |
| magpa- Verben mit entsprechendem mang- Verb | |||||
| magpagamọt | fh|fg | . | fh|ft|fg | . | |
| magpa- Verben mit entsprechendem -um- Verb | |||||
| magpatabạ {**} | fh | . | . | . | |
| magpadaạn | fh|fg | . | . | . | |
| magpapasok | . | fh|fg|fn | . | ||
| magpagawạ | . | . | fh|ft | . | |
| magpabilị | . | . | fh|ft|fg | . | |
| Aktivverben | DT00 DT00+ |
DT01 DT01+ | DT10 DT10+ |
DT20 | |
| magpa- Verben mit entsprechendem mag- Verb | |||||
| magpahatịd | fh | . | . | ||
| magpahirap | fh|fg | . | . | . | |
| magpakilala | fh | . | fh|ft | . | |
| magpadalạ | . | . | fh|ft | . | |
| magpakita | . | . | fh|ft|fg | . | |
| magpa- Verben ohne entsprechendes einfaches Aktivverb | |||||
| magpaalala magpakasạl | fh|fg | . | . | . | |
| {**} "Reflexive" magpa- Verben → {7A-412} | |||||
| (8) Passivverben | DB01 | DB10 +01 | DB11 | DB20 | |
| pa--an | pabayaan pahalagahạn pahirapan | . | fp|fh=fg | . | . |
| pabinyagạn | . | fp|fh | . | . | |
| paliitạn | . | fn|fg/fh | . | . | |
| patunayan | . | ft|fh=fg | . | . | |
| padalhạn | . | . | . | fp|fh|ft | |
| Einfache -an Verben sind pakinggạn und pasalamatan; sie sind von pakinịg und pasalamat abgeleitet. | |||||
| (9) Passivverben | DB01 | DB10 | DB11 | DB20 | |||
| pa--in Verben mit -in Verb mit Tatobjektfokus in der Wortfamilie | |||||||
| pa--in | paalisịn pakainin pasayahịn | . | fg|fh | . | . | ||
| pa--in Verben ohne -in Verb in der Wortfamilie | |||||||
| pa--in | pabalikịn paiyakịn patawarin panatilihin paunlarịn paupuịn | . | fg|fh | . | . | ||
| panoorịn | . | ft|fh=fg | . | . | |||
| (10) Passivverben | DB01 | DB10 +01 | DB11 | DB20 | |
| ipa- | ipadalạ | ft|fh | . | ft|fh|fn | . |
| ipagamọt ipakuha ipatawag | . | ft|fh | . | . | |
| ipaalala ipakita | . | ft|fh|fg | . | . | |
| ipakilala | . | . | ft|fh|fp | . | |
(1) Die Präfixe makapạgpa-, mapa-, mapa--an und maipa- bilden Verben, die die Fähigkeit einer Veranlassung (kakayahan ng paghimok) ausdrücken. Dabei bildet makapạgpa- Aktivverben mit dem Veranlasser im Fokus [1]. Bei den mapa- Verben ist der ausführende Täter in der Regel das Subjekt und der Veranlasser ein Objunkt [2]. Bei den Passivverben mit mapa--an und maipa- ist der Veranlasser ein Objunkt [3 4]. Der ausführende Täter kann als Adjunkt hinzugefügt werden, was im Schlüsselsystem durch {..+01} angezeigt wird [1 5]. Zu nahezu allen maipa- Verben gehört ein ipa- Verb in der Wortfamilie. Mit Ausnahme einiger maipa- Verben werden die Verben dieser Gruppen selten verwendet.
|
(2) Zu anderen Modalitäten gelten die Beziehungen in der folgenden Tabelle.
Einfaches Verb | Fähigkeit | Veranlassung |
Fähigkeit zur Veranlassung |
| ma- -um- | maka- | magpa- | makapạgpa- |
| mang- | makapang- | magpa- | makapạgpa- |
| mag- | makapạg- | magpa- | makapạgpa- |
| -in | ma- | pa--in | mapa- |
| -an | ma--an | pa--an | mapa--an |
| i- | mai- | ipa- | maipa- |
| Affix | Aktivverben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| +01 +10 | |||||||
| makapạgpa- | makapạgpabaryạ | fh | . | . | . | ||
| makapạgpagalịng | fh|fg | . | . | . | |||
| makapạgpaligaya | . | fh|fp | . | . | |||
| Affix | Passivverben | DB01 | DB10 +01 | DB11 | DB20 | |||
| mapa- | mapaalịs ⬧ mapabuti ⬧ mapatakas ⬧ | . | fg|fh | . | . | |||
| mapabilị ⬧ | . | . | . | fg|fh|ft | ||||
| mapa--an | mapagalitan | . | ft|fh | . | . | |||
| mapatunayan | . | ft|fh=fg | . | . | ||||
| maipa- | maipakilalạ | . | ft|fh | . | . | |||
| maipainọm maipakita | . | ft|fh|fg | . | . | ||||
| maipadalạ | . | . | ft|fh|fn | |||||
| maipatayọ | . | . | . | fp|fh|ft | ||||
Die Affixe magpa-, pa--an und ipa- können zu pa- verkürzt werden. Diese pa- Abkürzungen gehören der Umgangssprache an und werden dort häufig verwendet. In der Schriftsprache finden sie sich fast nicht.
Die von den magpa- Aktivverben verkürzten pa- Verben bilden in erster Linie umgangssprachlich den Infinitiv in Imperativsätzen [1b]. Mit Ausnahme des umgangssprachlich gern verwendeten Futur mit Präfix papa- [2b] gibt es kaum Zeitformen. Auch kann Präfix pa- eine Verkürzung der Affixe pa--an oder ipa- sein [3 4], um umgangssprachliche Zeitformen zu bilden. Die Verkürzung von pa--in zu pa- kommt kaum vor
|
Von diesen Verkürzungen zu unterscheiden sind die verkürzten Formen von paki- {7-9.3}.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_12.html
Mit dem Affix pag- werden in Affixkombinationen Passivverben und seltener Aktivverben gebildet, jedoch nicht mit pag- als alleinigem Affix. Im Allgemeinen gibt das Affix pag- dem Verb keine besondere Bedeutung. In einer Anzahl von Fällen wird statt eines einfachen Passivverbs ein pag- Verb gebildet {7A-501}.
Mit den Affixkombinationen pag--in, pag--an und ipag- werden Passivverben gebildet; sie werden in den folgenden Abschnitten {7-5.1}, {7-5.2}, {7-5.3} beschrieben. Hinzu kommen die mapạg-, mapạg--an, maipag- Verben, die wegen des Affixes ma- die Modalität der Fähigkeit besitzen {7-5.4}. Weiterhin gibt es Verben, deren zusätzliches Affix ma- die Modalität des Zufalles anzeigt {7-5.5}.
Die Aktivverben, die mit makapạg- gebildet werden, werden in {7-3.4} bei Präfix maka- beschrieben; die wenigen makapạgpa- Verben in {7-4.2}. Die Zusammensetzung magsipạg- bildet Pluralverben {7-8.5}. Die makipạg- und makipạg--an Verben gehören zu den maki- Verben {7-9.1}.
Mit dem Präfix pag- werden die Gerundien der -um- und mag- Verben gebildet {6-6.5}.
(1) Eine erste Gruppe der pag--in Verben besitzt Täter und Tatobjekt als Argumente [1a 2a], ählich den einfachen -in Verben [2b]. Häufig besitzt die Wortfamilie kein -in Verb (einige ein -in Adjektiv wie mabuti {U}, butihin {U} ↔ pagbutihin {DB10}).
(2) Eine zweite (sehr kleine) Gruppe der pag--in Verben besitzt die Modalität der Veanlassung [3]. Ähnlich den pa--in Verben {7-4.1 (3)} sind Veranlasser (Objunkt) und ausführender Täter (Subjekt) die Argumente. Als weiteres Argument kann das "echte" Objunkt des Verbs hinzukommen [3].
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| [1*] Ohne -in Verb in der Wortfamilie | |||||
| pag--in | pagbutihin paghambingịn pagpalain ⬧ pagsamahin pagtibayin | . | ft|fg | . | . |
| [2*] Mit -in Verb in der Wortfamilie | |||||
| pag--in | pag-isahịn pagkiskisịn | . | ft|fg | . | . |
| [3*] Modalität der Veranlassung | |||||
| pag--in | pagsabihin | . | fg|fh | . | . |
(3) Eine besondere Stellung nehmen die (selten gebrauchten) mit papag--in gebildeten Formen ein [4] {7A-511}.
|
(1) Die Affixkombination pag--an bildet Passivverben. Eine Gruppe dieser Verben sind semantische Verstärkungen von -in Verben [1a|b], sie besitzen daher eine {DB10/ft|fg} Syntax. Einige dieser Verben werden gebildet, obwohl die Wortfamilie kein -in Verb besitzt [2].
Ein zweite Gruppe hat K-Fokus {DB../fK} [3]. Sie können ein einfaches -an Verb ersetzen (Beispiel pagsalitaạn ↔ salitaan ist ein Substantiv) oder neben dem einfachen -an Verb verwendet werden (masdạn ↔ pagmasdạn).
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| [1*] Verben mit Tatobjektfokus und mit -in Verb in der Wortfamilie | |||||
| pag--an | pag-aralan pag-isipan pagsisihan | . | ft|fg | . | . |
| [2*] Verben mit Tatobjektfokus und ohne -in Verb in der Wortfamilie | |||||
| pag--an | pagbigyạn (1) pag-ukulan pag-usapan | . | ft|fg | . | . |
| [3*] Verben mit K-Fokus | |||||
| pag--an | paglingkurạn pagmasdạn pagmulạn pagsabihan pagsalitaạn pagsilbihạn | . | fK|fg | . | . |
| pagbawalan | . | . | fp|fg|ft | fp|fg|ft | |
| pagbigyạn (2) | . | . | . | fp|fg|ft | |
(1) Wie die i- Verben besitzen auch die ipag- Verben eine große syntaktische Diversität, am häufigsten ist Tatobjektfokus [1a]. In einigen Wortfamilien ersetzt das ipag- Verb das einfache Passivverb (ipagbawal ). Eine Anzahl von ipag- Verben besitzt K-Fokus [2] und einige davon zwei Objunkte [2c] {DB20/fK|fg|ft}. Verben mit Präfix ipag- unterscheiden sich häufig syntaktisch und semantisch von dem einfachen i- Verb der Wortfamilie [2a|b].
Einige ipagpa- Verben werden gebildet.
|
| Affix | Verben | DB10 | DB11 | DB20 | |
| [1*] Verben mit Tatobjektfokus | |||||
| ipag- | ipagbawal ipagpalagạy ipagpatuloy | ft|fg | . | . | |
| ipagsabị ipagtapạt | . | ft|fg|fp | . | ||
| ipag--an | ipagpilitan | ft|fg | . | . | |
| ipagpa- | ipagpaliban | ft|fg | . | . | |
| [2*] Verben mit A-Fokus | |||||
| ipag- | ipaglaban | fn|fg | . | . | |
| ipagbalot ipagluto ipagtahị ipagpatahị |ipag+patahi| ipagpatayọ |ipag+patayo| | . | . | fp|fg|ft | ||
(2) Einige Verben mit Affixkombination ipagpa- sind als Ableitungen zu betrachten; das Präfix pa- gehört zum Stammwort, und daher sind diese Verben ipag- Verben (Beispiel ipagpatayọ |ipag+patayo|).
Die mapạg- [1a 1b], mapạg--an [2] und maipag- Verben [3] besitzen die Modalität der Fähigkeit (in [1b] Fähigkeit der Veranlassung wie in {7-5.1 (2)}). Einige dieser Verben haben entsprechende pag--in, pag--an und ipag- Verben.
|
| Affix | Verben | DB10 | DB11 | DB20 |
| mapạg- | mapạghulo mapạgsama mapạgtantọ | ft|fg | . | . |
| mapạg--an | mapạg-aralan mapạghandaạn mapạgsabihan mapạgtiwalaan | ft|fg | . | . |
| mapạgdaanạn | fn|fg | . | . | |
| maipag- | maipagkailạ maipagtapạt | ft|fg | . | . |
Selten werden mapag- und mapag--an Passivverben mit [1] oder ohne [2] Modalität des Zufalls gebildet.
|
Ebenso wie das Affix pag- kann pang- (bzw. pam- oder pan- {7A-121}) nicht allein verwendet werden, um Verben zu bilden. Es wird mit den Affixen i-, -an oder -in zu (einigen wenigen) Passivverben kombiniert. Das Präfix ma- kann vorangestellt werden, um die Modalität der Fähigkeit anzuzeigen.
Mit pang- werden in der Affixkombination makapang- Aktivverben gebildet {7-3.4}. Hinzu kommen Verben wie makipangagaw und magpangagawan. mapạng- Verben (in Analogie zu mapạg- Verben) werden nicht gebildet, da diese Affixkombination für Adjektive verwendet wird (mapạng-akit).
Bei einer Gruppe der ipang- Verben besteht eine Verbindung zu mang- Aktivverben [1a|b]. Die zweite Gruppe besitzt Werkzeugfokus [2a], zu ihnen passen pang- Substantive und Adjektive [2b]. Diese ipang- Verben können als i- Verben betrachtet werden (ipambalot |i+pambalot|).
Die maipang- Verben besitzen die Modalität der Fähigkeit.
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| [1*] Verbindung zu mang- Aktivverben | |||||
| ipang- | ipanganạk ipamahagi ipamigạy | ft | ft|fg | . | . |
| maipang- | maipamahagi | . | ft|fg | . | . |
| [2*] Werkzeugfokus | |||||
| ipang- | ipambalot | fm | fm|f.. | . | . |
In der kleinen Gruppe der pang--an Passivverben zeigt das Präfix pang- kaum Besonderheiten an [1]. Die Wortfamilie besitzt ein mang- Aktivverb.
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| pang--an | pangalagaan pamahalaan | . | fp?ft|fg | . | |
| panggalingan | . | fn|fg | . | . | |
| mapang--an | mapaniwalaan mapangatwiranan ⬧ | . | ft|fg | . | . |
Die Gruppe der pang--in Passivverben ist klein [1a]. In ihren Wortfamilien ist ein mang- Aktivverb enthalten [1b].
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_13.html
Die mit dem Bestimmungswort sa zusammengesetzten Präfixe isa- und magsa- bilden Verben mit einer Richtungsangabe im direkten oder übertragenenen Sinn, die im Wortstamm ausgedrückt wird. Die isa- Passivverben haben Tatobjektfokus [1], die magsa- Aktivverben haben für das Tatobjekt ein Objunkt [2]. Es gibt also weder lokativen Fokus, noch lokative Funktion.
|
| Affix | Verben | DT00 | DT10 | DB00 | DB10 |
| isa- | isaayos isagawạ isakatuparạn isauli | . | . | ft | ft|fg |
| maisa- | maisaalang-alang | . | . | . | ft|fg |
| magsa- | magsagawạ magsaulo | . | fg|ft | . | . |
Eine Anzahl isa- Verben sind von ka--an Substantiven abgeleitet (Beispiel isakatuparạn |isa+katuparan|). Das Verb isailalim betrachten wir als ein einfaches i- Verb |i+sailalim|.
(1) Mit dem Präfix ka- werden Affixkombinationen gebildet, deren Passivverben Ursachefokus haben [1a 1b]. Das Affix ika- kann zu ka- verkürzt werden [1c]. Einige ka--an und ka--an Verben haben Tatobjektfokus [2a]. ka--an und ka--an Verbformen werden gern als substantivische oder adjektivische Partizipien verwendet [2b].
|
| Affix | Verben | DB00 | DB10 | DB11 | DB20 |
| [1*] Verben mit Ursachefokus | |||||
| ka--an | katakutan katuwaạn | . | fs|fg | . | . |
| ika- | ikatakot | . | fs|fy | . | . |
| ikabuhay {*} ikagalit ikatuwạ | . | fs|fg | . | . | |
| ikapạg- | ikapạg-antọk ⬧ ikapạg-away ⬧ | . | fs|fg | . | . |
| ikang- | ikamatạy | . | fs|fg | . | . |
| ipagkang- | ipagkanggagalit ⬧ ipagkamatạy ⬧ | . | fs|fg | . | . |
| [2*] Verben mit Tatobjektfokus | |||||
| ka--an | kabakasạn kagalitan | . | ft|fg | . | . |
| ka--an | kabukasan {*} kahinatnạn {*} kagisnạn katayuạn {*} kaupuạn {*} | . | ft|fg | . | . |
| {*} Wird nur oder vorwiegend als substantivisches Partizip und nicht als Verb verwendet. | |||||
(2) Die von ka- Substantiven abgeleiteten Verben betrachten wir nicht als ka- Verben (Beispiel kausapin {DB10/fp|fa} |kausap+in|).
(1) Mit mag- werden Affixkombinationen gebildet. Sie sind Aktivverben, und mag- ist das erste Präfix des Verbs. Die häufig gebildeten magpa- Verben haben der Modalität der Veranlassung {7-4.1}. Die magsa- Verben sind in {7-7.1} behandelt. Viele der selteneren und im Folgenden beschriebenen Verben besitzen weder Objunkt noch Adjunkt, gehören also der Klasse {DT00} an.
(2) Es gibt Verben mit Präfix mag- und Suffix -in. Sie sind jedoch keine mag--in Verben, sondern von Adjektiven mit Suffix -in abgeleitete mag- Verben. Beispiele: mag-alanganin (von Adjektiv alanganin), maglambitin (von Adjektiv lambitin (bitin)).
(1) Die magka- Aktivverben mit unbetontem Präfix zeigen einen Besitz an [1a 1b]. Sie besitzen nur dann ein Objunkt, wenn das Verb den Besitz noch nicht vollständig beschreibt [1b].
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| magka- | magkasakịt | fg | . | . | . | ||
| magkaanạk | fg | . | fg|ft | . | |||
| magkaroọn | . | . | fg|ft | . | |||
(2) Die magka- Aktivverben mit betontem Präfix zeigen das Ergebnis eines oft zufälligen Vorgangs an [2], sie besitzen in der Regel weder Objunkte noch ein Adjunkt.
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| magka- | magkaibạ | fy | fy|ft | fy|ft | . | ||
| magkaisạ magkasundọ | fg | . | . | . | |||
(3) Eine kleine Gruppe von magka--an Verben hat reziproken Fokus (Beispiel magkabalikạn).
(4) Mit magkạng- werden Aktivverben gebildet [3a]. Sie besitzen bereits im Infinitiv eine unbetonte Doppelung der ersten Stammsilbe. Im Präsens und Futur (beide werden selten gebildet) kommt eine weitere Doppelung des Präfixes hinzu zu nagkakang- oder magkakang- [3b].
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| magkạng-&- | magkạng-aantọk ⬧ magkạmbabali ⬧ magkạndarapa magkạngsisigạw ⬧ magkạngtatakbọ ⬧ | fg | . | . | . | ||
Mit der Affixkombination mag--an werden Aktivverben gebildet, die eine gemeinsame oder gegenseitige Tätigkeit ausdrücken [1]. Sie besitzen reziproken Fokus {DT../fr}.
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| mag--an | magmahalan {*} magtulungạn {*} | fr | . | . | . | ||
| {*} !! Verb mit Unregelmäßigkeiten in der Betonung. | |||||||
Die mag-um- Aktivverben drücken aus, dass eine Tätigkeit ernsthaft oder ausdauernd durchgeführt wird [1]. Morphologisch wird zunächst ein -um- Verb gebildet, dem das Präfix mag- vorangestellt wird.
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | ||
| mag-um- | magpumiglạs magpumilịt | fg | . | . | . | ||
| mag-umapaw | fg | fg|fs | . | . | |||
Mit dem zusammengesetzten Präfix magpaka- werden Aktivverben gebildet, die eine Anstrengung beschreiben, um den Wortstamm zu erreichen.
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 |
| magpaka- | magpakababa magpakabuti | fg | . | . | . |
| magpakalunod | . | fg|fn | . | . | |
Die filipinische Sprache besitzt Pluralverben. Aktivverben mit Infix -um- und Präfix ma- bilden Pluralverben mit Präfix magsi- [1a|b], desgleichen mag- Verben mit Präfix magsipag- [2a|b] und mang- mit magsipang-. Diese Pluralverben sind als veraltet zu betrachten und werden hier nicht weiter behandelt.
|
Weitere Pluralverben werden mit manga- und mangag- gebildet (abgeleitet
von ma- und mag- mit einem Infix -ang-), Beispiele
mangatuwạ und mangagtawạ {![]() VCS manga-};
jedoch mangahulugạn
|mang+kahulugan|.
VCS manga-};
jedoch mangahulugạn
|mang+kahulugan|.
Die maki- Verben zeigen keine sichtbare Verbindung zu anderen ma- Verben. Affix ki wird nur dort (und in dem Allomorph paki-) als Verbaffix verwendet. Deshalb betrachten wir maki- als ein eigenständiges Präfix und behandeln es gesondert. Mit paki- werden keine Verben mit vollständiger Flexion gebildet, wir sprechen daher von paki- Verbformen.
Das Präfix maki- bildet Aktivverben. In vielen Fällen drücken maki- Verben die Teilnahme an etwas aus [1a]. Hierzu gehören auch die Affixkombinationen makipạg- und makipạg--an [1b 1c]. Eine zweite Gruppe von maki- Verben drückt eine Bitte aus [2]. Diese Aktivverben entsprechen den paki- Passivverbformen {7-9.2}.
|
| Affix | Verben | DT00 | DT01 | DT10 | DT11 | |
| [1*] Teilnahme | ||||||
| maki- | makialạm | . | fg|ft | . | . | |
| makiramay | . | fg|fp | . | . | ||
| makibagay makihalubilo makisama | . | fg|fr | . | . | ||
| makipạg- | makipạg-away makipạglaban | fg | fg|fr | . | . | |
| makipạgkita makipạg-usap | . | fg|fr | . | . | ||
| makipạg--an | makipạg-ugnayan | fr | fg|fr | . | . | |
| [2*] Bitte | ||||||
| maki- | ||||||
| makiusap | . | . | . | fg|ft|fp | ||
(1) paki- ist ein Präfix, mit dem Passivverbformen gebildet werden, die Bitten ausdrücken. Verwendet wird nur der Infinitiv in Imperativsätzen, ein Flexionsparadigma besteht nicht.
Es gibt eine regelmäßige Syntax, die der eines entsprechenden -in Passivverbs ohne paki- gleich ist [1a|b 1c]. Häufig wird jedoch eine besondere Syntax verwendet. Die erbetene Sache wird als Objunkt gesetzt, der Satz ist dann subjektlos [1d 1e]. In beiden Formen kann auf die Angabe der Person, die um etwas erbeten wird, verzichtet werden [1c 1e]. Bestimmte Passivverben mit den Affixen -an und i- können entsprechende Formen mit den Affixen paki--an [2a|b] und ipaki- bilden [3a|b], um eine höfliche Bitte auszudrücken. Auch hier wird nur der Infinitiv gebildet.
|
(2) Nur schwer zu unterscheiden von paki- Verbformen sind mit paki- gebildete Substantive. Von diesen können -an Verben gebildet werden, die dann zufällig die Affixe paki--an besitzen. Diese Verben besitzen alle Zeitformen (Beispiel: alam ↔ pakialạm ↔ pakialamạn |pakialam+an|; pakiusapan |pakiusap+an|).
(1) Die paki- Verbformen können verkürzt werden, wobei nur das Präfix pa- verwendet wird. Die meisten pa- Abkürzungen gehören der Umgangssprache an, werden dort sehr häufig verwendet [1a|b]. In der Schriftsprache finden sie sich, von Ausnahmen abgesehen, nicht. Im Allgemeinen werden die besonderen Formen ohne Angabe der Person in subjektlosen Sätzen verwendet [1b]. Häufig werden auch verkürzte Sätze gebildet, die nur aus einer pa- Form bestehen [2]. Einige pa- Kurzformen werden gebildet, obwohl keine paki- Form vom Verb gebildet wird [3a|b].
|
(2) Das Präfix pa- wird ebenfalls als Verkürzung der Präfixe magpa-, pa--in und ipa- verwendet {7-4.3}. Von den pa- Verbformen sind mit pa- gebildete Adjektive und Adverbien zu unterscheiden, die keine Bitte ausdrücken (pauwị {U}, palagi {A}).
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_14.html
(1) Nomina (ngalan) sind Substantive (Schlüssel {N}, pangngalan) und Pronomen (Schlüssel {H}, panghalịp). Substantive sind Inhaltswörter, Pronomen sind in der Regel Inhaltswörter, können sich jedoch wie enklitische Kurzwörter verhalten.
Filipinische Substantive besitzen keine Eigenschaften, die sie deutlich von anderen Wortarten unterscheiden. Eindeutig den Substantiven zuzuordnen sind:
Insbesondere gibt es Abgrenzungsprobleme zu Adjektiven ({9-1 (3)}, auch bei Farben und Numeralien) und Adverbien, aber auch zu Partizipien und anderen Verbformen (Beispiele: inihaw, pakiusap, sabi).
Gerundien verhalten sich syntaktisch wie Substantive; Partizipien können substantivisch verwendet werden.
(2) In unserem Strukturmodell ist die Nominalphrase {*} (Schlüssel {P-N}, pariralang makangalan) die Inhaltsphrase, die ein Nomen als Kernwort besitzt. Sie ist die einzige Inhaltsphrase, die zusammen mit allen sechs Funktionsphrasen Phrasen bildet. Die Nominalphrase kann das Prädikat oder Subjekt eines Satzes bilden. Sie ist als Objunkt, Adjunkt und Subjunkt Argument von Verben oder Attribut von Substantiven. Als disjunktive Nominalphrasen bezeichnen wir Nominalphrasen, die unabhängig im Satz stehen.
{*} Nach unserem Verständnis sollte die Inhaltsphrase, die ein Nomen als Kernwort besitzt, Nomenphrase heißen. Trotzdem belassen wir es bei der traditionellen Bezeichnung Nominalphrase.
In knapp der Hälfte der filipinischen Wortfamilien ist das Stammwort ein Substantiv. Die Mehrzahl der Substantive sind jedoch durch Affigierung abgeleitet. Seltener sind durch Zusammensetzung gebildete Substantive.
| Häufige Substantive ohne Affixe (Stammwörter) | |||||
| bahay | bansạ | buhay | isip | sagọt | taọn |
(1) Die filipinische Sprache besitzt eine große Anzahl von Affixen, mit denen Substantive gebildet werden. Mit vielen dieser Affixe werden auch Verben, Adjektive und Adverbien gebildet. In einigen Fällen ist eine Abgrenzung zwischen Substantiv und Gerundium nahezu unmöglich.
| Affixe von Substantiven | |||||
| -an (2) | i- (2) | -in (2) | |||
| ka- (1) | ka-&- (5) | ka--an (ka- (10)) | |||
| ka-&--an (ka- (11)) | kapa--an (ka- (14)) | kapang--an (ka- (15)) | |||
| kina--an (ka- (16)) | mag- (2 3) | mag-&- (5) | |||
| mang-&- (2) | may- | pa- (6) | |||
| pa-&- (10) | pa--an (pa- (12)) | pagka- (pag- (7)) | |||
| pagkaka- (pag- (11)) | pagkama- (pag- (7a)) | pagkang- (pag- (7b)) | |||
| paki- (2) | pala--an (pala- (2)) | pampa- (pang- (9)) | |||
| pang- (1) | pang--an (pang- (5)) | pang--in (pang- (7)) | |||
| pinaka- (1) | sang- | tag- | |||
| taga- (1 2) | tagapag- (taga- (3)) | ||||
(2) Zu erwähnen sind die spanischen Lehnaffixe -era, -ero und -deryạ, die auch mit filipinischen Wortstämmen verbunden werden (pakialamero, karinderyạ). Mit den Suffixen -ay und -oy werden Koseformen von Namen gebildet (Tinay, Totoy, Pinọy). Diese sind geschlechtsspezifisch, was möglicherweise auf spanischen Einfluss hindeutet.
Zusammengesetzte Substantive (Schlüssel {N/Tb}, pangngalang tambalan) können mit, aber auch ohne Ligatur gebildet werden, wobei in der Regel die -ng Form verwendet wird [1] , während das Wort na weggelassen wird [2 3]. In einigen Fällen wird ein Bindestrich gesetzt [1 2 5]. Entsprechend dem Prinzip der Rechtsverzweigung {1-5.4} ist das Grundwort (Gattungswort, salitạng batayạn) der erste Bestandteil, dem das Ergänzungswort (salitạng nagtuturing) folgt. Daneben gibt es Zusammensetzungen von Substantiven mit vorangestelltem Adjektiv [4], wobei die Ligatur entfällt. Stammdoppelung ist eine weitere Methode der Bildung von Substantiven [5].
| |||||||||||||||||||
Hier betrachten wir einige Wörter, die wir zu den Substantiven zählen, obwohl diese Zuordnung nicht zwingend ist.
(1) In Filipino wird kaum zwischen Geschlechtern unterschieden (kasarian = Genus [nominis]), alle Nomina sind geschlechtsneutral (walạng kasarian) in morphologischer Sicht, das gilt auch für die meisten Personen und Tiere (pịnsan). Nur eine Anzahl Substantive, jedoch keine Pronomen sind semantisch-lexikalisch männlich oder weiblich (amạ, inạ).
(2) Spanische und andere Lehnwörter können männliche und weibliche Formen haben: Pilipino - Pilipina {N/Es}, ingkọng - impọ {N/Ch}. Bei einigen spanischen Lehnwörtern wird die weibliche Form in Filipino für beide Geschlechter verwendet (Beispiel: dentịsta {N/Es}).
(1) Filipinische Substantive sind in der Regel numerusneutral [1]
{8A-321 ![]() }. Eine Pluralanzeige wird nicht vorgenommen, wenn der Numerus aus dem
Sinnzusammenhang deutlich erkenntlich ist [2b 3]. Trotzdem unterscheidet die Sprache zwischen
verschiedenen Numeri (kailanạn),
in erster Linie zwischen Singular und Plural
(isahan und
maramihạn), in einigen
Fällen gibt es einen Numerus Dual (dalawahạn).
}. Eine Pluralanzeige wird nicht vorgenommen, wenn der Numerus aus dem
Sinnzusammenhang deutlich erkenntlich ist [2b 3]. Trotzdem unterscheidet die Sprache zwischen
verschiedenen Numeri (kailanạn),
in erster Linie zwischen Singular und Plural
(isahan und
maramihạn), in einigen
Fällen gibt es einen Numerus Dual (dalawahạn).
Der Singular kann angezeigt werden durch
Der Plural kann angezeigt werden durch:
|
(2) Bei Personalpronomen besteht eine strenge Trennung zwischen Singular und Plural, ebenso bei den Artikeln si/sinạ. Demonstrativpronomen sind numerusneutral, mit mga können Pluralformen gebildet werden {8-4.2 (3)}. Interrogativa sind ebenfalls numerusneutral, besitzen jedoch besondere Pluralformen, die durch Stammdoppelung gebildet werden {12-2.1 (1)}.
Pronomen ersetzen Phrasen mit Substantiven; daher sind sie in der Regel Inhaltswörter. Andererseits können Pronomen enklitisches Verhalten annehmen, dann sind sie Kurzwörter {11-4}. Wir bezeichnen Pronomen (panghalịp) mit dem Schlüssel {H}.
In den folgenden Abschnitten betrachten wir Personal-, Demonstrativ- und Indefinitpronomen, während Interrogativpronomen in {12-2.1} behandelt werden. Die filipinische Sprache besitzt keine gesonderten Possessivpronomen, für Besitzbeziehungen werden die NG- und SA-Pronomen verwendet {8-4.7}. Ebenso gibt es keine Relativpronomen und -sätze (panghalịp na pamanggịt), stattdessen wird die Ligatur in Ligatursätzen verwendet. Wir verwenden den Begriff Reflexivpronomen nicht (panghalịp na pasarili); das Wort sarili ist für uns Substantiv oder Adjektiv.
Paradigma der Pronomen → {8A-401 Θ}
(1) Die filipinischen Personalpronomen (Schlüssel {HT}, panghalịp na panao [tao]) besitzen drei Personen (panauhạn). Diese sind Sprecher (nagsasalitạ), Angesprochener (kinakausap) und Dritter (pinag-uusapan); jeweils in Singular und Plural (Schlüssel {HT/1I} bis {HT/3M}, isahan, maramihạn). Für die zweite Person Singular {HT/2I} gibt es eine Vollform ikạw und eine enklitische Kurzform ka für das Subjekt. tayo {HT/lM} schließt den Angesprochenen ein, während kamị ihn ausschließt. Als Höflichkeitsformen werden kayọ {HT/2M} oder silạ {HT/3M} verwendet, dem deutschen 'Sie' vergleichbar. Veraltet ist das Dualpronomen katạ 'wir beide'.
| Sprecher | Angesprochener | Dritter | |
| 1. Person | 2. Person | 3. Person | |
| Singular | akọ
{HT/1I} |
ikạw, ka {HT/2I}, {HT/2I/HG} | siyạ
{HT/3I} |
| Plural | tayo {HT/1M} |
kayọ {HT/2M} |
silạ {HT/3M} |
| kamị {HT/1M} | |||
(2) Personalpronomen werden für Personen verwendet. Das Personalpronomen siyạ {HT/3I} ist geschlechtsneutral, es kann also nur eine Person mit siyạ bezeichnet werden, für weitere Personen sind Demonstrativpronomen zu verwenden [1]. Pluralformen der Personalpronomen können durch Objunktphrasen ergänzt werden, um die Teilnehmer genauer zu beschreiben [2].
|
(3) Personalpronomen werden, wenn möglich, am Satzende vermieden. Dies gilt für Argumente von Verben (Subjekt und Objunkt), strenger für einsilbige als für zweisilbige Pronomen, jedoch nicht für Attribute zu Substantiven. Dazu bieten sich folgende Möglichkeiten an.
| |||||||||||||||
(1) Es gibt drei 'Entfernungen' der filipinischen Demonstrativpronomen (panghalịp na pamatlịg [patlịg], ähnlich den drei Personen der Personalpronomen). Sie bezeichnen etwas nahe beim Sprecher, nahe beim Angesprochenem oder entfernt von Sprecher und Angesprochenem (Schlüssel {HP/1} bis {HP/3}).
| Nahe Sprecher 1. Entfernung |
Nahe Angesprochenem 2. Entfernung | Entfernt 3. Entfernung |
| itọ {HP/1} |
iyạn {HP/2} | iyọn, yaọn
{HP/3} |
(2) Demonstrativpronomen können pronominal für Personen oder Sachen stehen [1a 1b]. Für Personen werden Demonstrativpronomen gern verwendet, um weitere Personen zu bezeichnen, da die filipinische Sprache nur ein Personalpronomen dritte Person Singular besitzt [2]. Für Nicht-Personen sind Demonstrativpronomen nahezu zwingend, da für sie Personalpronomen nicht verwendet werden [3].
|
(3) In der Regel sind Demonstrativpronomen numerusneutral. Wird das Demonstrativpronomen 'pro nomen' (d.h. nicht attributiv (4)) verwendet, kann eine Pluralform mit dem vorangestellten Artikel mga gebildet werden [3-6].
|
(4) Demonstrativpronomen können attributiv als Adjektive verwendet werden [7] {8-7.3}. Weiterhin gibt es von Demonstrativpronomen abgeleitete Adjektive {9-2.3} und die Interjektionen eto, heto, ayạn, hayạn, ayụn, hayụn 'Hier! Dort!'.
Zum Demonstrativpronomen iyọn {PD/3} gibt es eine Nebenform yun (itọ), die in der Umgangssprache häufig verwendet wird, attributiv [8a 8b] und prädikativ [9]. Mit yun werden (unbedeutende) Dinge beschrieben [8a], für Personen ist es nicht sehr höflich [8b 9].
|
Das Pronomen irị, irẹ (statt itọ) ist veraltet (bzw. eine Dialektform in der Provinz Batangas). Es kommt z.B. im Werkstatt-Korpus nicht vor gegenüber zweihundert Mal itọ.
(1) Mit Hilfe der Konjunktionen kung, kahit und man werden aus Interrogativa unbestimmte Mengenbegriffe (Indefinita) {8A-4311}. Während kung [1] und kahit [2] vorangestellt werden (wie die meisten Konjunktionen), ist man ein enklitisches Kurzwort [3]. Häufig werden die mit kahit und man gebildeten Konjunktionssätze stark verkürzt. Die mit kung, kahit und man gebildeten Ausdrücke haben nahezu die gleiche Bedeutung. Sie werden nur verwendet, wenn das Vorhandensein an sich nicht in Frage steht [1|6].
|
(2) Die in diesen Gebilden verwendeten Interrogativa verändern ihre semantische Funktion vom Frage- zum indefiniten Aussagewort. Die Wortart wird nicht verändert; es werden Indefinitpronomen [1-3] {8-4.3.2}, Indefinitadjektive [4 6] {9-2.4} und Indefinitadverbien [5] {9-4.3.3} gebildet.
(1) Interrogativpronomen können zu Indefinitpronomen (Schlüssel {HS}, panghalịp na panaklạw [saklạw]) gewandelt werden. Dies geschieht mit den Konjunktionen bzw. Adverbien kahit, man und kung.
Wenn ein Infinitpronomen das Subjekt ist, kann ang stehen oder auch nicht [1|2]. ng steht häufiger [3a], da Zusammensetzungen mit nino ungern verwendet werden [3b]. Für Adjunkte werden die Pronomen kanino oder saạn verwendet [4]. In [5] ist eine Existenzphrase mit Indefinitpronomen das Prädikat. Indefinitpronomen können attributiv verwendet werden [6-8].
|
Entsprechend den Phrasen, die Pronomen ersetzen, haben Personal- und andere Pronomen verschiedene Formen, die ANG-, AY-, NG- und SA-Pronomen genannt werden.
Für Prädikat und Subjekt werden die gleichen Pronomen verwendet (mit Ausnahme von ikạw - ka). Wir können daher von ANG-AY-Pronomen oder kurz ANG-Pronomen sprechen. Dies sind die Grundformen, ihr Schlüssel wird nicht besonders gekennzeichnet. Für die Formen siehe die Tabelle {8-5}.
Die mit mga gebildeten Pluralformen der Demonstrativpronomen sind ANG-Pronomen, Objunkt- und Adjunktphrasen werden mit ihren Bestimmungswörtern gekennzeichnet [1] {11-2 (2)}.
|
Bei Interrogativpronomen gibt es keine ANG-Pronomen, sondern nur AY-Pronomen {12-2.1}.
(1) Personal- und andere Pronomen haben besondere Formen, die als Objunktphrase verwendet werden. Wir nennen diese Formen NG-Pronomen (Schlüssel {TW.H..}), sie sind in der Tabelle {8-5} den anderen Formen gegenübergestellt.
| NG-Pronomen | |||||
| ko | mo | niyạ | |||
| natin namin | ninyọ | nilạ | |||
| nito | niyạn | niyọn | |||
In Verbindung mit NG-Pronomen steht das Wort ng nicht. Man kann sagen, dass die Grundform des Pronomens morphologisch mit dem Wort ng verschmolzen ist. Zumindest besitzen 8 von 10 Formen ein n als Anlaut, das in der Grundform nicht vorkommt.
Wie andere Objunktphrasen werden NG-Pronomen als Argument [1] und Attribut [2] verwendet, sie zeigen nachlaufendes Verhalten. Sie können einen Objunktinterklit bilden [3].
|
(2) Weiterhin ist das Dualpronomen
kitạ {HT/21I} zu erwähnen, das an Stelle
von ko ka tritt [5]. Es ersetzt also zwei Personalpronomen im Singular,
die Objunkt und Subjekt sind; es bildet eine Dualphrase bzw. ein Dualkurzwort im Interklit.
|
(1) Pronomen haben besondere Formen, die SA-Pronomen genannt werden. Sie sind in der Tabelle {8-5} den anderen Formen gegenübergestellt. SA-Pronomen sind Inhaltswörter.
| SA-Pronomen | |||||
| akin | iyọ | kanyạ, kaniyạ | |||
| atin amin | inyọ | kanilạ | |||
| dito | diyạn | doọn | |||
(2) Die SA-Personalpronomen {HT/K)} werden als Inhaltsphrase in Adjunktphrasen mit dem Bestimmungswort sa verwendet {P-K=P-N(HT/K)}. Auf diese Weise werden Adjunkte als Argumente von Verben gebildet [1]. Diese Adjunkte werden ebenfalls als Attribut zu einem Substantiv verwendet [2] oder als Attribut in der Präpositionalphrase [3]; weiterhin als unabhängiges Adjunkt [4] und als Prädikat [5].
|
(3) SA-Personalpronomen werden attributiv in Subjunktphrasen verwendet {U//HT/K}. In Possessivbeziehungen {8-4.7} ist das SA-Personalpronomen ein vorangestelltes Adjektiv mit Ligatur; das Gebilde ist ein Subjunkt [6]. Dieses Adjektiv / Pronomen kann als Interklitbezugswort dienen [7]. In [8] ist das SA-Pronomen als Argument des Verbs magịng ein Subjunkt ohne Ligatur. Eine Ausnahme ist das Gebilde mit nachgestelltem Adjektiv/Pronomen (ganạn [9]).
|
(4) Als "echtes" Pronomen {HT/K} kann das SA-Pronomen das Prädikat bilden [10].
|
(5) Wie die SA-Personalpronomen verhält sich das SA-Interrogativpronomen kanino [11-13] {HN/K}.
|
(6) Die SA-Demonstativpronomen sind Adjunktphrasen, auch wenn sie kein Bestimmungswort sa erhalten (Schlüssel {TK.HP}; ähnlich den NG-Pronomen {8-4.5}). In der Regel haben sie lokative Funktion [14] (und werden deshalb oft zu den Adverbien gezählt); sie werden jedoch auch in nicht lokativer Funktion als Argument eines Verbs verwendet [15]. Entsprechend ist das Verhalten des SA-Interrogativpronomens saạn [16] (Schlüssel {TK.HN}).
|
(7) Veraltet ist der Gebrauch von SA-Personalpronomen mit nasa. SA-Demonstrativpronomen werden nicht mit nasa verwendet.
(1) SA- oder NG-Personalpronomen werden verwendet, um attributiv Possessivbeziehungen auszudrücken. Die filipinische Sprache besitzt keine besonderen Possessivpronomen (panghalịp na paari). SA-Pronomen werden vor das Bezugswort gestellt [1]. Nachlaufend sind NG-Pronomen; sie stehen nach dem Bezugswort oder bilden einen Objunktinterklit [2 3].
In der Umgangssprache werden vorwiegend die nachgestellten NG-Pronomen verwendet. In der gehobenen Schriftsprache werden die vorangestellten SA-Pronomen bevorzugt.
|
(2) Objunktphrasen können nicht erfragt werden {12-4.3}; also auch nicht NG-Pronomen. Zur Erfragung der Besitzbeziehung wird das SA-Pronomen kanino verwendet [4a]. SA- oder NG-Pronomen können als Antwort dienen [4b-d].
NG-Demonstrativpronomen werden ebenfalls in Possessivbeziehungen verwendet [5 6].
|
(3) Adjektivisch werden einige SA-Personalpronomen verwendet (auch mit Stammdoppelung), um Reflexivbeziehungen anzuzeigen [7 8].
|
| Subjekt | Prädikat | Objunkt | Adjunkt | |||
| Best.Wort {11-2} | ang | ay | ng | sa | ||
| Artikel {8-6.2} |
M | ang mga | {ay} mga | ng mga | sa mga | |
| Pers. | I | si ang .. si |
{ay} si {ay} .. si | ni ng .. si |
kay sa .. si | |
| M | sinạ ang .. sinạ |
{ay} sinạ {ay} .. sinạ | ninạ
ng .. sinạ |
kinạ sa .. sinạ | ||
| Personal- pronomen {8-4.1} | 1 | I | akọ | {ay} akọ | ko | {sa} akin |
| 2 | I | ka ikạw | {ay} ikạw | mo | {sa} iyọ | |
| 21 | I I | kitạ | ||||
| 3 | I | siyạ | {ay} siyạ | niyạ | {sa} kanyạ | |
| 1 | 2 | katạ | {ay} katạ | nitạ | {sa} kanitạ | |
| 1 | M | tayo | {ay} tayo | natin | {sa} atin | |
| 1 | M | kamị | {ay} kamị | namin | {sa} amin | |
| 2 | M | kayọ | {ay} kayọ | ninyọ | {sa} inyọ | |
| 3 | M | silạ | {ay} silạ | nilạ | {sa} kanilạ | |
| Demonstrativ- pronomen {8-4.2} |
1 | - | itọ | {ay} itọ | nito | dito |
| M | ang mga itọ | {ay} mga itọ | ng mga itọ | sa mga itọ | ||
| 2 | - | iyạn | {ay} iyạn | niyạn | diyạn | |
| M | ang mga iyạn | {ay} mga iyạn | ng mga iyạn | sa mga iyạn | ||
| 3 | - | iyọn yaọn |
{ay} iyọn {ay} yaọn | niyọn niyaọn | doọn | |
| M | ang mga iyọn | {ay} mga iyọn | ng mga iyọn | sa mga iyọn | ||
| Interrogativ- pronomen {12-2.1} | Pers. | - | --- | sino | nino | {sa} kanino |
| M | sinu-sino | ninu-nino | {sa} kani-kanino | |||
| Dinge | - | anọ | --- | saạn | ||
| M | anụ-anọ | saạn-saạn | ||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_N.html
Häufig sind Pronomen der einzige Bestandteil der Nomialphrase [1]; es gibt jedoch eine Pluralform des Demonstrativpronomens [2]. Es werden auch Verbindungen mit Adjektiven [3] oder Substantiven [4 5] gebildet. Diese Verbindungen erhalten eine Ligatur, wir betrachten sie als attributive Subjunkte.
| |||||||||||||
(1) Unter einem Artikel (Schlüssel {Y}, pantukoy) verstehen wir ein Wort, das stets in Verbindung mit einem Substantiv verwendet wird. In der filipinischen Sprache werden Artikel nur in besonderen Fällen verwendet, sie sind also keine allgemeinen Begleiter von Substantiven. si, mga und sinạ sind die einzigen Artikel der filipinischen Sprache, wir zählen sie zu den Kurzwörtern. Die Artikel sind zusammen mit Pronomen tabellarisch dargestellt in {8-5}.
(2) Die Artikel si/sinạ (Schlüssel {Y/Ta}) stehen vor Personennamen (pangngalang pantangi ng tao), wenn die Person nicht direkt angeredet wird. Im Singular steht si, im Plural sinạ [1b 1a].
Da Personen mit Artikel si/sinạ Bestimmtheit besitzen, entfällt das Bestimmungswort ang, wenn ein Substantiv mit si/sinạ Subjekt ist [1 2a] {*} {2-4.1 (2)}. In Objunkt und Adjunkt werden ng oder sa und si/sinạ zu ni/ninạ und kay/kinạ zusammengezogen [3]. Wenn ein Attribut zwischen Bestimmungswort und Artikel steht, unterbleibt die Zusammenziehung [4 5]. In Prädikat und Subjunkt bleibt si/sinạ zwischen Bestimmungswort und Substantiv stehen [2b 6 7].
{*} {Θ} Das Bestimmungswort ang entfällt, es wird nicht durch den Artikel si "ersetzt"; der Artikel si wird kein Bestimmungswort.
| |||||||||||||||||||
(3) mga ([mʌ'ŋʌ], Schlüssel {Y/M}) ist ein pluralanzeigender Artikel {8-3.2}. Er steht vor Substantiven, substantivisch verwendeten Partizipien und Adjektiven. Dieser Artikel ist ebenfalls proklitisch, steht jedoch nicht immer unmittelbar vor dem Substantiv [10] {8-7.1 (2)}. mga kann ebenfalls mit Demonstrativpronomen verwendet werden [11] {8-4.2 (3)}.
|
(4) Vom Pluralartikel mga ist zu unterscheiden die Verwendung von mga als proklitisches Adverb mit der Bedeutung 'etwa, ungefähr' (mga alas tres) {9-4.2 (2)}.
(1) Häufig wird ein Adjektiv dem Kernwort der Nominalphrase attributiv vorangestellt [1], auch kann die nachgestellte Form gewählt werden [2 3]. Attributive Adjektive werden mit einer Ligatur verbunden, sie bilden Subjunktphrasen. Partizipien können ebenfalls attributiv verwendet werden und verhalten sich dann wie Adjektive [4a 4b] {6-6.4.1}. Interrogativadjektive können als Attribut zu Substantiven verwendet werden [5] {12-2.2}. Gleiches gilt für vorangestellte possessivisch verwendete SA-Pronomen [6] {8-4.7}.
| ||||||||||||||||
(2) In der Regel steht das Adjektiv vor einem Pluralartikel mga [7 8] bzw. das SA-Pronomen [9]. Das Adjektiv kann auch zwischen Pluralartikel und Substantiv gesetzt werden [10 11].
| |||||||||||||
(3) Vorangestellt werden Numeralien, wenn sie Attribut zu einem Substantiv sind [12]. In der Regel wird das Numerale vor andere Adjektive gestellt [13]. Wenn ein Personalpronomen das Kernwort der Nominalphrase ist, wird das attributive Numerale nachgestellt [14].
| |||||||||
(4) Vor dem Substantiv katao (tao) kann die Ligatur entfallen [15a|b], jedoch nicht vor tao [15c|d].
|
(1) Semantisch zeigt das attributiv verwendete Numerale isạ einen Singular an [1], stellt also einen Unterschied zu 'mehreren, vielen' dar (Häufigkeit von isạ {8A-721}). Es schafft wie alle Numeralien ein Maß an Bestimmtheit. In disjunktiven Nominalphrasen findet sich isạ oft als Attribut [2].
(2) isạ wird ebenfalls verwendet, um eine bestimmte, aber unbekannte Person (oder einen Gegenstand) zu beschreiben [3 4]. Es wird dabei an den unbestimmten Artikel der europäischen Sprachen ('ein', spanisch 'un - una - unos - unas' {*}) "angeglichen", den es in der filipinischen Sprache nicht gibt {2A-301 (2)}. isạng findet sich daher häufig im westlichen Stil [5] {13-5.1}.
{*} Wie im Deutschen sind im Spanischen Numerale 'un …' und unbestimmter Artikel gleich.
| |||||||||||||
Die Grundformen der Demonstrativpronomen (ANG-Pronomen) können attributiv gebraucht
werden; sie verhalten sich dann wie Adjektive [1] (Schlüssel {U//HP/1} bis {U//HP/3}). Ein direktes
Zusammentreffen von mga itong … oder itong mga …
usw. wird bei attributivem Gebrauch vermieden. Dann wird das Demonstrativpronomen
nachgestellt [2].
In der gehobenen Umgangssprache und in der Schriftsprache folgen vorangestelltes Demonstrativpronomen nicht unmittelbar auf ang, ng oder sa. Es ist in diesen Fällen die nachgestellte Form zu verwenden [3 4]. Wird umgangssprachlich ein vorangestelltes Demonstrativpronomen im Subjekt verwendet, so entfällt ang [5], vor allem vor yung [6] {8-4.2 (4)}.
| |||||||||||||||
(1) Substantive können der Nominalphrase attributiv beigefügt werden. Dies kann als Objunkt oder Adjunkt geschehen, aber auch als Subjunkt. In allen Fällen gilt das Prinzip der Rechtsverzweigung, bei diesen Subjunkten folgt das beigefügte Substantiv (Ergänzungswort) dem Kernwort (Gattungswort) [1-6].
Es wird wie bei Adjektiven eine Ligatur gesetzt [1-4], wobei jedoch die na Form der Ligatur entfallen kann [5 6]. In [4] wird ein Personalpronomen durch ein Subjunkt ergänzt. Die Gebilde mit halịp sind mehr idiomatisch [7].
| |||||||||||||||||
(2) In [8] ist ebenfalls eine Nominalphrase Attribut zu einem Substantiv, das Gebilde ist jedoch kein Subjunkt.
|
Die Mehrheit der Adverbien (Inhaltswörter) passt schlecht zu Nominalphrasen; nur in wenigen Fällen können sie attributiv verwendet werden [1].
|
(1) Präpositionalphrasen mit nasa [1] und Existenzphrasen [2] können Nominalphrasen ergänzen. Diese Attribute besitzen eine Ligatur, sie sind Subjunkte.
| |||||||
(2) Eine Anzahl Präpositionalphrasen der Gruppe tungkol sind syntaktisch und semantisch einer Nominalphrase zugeordnet. Sie folgen nach den Substantiv und besitzen eine Ligatur [3]. Diese Gebilde mit Ligatur zeigen eine große Nähe des Attributs zum Substantiv an {10-2 (2)}.
| |||||
Die Objunktphrase als Attribut in einer Nominalphrase drückt vorwiegend eine Possessivbeziehung aus [1 2]. Eine weitere Gruppe wird verwendet, um das übergeordnete Substantiv genauer zu beschreiben [3 4] (spezifierendes Objunkt). Nach einem Pluralpersonalpronomen kann ein Objunkt dazu dienen, die beteiligten Personen genauer anzugeben [5].
| |||||||||||||
Häufig sind Adjunkte Argumente von Verben oder unabhängige Phrasen. Außerdem können Adjunktphrasen Attribut zu einem Substantiv sein [1 2]. In vielen Fällen ist das semantische Verständnis eines attributven Adjunkts gleich dem eines Arguments [3a|b].
| ||||||||||||
In unserem Strukturmodell sind Nominalphrasen Inhaltsphrasen, sie können wie folgt dargestellt werden.
| Nominalphrase ist | Nominalphrase enthält | |
| [1] | Subjekt {2-4.1} | |
| [2] | Prädikat {2-4.2} | |
| [3] | Objunkt {3-2.1} | |
| [4] | Adjunkt {4-3.1} | |
| [5] | Subjunkt (Argument von Verb) {6-2.3} | |
| [6] | Subjunkt (Attribut in Nominalphrase) {8-7.4} | |
| [7] | Disjunktive Nominalphrase {5-3.1} | |
| [9] | Kernwort Substantiv | |
| [10] | Kernwort Pronomen {8-6.1} | |
| [11] | Artikel {8-6.2} | |
| [12] | Subjunkt als Attribut: Adjektiv {8-7.1} Demonstrativpronomen {8-7.3} Substantiv {8-7.4} Adverb {8-7.5} Präpositionalphrase {8-7.6} | |
| [13] | Objunkt als Attribut {8-8.1} | |
| [14] | Adjunkt als Attribut {8-8.2} | |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_N_2.html
(1) Im Allgemeinen beziehen Adverbien sich auf Verben und Adjektive auf Nomina {*}. Die Mehrzahl der Adjektive kann als Adverb verwendet werden. Alle Adjektive sind Inhaltswörter und ein großer Teil der Adverbien.
{*} Wir folgen der traditionellen Einteilung in Adjektive und Adverbien. Vermutlich ist es der filipinischen Sprache angemessener, die Inhaltswörter Adjektive und Adverbien von den Kurzwörtern Adverbien zu unterscheiden.
(2) Die Definition der Adjektive (Schlüssel {U}, pang-uri) ist schwierig und nicht immer eindeutig. Jedoch haben größere Gruppen von Adjektiven gemeinsame Merkmale. Als semantische Eigenschaft zeichnet die Komparation einen Großteil der Adjektive aus. Eine weitere große Gruppe sind die ma- Adjektive, die in einem kleinen Paradigma charakteristische Pluralformen besitzen.
Im Strukturmodell sind Adjektivphrasen die Inhaltsphrasen, die ein Adjektiv als Kernwort besitzen. Häufig besteht die Adjektivphrase nur aus dem Adjektiv. Ein Adjektiv kann Inhaltsphrase von Prädikat oder Subjekt sein. Daneben wird es als Attribut in Nominalphrasen verwendet (Subjunkt). Eine Anzahl der Adjektive kommt nur in einer der beiden Funktionen vor.
Die Mehrzahl der Numeralien sind Adjektive.
(3) Schwierig können Adjektive von Substantiven zu unterscheiden sein. Semantisch beschreiben Adjektive eine Eigenschaft. Eine Gruppe von Personen oder Dingen mit einer bestimmten Eigenschaft wird zum Substantiv. Bei Adjektiven wird die Verneinung mit hindị gebildet, bei Substantiven häufig mit walạ.
Die Syntax von Attributen ist gleich, wenn sie von Adjektiven oder Partizipien gebildet werden. Die beiden Gruppen können morphologisch unterschieden werden.
(4) In der filipinische Sprache bilden die Adverbien (Schlüssel {A}) eine sehr inhomogene Wortart. Neben Inhaltswörtern gibt es Kurzwörter als Adverbien. Ferner kann die Mehrzahl der Adjektive als Adverb verwendet werden..
Entsprechend der filipinischen Bezeichnung pang-abay (abay = 'Gefolge, festliche Begleitung') begleitet das Adverb eine Phrase als Attribut. Auch kann eine Adverbphrase unabhängig im Satz stehen. Entsprechend der semantischen Funktion können temporala, kausale und modale Adverbien unterschieden werden {**}. Hinzu kommen Interrogativadverbien (pang-abay na pananọng) {12-2.3}.
{**} Wir haben keine lokalen Adverbien gefunden. Wörter wie pataạs (taạs) sind adverbial verwendete Adjektive. Die Wörter dito, diyạn und doọn sind SA-Formen der Demostrativpronomen. Ein Indefinitpronomen ist saanmạn (sa).
(5) Nahezu alle Adjektive können attributiv mit Nomina verbunden werden. Eine entsprechende Eigenschaft fehlt den Adverbien. Somit können Adjektive von Adverbien unterschieden werden. Im Gegensatz zu Adjektiven werden nur bestimmte Adverbien und nur selten als Prädikat verwendet.
Die überwiegende Zahl der filipinischen Stammwörter sind Substantive. Jedoch gibt es auch einige Stammwörter, die Adjektive sind [1]. Eine weitere Gruppe von Adjektiven ist dem substantivischen Stammwort gleich [2] {9A-211} oder wird davon abgeleitet, indem die Betonung verändert wird ([3], bei [4] Ableitung vom Wortstamm). In diesen Fällen ist das Adjektiv endbetont, während beim Substantiv die vorletzte Silbe die Betonung trägt. Einige wenige Adjektive werden durch Stammdoppelung vom Wortstamm abgeleitet [5].
| |||||||||||||||||||||||||||
Die filipinische Sprache besitzt eine große Anzahl von Affixen, mit denen Adjektive gebildet werden. Mit vielen dieser Affixe werden auch Substantive, Adverbien und Verben gebildet.
| Affixe von Adjektiven | |||||
| -an (3) | -in (3) | di- (2) | |||
| ka- (2 3 4) | kaka- (ka- (12)) | ma- (5) | |||
| ma-&- (ma- (6)) | ma--in (ma- (10)) | magka- (mag- (8)) | |||
| maka- (2 3) | makaka- (maka- (9)) | mala- (1 2) | |||
| mapag- (2) | mapagpa- (mapag- (6)) | mapạng- (ma- (12)) | |||
| may- | naka- (2) | naka-&- (naka- (3)) | |||
| pa- (7) | pala- (1) | pampa- (pang- (9)) | |||
| pang- (2) | pang--in (pang- (8)) | ||||
| Affixe von Numeralien → {9-2.8} | |||||
(1) Das Präfix ma- wird zur Bildung von Verben und Adjektiven verwendet {7A-111 Θ}. Alle mit Präfix ma- gebildeten Adjektive besitzen eine Pluralform mit Silbendoppelung [1b 2b] (Schlüssel {U/M}). Wir können hier von einem, wenn auch kleinen Paradigma sprechen. Die gedoppelte Stammsilbe bei Pluraladjektiven ist unbetont. Die Pluralform wird attributiv [1b] und seltener prädikativ verwendet [2b]. Mit ma--in gebildete Adjektive besitzen eine entsprechende Pluralform [3]. Bei der Superlativbildung mit napaka- entfällt das Präfix ma- [4], während es bei dem Superlativ mit pinaka- erhalten bleibt [5].
| |||||||||||||
(2) Einige Wortfamilien besitzen ein Adjektiv ohne Affix und ein weiteres mit ma- (Beispiele: itịm - maitịm, payapa - mapayapa).
Mit dem Präfix pa- werden Adjektive abgeleitet [1a], die in der Regel auch adverbial verwendet werden können [1b]. Einige pa- Adjektive sind endbetont, obwohl der Wortstamm auf der vorletzten Silbe betont wird [2]. Daneben gibt es "echte" pa- Adverbien, die nicht als Adjektive verwendet werden [3].
|
| pa- Adjektive | |||||
| paakyạt | palipat-lipat | papuntạ | pataas | paunạ | |
| pauwị | paulit-ulit | ||||
Von Demonstrativpronomen werden Adjektive abgeleitet und besitzen wie diese drei Entfernungen [1 2] (Schlüssel {U/HP/1} bis {U/HP/3}). In der Regel werden sie attributiv [5 6] oder als Adverb verwendet [7]. Die Formen [3 4] sind keine Adjektive, sondern Verbformen {7A-113}. Diese können als attributive Partizipien verwendet werden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Konjunktionen man und selten kahit können in wenigen Fällen mit Interrogativadjektiven verbunden werden {8-4.3.1}. Dadurch entstehen Indefinitadjektive (Schlüssel {US}) [1]. Mit attributiv verwendeten Interrogativpronomen {12-2.2 (3)} kommen entsprechende Bildungen vor [2 3].
|
Durch Stammdoppelung können Adjektive gebildet werden (Beispiel: sunụd-sunọd). Wird der Wortstamm bereits als Adjektiv verwendet, hat das Adjektiv mit Stammdoppelung häufig eine verstärkende Bedeutung (Beispiel: ibạ - ibạ-ibạ, ibạng-ibạ und ibạ't ibạ).
Zwei Substantive oder Adjektive können zu einem Adjektiv zusammengesetzt werden. Bezüglich der Verwendung einer Ligatur gelten die gleichen Regeln wie bei zusammengesetzten Substantiven {8-2.2}. Beispiel: kapụs-palad {U.N}.
Die ANG-Formen der Demonstrativprononomen können wie Adjektive attributiv verwendet werden {8-7.3}.
Adjektive können als Substantive verwendet werden. Sie beschreiben dann einen Gattungsbegriff; das Adjektiv gibt eine gemeinsame Eigenschaft der Gattung an. Da in der filipinischen Sprache ein substantivisch verwendetes Adjektiv morphologisch keine besondere Form besitzt, ist eine Trennung nur schwer möglich. Wir sprechen dann von substantivischer Verwendung, wenn ein solches Gebilde in der Regel mit Adjektiven nicht möglich ist. Beispiele sind die Verwendung des Pluralartikels mga [1 2].
|
Zur Komparation (kaantasạn)
der Adjektive werden verschiedene syntaktische und morphologische Werkzeuge verwendet.
Daher sollte man die Komparationsformen als semantische Funktionen betrachten, denen keine
einheitliche Grammatik und kein Paradigma zu Grunde liegen. Deshalb können zur
Komparation auch Gebilde ohne Adjektive gezählt werden. Wir folgen im
Wesentlichen der Einteilung von {![]() Aganan 1999
p. 44 ff.}.
Aganan 1999
p. 44 ff.}.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tabelle zeigt, dass die Steigerungsformen in der Regel mit Präfixen oder Adverbien gebildet werden. Das spanische Lehnwortadverb mas [11] hat bei der Bildung des Komparativs weitgehend die indigenen Adverbien lalo, higịt und labis verdrängt [12-14], aber deren Syntax im Prinzip beibehalten. Der einzige Unterschied ist, dass mas ein einsilbiges Wort ist und keine Ligatur erhält {5A-221 (4)}.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter unbestimmten Numeralien (pamparami) versteht man eine Gruppe von Ausdrücken, die eine nicht zahlenmäßige Mengenaussage machen. Dabei gibt es eine Anzahl grammatischer Möglichkeit, dies auszudrücken [1-3].
|
(1) In der Regel sind Adjektivphrasen Attribut, Prädikat oder Subjekt.
(2) Eine kleine Gruppe von Adjektiven (wir nennen sie bawat
Gruppe) zeigt besonderes Verhalten. Diese Adjektive können nicht das Prädikat oder Subjekt
bilden (Schlüssel { P-P=P-U }). Als Attribut
werden sie vorangestellt, bei diesen Subjunkten wird nur die -ng
Ligatur verwendet [1], die na Ligatur entfällt [2].
|
| Adjektive, die nicht das Prädikat bilden | |||||
| bala | bawat | labis | lalo | para (3) | tuwị |
(3) Eine weitere kleine Gruppe von Adjektiven werden nur als Prädikat
(oder Subjekt) verwendet, jedoch nicht als Attribut (Schlüssel
{ P-L=P-U }).
| Adjektive, die keine Attribute bilden | |||||
| kapos | kulang | kumustạ | lampạs | magkano | |
(1) Einige Adjektive werden durch Objunktphrasen ergänzt [1-3]. Häufig drücken diese Adjektive etwas Vergleichendes aus [1].
| ||||||||||||
| Adjektive mit Objunktphrasen | |||||
| maalam ng | kaayon ng | dulot ng | marunong ng | ||
| gaya ng | kagaya ng | kasabạy ng | kasama ng | ||
| katabị ng | katulad ng | ||||
Eine Anzahl von Adjektiven werden durch Adjunkte ergänzt [1-4]; zwischen Adjektiv und Adjunkt kann das Pronomen eines Subjektinterklits eingeschoben werden [3 4a]. Einige dieser Adjektive können als Präpositionen verwendet werden [4b].
| ||||||||||||||||
| Adjektive mit Adjunktphrasen | |||
| ayon sa | bahala sa | kabilang sa | kasabạy sa |
| sawa sa | katulad sa | ukol sa | |
(1) Verb als Attribut in der Adjektivphrase.
Einige Adjektive werden durch Verben ergänzt [1-3]. Das Verb in der Adjektivphrase steht
im Infinitiv. Eine Ligatur wird verwendet [1 3b], die na Form kann jedoch entfallen
[2 3a]; diese Gebilde sind Subjunkte.
| ||||||||||||||
(2) Adverb als Attribut in der Adjektivphrase.
Einige Adjektive werden bei der Bildung des Komparativs durch Adverbien ergänzt [4 5]
{9-2.7 (2)}. Diese geschieht ebenso in Gebilden
wie [6 7] (in [7] Interrogativadverb). In [8-10] ist das Attribut ein als Adverb verwendetes
Adjektiv. In der Regel steht eine Ligatur.
| ||||||||||||||||||||
Attribut und ergänzte Phrase → {5A-201 Θ}
In unserem Strukturmodell ist die Adjektivphrase eine Inhaltsphrase.
| Adjektivphrase ist | Adjektivphrase enthält neben Adjektiv | ||
| [1] | Prädikat {2-4.7} | ||
| [2] | Subjekt {2-4.7} | ||
| [3] | Subjunkt (Attribut zu Substantiv) {8-7.1} | ||
| [4] | Adjektiv als Substantiv {9-2.6} | ||
| [5] | Adjektiv als Adverb {9-4.4} | ||
| [6] | Objunkt als Attribut {9-3.1} | ||
| [7] | Adjunkt als Attribut {9-3.2} | ||
| [8] | Subjunkt als Attribut {9-3.3} | ||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_U.html
Unterschieden werden zwei Arten von Adverbien. Enklitische und proklitische Kurzwörter bilden die erste Gruppe (Schlüssel {A/HG} und {A/UG}). Die zweite Gruppe sind Inhaltswörter, die Phrasen bilden können (Schlüssel {A/LM}).
Enklitische Adverbien sind Attribute zu Verben [1], Substantiven [2], Adjektiven [3], Adverbien [4 5] oder zu einer Phrase [6 7]. Sie können ihre Phrase nicht verlassen. Das Adverb daw in [8] bezieht sich auf den gesamten Satz.
| |||||||||||||||||||
| Enklitische Adverbien | ||||||
| ba | daw, raw | din,rin | họ | kayạ | man | |
| lamang, lang | muna | na → {9-4.1.1} | namạn | |||
| ngạ | pa → {9-4.1.1} | palạ | pọ | sana | ||
| tulọy | ulị | yata | ||||
| Das Adverb sana wird auch als Inhaltswort verwendet. | ||||||
(1) Die enklitischen Kuzwörter na und pa sind aspektale Adverbien. Zusammen mit ihren Verneinungen hindi na [hɪn'di:.nʌ] und hindi pa [hɪn'di:.pʌ] können vier Aspekte ausgedrückt werden [1-4]. Die Aspektbeschreibungen sind nicht auf Verben beschränkt, sie können für Existenzphrasen [5-8], Adjektive [9] und Substantive [10] verwendet werden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Die Kurzwörter na und pa können mit dem Suffix -ng der Ligatur zu nang oder pang verknüpft werden [12-14], wobei das dabei entstehende nang nicht mit anderen [nʌŋ] ausgesprochenen Wörtern zu verwechseln ist {5-3.4 (2)}.
|
(1) Die proklitischen Adverbien (pang-abay na untagạ) stehen vor ihrem Bezugswort [1 2]. Wie andere Kurzwörter können sie keine Phrasen bilden, keine Attribute besitzen und nicht Interklitbezugswort sein.
|
(2) Ebenfalls als proklitische Adverbien betrachten wir:
- adverbiales ANG [3] {2-3.3}.
- mga mit der Bedeutung 'etwa, ungefähr' [4]
{8-6.2 (4)}.
- may mit der Bedeutung 'etwa, ungefähr' [5]
{10-4 (4)}.
|
| Proklitische Adverbien | |||||
| ang | bakạ | halos | may | mga | oo |
| patị | pulọs | sakạ | tila | ||
| Die Adverbien bakạ, patị und sakạ werden auch als Inhaltswort verwendet. | |||||
Neben den oben beschriebenen Kurzwörtern gibt es Adverbien, die Inhaltswörter sind. Sie können ein Bestimmungswort erhalten, Attribute besitzen und enklitsches Bezugswort sein. Als Inhaltswörter bilden sie Phrasen. Syntaktisch können drei Gruppen unterschieden werden:
In den folgenden Abschnitten betrachten wir ihre morphologische Bildung: Stammwörter, Adverbien mit Affixen und weitere Adverbien.
Wir können mehrere Gruppen dieser Adverbien, die Stammwörter und Inhaltswörter sind, unterscheiden; sie zeigen unterschiedliches syntaktisches Verhalten.
Mit Präfix pa- können Adverbien gebildet werden [1 2], obwohl die meisten dieser Formen adverbial verwendete Adjektive sind [3]. Ferner bildet einige andere Präfixe Adverbien [4-6].
|
| Affixe von Adverbien | ||||
| kama- (ka- 13) | ma- (5) | mag- (4) | pa- (8) | |
Durch Stammdoppelung werden Adverbien gebildet (araw-araw, mayạmayạ).
Beispiele für zusammengesetzte Adverbien sind bukas-makalawạ, habang-daạn.
Interrogativadverbien können mit den Adverbien kahit und man vereint werden. Dadurch entstehen Indefinitadverbien (Schlüssel {AS}) [1-4] {8-4.3.1}.
|
Adjektive können ohne morphologische Veränderung in Adverbphrasen verwendet werden (Schlüssel {A//U}). Sie stehen unabhängig im Satz [1] oder ergänzen ein Verb [2], selten eine andere Phrase [3].
|
(1) Die Inhaltsphrase, deren Kernwort ein Adverb ist, bezeichnen wir als Adverbphrase [1] (Schlüssel {P-A}, pariralang pang-abay). Hinzu kommen die Phrasen, deren Kernwort ein als Adverb verwendetes Adjektiv bildet [2]. Die Mehrzahl der Adverbphrasen besteht nur aus dem Adverb [1 2].
|
(1) Adverbien können durch Nominalphrasen ergänzt werden [1 2 3a]. Häufig wird eine Ligatur verwendet, um das Attribut anzubinden. Dann ist das Attribut ein Subjunkt. Gebilde wie [4] können ein Attribut ergänzen. Auch Kurzwörter (im Allgemeinen enklitische oder proklitische Adverbien) können das Attribut bilden [5].
| ||||||||||||||||
(2) Die Nominalphrase ist das Attribut des Adverbs und nicht umgekehrt. In [6a] wird das Adverb noọn durch die Nominalphrase isang linggo ergänzt. Das Attribut isang linggo kann weggelassen werden, jedoch nicht das Adverb noọn [6b|c].
|
Attribut und ergänzte Phrase → {5A-201 Θ}
(1) Es gibt drei Möglichkeiten, eine Adverbphrase einem Verb zuzuordnen [1-3].
| |||||||||||||||||||
In [1 2] ist das Adverb dem Verb mit Hilfe einer Subjunktphrase mit Ligatur untergeordnet {*}. Diese Anbindung ist möglich, wenn das Adverb unmittelbar vor oder nach dem Verb steht. Das schließt Fälle ein, wenn zwischen Adverb und Verb Enklite stehen (Interklit in [1b 2b]). In [3] bildet das Adverb eine Disjunktphrase. In diesem Fall besteht keine syntaktische Unterordnung des Adverbs, obwohl das Adverb semantisch untergeordnet sein kann.
{*} Die na Form der Ligatur kann entfallen {5-2.2}.
(2) In sehr vielen Fällen steht das Adverb mit einer Ligatur vor dem Verb (Möglichkeit [1]). In [4-8] ergänzt es das prädikative Verb. Ähnlich sind Gebilde, bei denen das Adverb ein anderes Inhaltswort ergänzt, das Kernwort des Prädikats ist (Adjektiv [9 10], Existenzphrase [11]).
| |||||||||||||||||||
(3) Wenn zwischen Adverb und prädikativem Verb eine andere Phrase steht, wird ein Disjunkt gebildet (Möglichkeit [3]), da in diesem Fall die Bildung eines Subjunkts nicht möglich ist. Besonders zu betrachten sind die Fälle, in denen das Adverb unmittelbar auf das Verb folgt. Die Bildung eines Subjunkts mit Ligatur ist syntaktisch möglich (Möglichkeit [2]). Trotzdem wird häufig die Bildung eines Disjunkts (Möglichkeit [3]) vorgezogen {9-5.3 (2)}.
Bei nachgestelltem Adverb sind möglich:
| |||||||||||||
(4) Neben dem Prädikat können Adverbien auch andere Phrasen ergänzen [17 18]:
| |||||||
| (5) Adverbien, die Inhaltswörter sind und als Subjunkt vorangestellt werden | |||||
| bakạ {*} | hindị {*} | lalo | mas {*} | mukhạ | para (3) |
| patị {*} | sakạ {*} | sakali | samantala | sana | wari |
| {*} Adverb bildet Subjunke ohne Ligatur. | |||||
| Die Adverbien bakạ, patị und sakạ werden auch als proklitische Kurzwörter verwendet. | |||||
| Das Adverb sana wird auch als enklitisches Kurzwort verwendet. | |||||
| (6) Adverbien, die vorangestellt Subjunkte und nachgestellt Disjunkte bilden | |||||
| higịt | labis | lagi | magdamạg (damạg) | mulị | palagi |
(1) Zwei Gruppen von unabhängigen Adverbphrasen können unterschieden werden. Die Adverbien der kanina Gruppe (Schlüssel {A/KN}) bilden in der Regel Disjunkte. Vorwiegend sind dies temporale Adverbien. In vielen Fällen sind sie nicht deutlich von den anderen Phrasen des Satzes getrennt [1-4]; vor allem wird das Bestimmungswort nang nicht verwendet. Als Inhaltswörter können sie Attribute besitzen und Attribut sein (Subjunkt). Auch können Adverbien dieser Gruppe als Interklitbezugswort dienen und bilden dann Subjunkte. Die Adverbien mịnsan und ngayọn sind der kanina Gruppe zuzurechnen, zeigen jedoch einige Besonderheiten. Die kanina Adverbien können als Prädikat dienen {2-4.7 (2)}.
Die Interrogativadverbien bakit und kailạn (ilạn) stehen als Disjunkt am Satzanfang [5] {12-2.3}. Zur kanina Gruppe können die mit den spanischen Lehnwörtern ala und alas gebildeten Zeitangaben gezählt werden [6]; sie können jedoch das Bestimmungswort nang erhalten [6b].
|
| Adverbien der kanina Gruppe | ||||
| agạd | araw-araw | araw-gabị | bukas | kagabị |
| kahapon | kanina | mamayạ | minsạn | ngayọn |
| noọn | ulit | bakit | kailạn | alas |
(2) In der zweiten Gruppe bildet das Adverb (oder das adverbial verwendete Adjektiv) ein Disjunkt, wenn es in der Satzmitte oder am Ende steht [7]. Einige Adverbien erhalten dann das Bestimmungswort nang [8]. Auch kann ein Disjunkt am Satzanfang gebildet werden [9 10]. Jedoch wird ein Subjunkt vorgezogen, wenn das Adverb vor dem prädikativen Verb steht [11] {9-5.2 (2)}; maaari {A//AH} (ari) bildet stets Subjunkte.
|
In unserem Strukturmodell ist die Adverbphrase eine Inhaltsphrase.
| Gebrauch der Adverbphrase | |||
| [1] | Subjunkt {9-5.2} - Potenzialadverb {9-6} | ||
| [2] | Disjunkt {9-5.3} | ||
| [3] | Prädikat {2-4.7 (3)} | ||
| [4] | Attribut in der Präpositionalphrase {10-2} | ||
| Bestandteile der Adverbphrase (neben dem Adverb) | ||||
| [5] | Subjunkt als Attribut {9-5.1} - Nominalphrase | |||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_U_2.html
(1) Eine Gruppe von Adverbien modifizieren Verben so stark, dass keine Tätigkeit, sondern
der Wunsch, das Bedürfnis, der Zwang o.Ä. nach dieser Tätigkeit ausgedrückt wird bzw.
das Gegenteil davon [1-3]. Aus dem Täter wird ein 'Erwäger' (Schlüssel für Fokus und Funktion
{/fa},
tagaakala {*}). Daneben
können der 'potenzielle Täter' (Schlüssel {../fg}
tagagawạng pangmarahil
und das 'potenzielle Tatobjekt'
(Schlüssel {../ft},
tagatiịs na pangmarahil) dargestellt werden. Diese Adverbien entsprechen semantisch den
europäischen Modalverben, sind in der filipinischen Sprache jedoch keine Verben
{9A-611 Θ}. Wir nennen diese Adverbien
'Potenzialadverbien' (Schlüssel {AH},
pang-abay na
pangmarahil).
{*} = Fokus und Funktion
{/fa} beschreiben die potenziale Benutzung des Verbs, jedoch
nicht das Verb an sich.
| |||||||||
Modalwörter in der Linguistik → {9A-612 ![]() }
}
(2) Da die Tätigkeit nicht wirklich ausgeführt wird, wird statt einer Zeitform in der Regel der Infinitiv verwendet. Potenzialadverbien stehen vor dem Verb, zwischen beiden steht im Allgemeinen eine Ligatur; die Potenzialadverbien bilden Subjunktphrasen. Zwischen Potenzialadverb und Verb können nichtpronominale Argumente des Verbs gestellt werden. Wegen der Analogie zum Interklit bezeichnen wir diese Gebilde als 'Interpotenzial' {9-6.1.1}.
(3) Potenzialadverbien können nicht nur mit Verben verwendet werden. Sie bilden auch Gebilde, bei denen sie sich wie Substantive [4], Adjektive [5] oder wie "echte" Adverbien [6] verhalten.
|
(4) Die Potenzialadverbien sind bezüglich ihrer Syntax in zwei Gruppen einzuteilen. Eine Gruppe mit 'nominalem Verhalten' verhält sich ähnlich wie Nomina. Abweichend davon sind die Potenzialadverbien mit 'nichtnominalem Verhalten'.
| Potenzialadverbien (Reihenfolge: Nichtnominal → Nominal) | |||||
| maaari | puwede | huwạg | dapat | kailangan | ayaw |
| gustọ | alạm | ibig | nais | kaya | ugali |
| hilig | |||||
(5) Auffallend sind die morphologischen Unterschiede der Potenzialadverbien. Neben den zwei spanischen Lehnwörtern gustọ und puwede besitzt die Gruppe Wörter ohne Affigierung. Das Potenzialadverb maaari entspricht einer Verbform, kailangan hat die Struktur eines affigierten Substantives (obwohl es den dazu gehörigen Stamm ilang vermutlich nicht gibt) und huwạg steht in morphologischer Verbindung zu hindị.
(1) Beim 'Interpotenzial' (panggitahịl) wird zwischen Potenzialadverb und Verb ein Objunkt oder das Subjekt gesetzt, wir sprechen von Objunktinterpotenzial (Schlüssel {GHW}) bzw. Subjektinterpotenzial (Schlüssel {GHT}). Diese Phrasen behalten ihre Bestimmungswörter, und vor das Verb wird eine Ligatur gesetzt, die nicht entfallen kann [1-4]. Diese Ligatur stammt vom Subjunkt des Potenzialadverbs.
(2) In [1-4] bildet das Subjekt den Interpotenzial. Ein Objunktinterpotenzial wird nur für den Erwäger gebildet [5 6]. In [7] bilden Erwäger und potenzieller Täter den Interpotenzial, der Täter folgt dem Erwäger. Werden Interpotenzial und Interklit in einem Satz gleichzeitig gebildet, so stehen Interklitpronomen vor den Interpotenzialphrasen [2 4]; wie bei Interklitkurzwörtern untereinander gilt hier ebenfalls die Regel "kurz vor lang".
| ||||||||||||||||||||||||
(1) Eine Gruppe der Potenzialadverbien zeigt ein Verhalten, das wir als nominal bezeichnen (Schlüssel {AH/N}, gawịng makangalan). Ist das Verb ein Aktivverb, wird die Syntax erheblich geändert; das Subjekt (der zum Erwäger gewordene Täter) wird zu einem Objunkt, das dem Potenzialadverb zugeordnet und damit Teil des Prädikats wird [1-3]. Der Satz wird subjektlos. Falls das Aktivverb bereits ein Objunkt besitzt (in der Regel das potenzielle Tatobjekt), besitzt der Satz nun zwei Objunkte (in Satz [3b] ist bata der Erwäger und manggạ das potenzielle Tatobjekt). Damit rücken diese Potenzialadverbien in die Nähe von Nomina mit einer oder zwei Objunktphrasen.
|
|
Ist das Verb ein Passivverb und der Täter/Erwäger bereits ein Objunkt, tritt keine Änderung der Syntax ein [4-6]. Vorzugsweise werden mit nominalen Potenzialadverbien Passivverben verwendet [5 6]. Eine Änderung der Syntax mit Verlust des Subjekts findet nicht statt.
|
|
Nominal verhalten sich die Potenzialadverbien ayaw, gustọ, alạm, ibig, nais. Hinzu kommen mit Einschränkungen kaya, ugali und hilig. Nominal und nichtnominal wird kailangan verwendet.
(2) Das Potenzialadverb kann Bezugswort für einen Interklit sein, in der Regel für einen Objunktinterklit [7 8], seltener für Objunkt- und Subjektinterklit [9].
|
(3) In [10-12] wird ein Objunktinterpotenzial gebildet; zwischen Potenzialadverb und Verb wird das Objunkt (Erwäger) gestellt. Das Objunkt vor dem Verb besitzt eine Ligatur.
|
(4) In obigen Sätzen und in [13b] ist der Erwäger auch der potenzielle Täter. In Sätzen mit nominalem Potenzialadverb und Aktivverb ist kein Subjekt mehr vorhanden. Diese Sätze können ein neues Subjekt erhalten, um neben dem Erwäger auch einen vom Erwäger abweichenden potenziellen Täter darzustellen [13c 13d 13e]; das Subjekt kann einen zweiten Interklit bilden [13e]. In Sätzen mit Passivverb kann der potenzielle Täter durch ein zusätzliches Objunkt ausgedrückt werden [14b].
| ||||||||||||||||||||||
Werden Interklit und Interpotenzial gebildet, folgt die Phrase des Interpotenzials dem Kurzwort des Interklits. [15a 16]. Wenn zweifacher Interpotenzial gebildet wird, steht der Erwäger zuerst [15b].
| ||||||||||||
(5) In den obigen Beispielen und in [17a] ist das Potenzialadverb Bestandteil des Prädikats. Wegen der Symmetrie von Prädikat und Subjekt können diese getauscht werden (sofern der Satz ein Subjekt besitzt). Davon wird vorwiegend in Fragesätzen Gebrauch gemacht [17b], seltener in den Antwortsätzen [18].
| |||||||||
(1) Bei nichtnominalem Verhalten (Schlüssel {AH/DN}, gawịng di-makangalan) wird das Subjekt durch das Potenzialadverb nicht verändert [1a|b 2]. Nahezu ausschließlich nichtnominal verhalten sich maaari, puwede, huwạg und dapat. Nichtnominal und nominal wird kailangan verwendet. Aktiv- und Passivverben werden gleichermaßen mit nichtnominalen Potenzialadverbien verwendet. Bei diesen Potenzialadverbien können Erwäger und potenzieller Täter nicht getrennt werden.
|
(2) Nichtnominale Potenzialadverbien können einen Interklit bilden [3]. Bei Personalpronomen wird dieser nahezu regelmäßig gebildet [3a 3c]. Das oder die Interklitpronomen stehen in der Regel vor dem Potenzialadverb, wenn vor diesem ein geeignetes Interklitbezugswort steht [4 5].
|
(3) Auch bei nichtnominalem Verhalten können Argumente des Verbs zwischen Potenzialadverb und Verb gestellt werden, also ein Interpotenzial gebildet werden (Erwäger in [6], Tatobjekt in [7]).
|
(4) In den obigen Beispielen ist das Potenzialadverb Bestandteil des Prädikats. Wegen der Symmetrie von Prädikat und Subjekt können diese getauscht werden [8].
|
In verblosen Sätzen können nichtnominale Potenzialadverbien als Substantive verwendet werden (Schlüssel {N//AH}). Der potenzielle Täter {*} wird zu einem Attribut des Potenzialadverbs (Objunkt), das als Substantiv verwendet wird und das Prädikat oder Subjekt des Satzes bildet.
| |||||||||||||||||||
{*} Genau genommen gibt es wegen des fehlenden Verbs keine Argumente.
Potenzialadverbien mit nichtnominalem Verhalten können als Adjektiv (Prädikat) [1] oder als echtes Adverb (Attribut innerhalb des Prädikats) in Sätzen ohne Verb [2-5] verwendet werden. In Sätzen mit Verb als Prädikat betrachten wir Potenzialadverbien als echte Adverbien, wenn Vorgänge in der Vergangenheit oder Zukunft kommentiert werden [6].
| ||||||||||||||||
Bei {![]() Aganan 1999 p. 75}
werden Phrasen wie in Satz [1] pariralang
modal genannt.
Aganan 1999 p. 75}
werden Phrasen wie in Satz [1] pariralang
modal genannt.
(1) Die Verneinung wird realisiert durch das allgemeine Verneinungswort hindị, das dann verwendet wird, wenn keine spezifische Verneinung möglich ist:
(2) Die Verneinung wird mit dem Adverb hindị ausgedrückt, wenn eine Tätigkeit, Eigenschaft oder ein Umstand verneint wird. hindị ist proklitisch und erhält keine Ligatur {5A-221 (1)}. Mit hindị werden Inhaltswörter [1-3] und Phrasen [4] verneint. Häufig ist es Interklitbezugswort [2]. Adjektive können mit dem Präfix di- (mit Bindestrich) verneint werden [5]. Das verkürzte Wort di kann als Interklitbezugswort dienen [6].
|
(3) Mit dem Existenzwort walạ wird eine Verneinung ausgedrückt, wenn das Vorhandensein [7 8] verneint wird; walạ ist hier die Verneinung des das Vorhandensein ausdrückenden may, mayroọn. Mit walạ als Adjektiv wird die Anwesenheit verneint [9]; walạ ist auch die verneinende Antwort auf Entscheidungsfragen mit may oder mayroọn [10].
|
Wir verstehen unter Gesprächswörtern (salitạng pang-usapan) Kurzwörter oder Phrasen, die syntaktisch nicht in den Satz integriert sind. Im Allgemeinen sind sie semantisch zum Verständnis des Satzes nicht erforderlich {9A-801}. Sie können eine besondere Intensität, Hervorhebung, Abschwächung, Zweifel o.Ä. ausdrücken. Zu diesem Zweck verwendet die filipinische Sprache:
Besonders häufig finden sich Gesprächswörter in der Umgangssprache. Interjektionen werden bevorzugt am Satzanfang oder -ende verwendet.
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_U_3.html
(1) Die Präpositionen sind eine Gruppe von Wörtern, deren Phrasen einen lokalen, temporalen kausalen oder modalen Inhalt besitzen (Schlüssel {O}, pang-ukol). Die Präpositionen zählen zu den Inhaltswörtern.
Daneben zählen wir zu den Präpositionen das Wort nasa und die Existenzwörter, da sie sich häufig wie die "gemeinen" Präpositionen verhalten (letztere nennen wir Präpositionen der 'tungkol Gruppe').
(2) Die Präposition ist das Kernwort der Präpositionalphrase (Schlüssel {P-O}). Die Präposition steht am Kopf ihrer Phrase. Die Phrase enthält neben der Präposition ein Attribut, ohne Attribut werden Präpositionen nicht verwendet. Das Attribut kann eine Funktionsphrase (Adjunkt oder Subjunkt) sein, jedoch auch eine Inhaltsphrase (Adverb, Nomen oder substantivisches Partizip).
{Θ} Wenn nicht eine Adjunkt- oder Subjunktphrase das Attribut ist, wird die Inhaltsphrase Präpositionalphrase durch eine zweite Inhaltsphrase ergänzt {1-6.3 (4)}.
Präpositionen in der Linguistik → {10A-101 ![]() }
}
(1) Mehrheitlich ist eine Adjunktphrase das Attribut der Präpositionen der tungkol Gruppe [1-3]. Auch kann eine Adverbphrase das Attribut bilden [4 5], selten ein Teilsatz [12-14]. Bei einigen Präpositionen ist eine Nominalphrase als Attribut möglich (hanggạng, kaysạ, mulạ), bei bilang ist es stets eine Nominalphrase [6].
|
Zwischen der Präposition und ihrem Attribut steht keine Ligatur (mögliche Ausnahme hanggạng).
(2) Die Mehrzahl der Präpositionalphrasen ist unabhängig im Satz und sind daher Disjunktphrasen [1 4-6]. Dazu gehören auch Phrasen, die syntaktisch unabhängig sind, und semantisch einer Phrase zugeordnet sind, einem Substantiv [2] oder einem Verb (manchmal scheinbar als Argument) [3]. Mehrheitlich stehen unabhängige Präpositionalphrasen am Satzanfang [1 4-6]. Auch an anderer Stelle im Satz besitzen sie kein Bestimmungswort [2 3].
Einige Präpositionalphrasen sind ein echtes Attribut zu einem Substantiv [7 8]; sie besitzen eine Ligatur {8-7.6 (2)}. Diese Gebilde werden gewählt, um eine enge Verbindung zwischen Attribut und Bezugswort anzuzeigen.
Selten bildet eine Präpositionalphrase das Prädikat [9], seltener das Subjekt [10].
|
(3) Zwischen Präposition und Attribut können enklitische Kurzwörter eingeschoben werden [11, {13A-101 [3]}]; sie sind als zweites Attribut der Präposition neben dem oben beschriebenen ersten zu betrachten. Die Präpositionalphrase kann nicht gespalten werden, um einen Interklit zu bilden.
|
(4) Zu einigen Präpositionen gehören gleiche Wörter, die Adjektiv, Adverb oder Substantiv sind. Auch können einige als Konjunktion verwendet werden, wobei der Übergang fließend ist:
| |||||||||||
| Präpositionen der tungkol Gruppe | |||||
| alang-alang | alinsunod (sunọd) | ayon | batay | ||
| bilang | buhat | bukọd | dahil | galing | hanggạng |
| hinggịl | kaysạ {10A-201} | laban | maliban | mulạ | |
| para | simulạ | tungkọl | tungo | patungo | ukol |
(1) Phrasen mit nasa (sa) können das Prädikat [1 2], das Subjekt [3], ein Objunkt [4], ein Subjunkt [5] (Attribut zu Nominalphrase) oder selten ein Adjunkt [6] bilden. Die nasa Phrase steht nach dem Bestimmungswort ihrer Funktionsphrase [2-6]. Sie kann nicht unabhängig im Satz stehen.
|
(2) Das Attribut in der nasa Phrase ist eine Nominalphrase. Nur selten werden damit Personen beschrieben, dann wird ein SA-Pronomen verwendet [7]. nasa wird nicht mit Demonstrativpronomen verwendet, es wird eine Verbform wie nandoọn gebraucht [8] {7A-113}. Auch bildet nasa Phrasen ähnlich den SA-NG-Phrasen [9] {4-3.2}. Das Interrogativum nasaạn kann als Interrogativpräposition betrachtet werden [10] {12-2.1}.
| |||||||||||
(1) Existenzsätze werden mit den Existenzwörtern mayroọn (may), walạ und marami gebildet. may ist eine Kurzform von mayroọn. Wir zählen die Existenzwörter (Schlüssel {OD}, pangkaroọn [doọn]) zu den Präpositionen.
(2) Syntaktisch verhalten sich Existenzphrasen (Schlüssel {P-OD}) ähnlich wie Präpositionalphrasen mit nasa. Sie werden in Funktionsphrasen verwendet, als Prädikat [1 2], Subjekt [3], Objunkt [4] oder Subjunkt [5]. Es gibt keine unabhängigen Existenzphrasen.
Bildet die Existenzphrase das Prädikat, besitzt der Satz häufig kein Subjekt [1] {13-2.2.2}.
|
(3) Das Attribut in den Existenzphrasen mit mayroọn, walạ und marami ist ein Subjunkt mit Ligatur [1 3 5]. Die -ng Form wird dem Existenzwort angehängt, sie steht also vor der Nominalphrase, die den Inhalt des Subjunktes bildet. Das Existenzwort kann als Interklitbezugswort dienen {11-6.5}. Die Kurzform may [2 4] erhält weder eine Ligatur (das Attribut ist eine Nominalphrase und kein Subjunkt ohne Ligatur), noch kann sie Interklitbezugswort sein.
(4) In der Regel ist walạ ein Existenzwort, es wird auch als Adjektiv verwendet [7]. Während marami in der Regel Adjektiv ist [3], kann es auch Existenzwort sein [8]. Proklitisches Adverb ist may in Gebilden wie [9 10] {9-4.2 (2)}; es bedeutet 'etwa, ungefähr'. may wird als Vorsilbe von Substantiven [11a] und Adjektiven [11b] verwendet. Groß ist die Wortfamilie von walạ [12]. Damit werden zusammengesetzte Substantive [12a], Adjektive [12b] und Verben [12c 12d] gebildet.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Existenzphrasen werden gern verwendet, um eine nicht näher bekannte Person (oder einen Gegenstand) zu bezeichnen. Die eigentliche Aussage steht in einem Ligatursatz [14].
|
(6) Das Existenzwort mayroọn besitzt die Nebenformen meroọn und meron in der Umgangssprache; selten hört man me statt may.
(1) An Stelle eines Substantivs kann ein substantivisches Partizip das Attribut in der Existenzphrase sein {6-6.4.3} [1b]. Häufig werden Partizipien von Passivverben verwendet [1b 2-4]. Diese Sätze werden gebildet, wenn ein Argument nicht erwähnt werden soll (Empfänger in [1b], Tatobjekt in [2]). Auch können Aktivverben in der Existenzphrase stehen [5]. In der Regel wird eine Zeitform des Verbs gewählt [1-5], nur selten der Infinitiv [6].
|
(2) Das Partizip in der Existenzphrase kann durch eine Phrase ergänzt werden [7c], die im Vergleichssatz das Subjekt ist [7a]. Da ein Partizip keine Argumente besitzen kann (also kein Subjekt), wird die entsprechende Phrase wie oder als ein Attribut in Form eines Subjunktes zugefügt. Die Ligatur in diesen Gebilden, die nicht entfallen kann, kommt also aus der Verbindung von Partizip und dessen Attribut [7b|c]. Vorwiegend werden Partizipien von Passivverben verwendet [7], in [8] nur der Wortstamm. Gebilde mit Aktivverben sind ebenfalls möglich [9].
| ||||||||||||||||
(2 {Θ}) Die Sätze [7c 8 9] besitzen ein Partizip und ein nachfolgendes Substantiv, die durch eine Ligatur verbunden sind. Dabei erhebt sich die Frage, ob die Nominalphrase tatsächlich ein Attribut zum Partizip ist [9] oder ob umgekehrt das Substantiv das Kernwort der Existenzphrase ist, das durch ein Partizip ergänzt wird {5A-201 Θ}.
(3) Die in Absatz (2) angestellten Überlegungen beziehen sich nur auf das Subjekt. Ist ein Objunkt oder ein Adjunkt einer Verbphrase zugeordnet, so ist es sowohl Argument als auch Attribut [10a] {6A-201 Θ}. Wenn es zu einem Partizip gehört, verliert es seine Eigenschaft als Argument. Das Objunkt oder Adjunkt bleibt jedoch Attribut des Partizips [10b 11 12]. In [13] ergänzt ein Ligatursatz das Partizip.
| ||||||||||||||||
(4) Das substativisch verwendete Partizip in einer Existenzphrase kann durch ein Potentialadverb ergänzt werden. Wie in Sätzen mit Potenzialadverbien üblich, steht das Partizip in der Regel im Infinitiv ([14-16], jedoch [17]). Diese Gebilde werden vorwiegend mit Aktivverben gebildet [14 15], seltener mit Passivverben [16 17].
In Sätzen mit Potenzialadverbien mit nominalem Verhalten ist der Erwäger ein Objunkt [14a]. Daher ist eine Erfragung des Erwägers in diesen Sätzen nicht möglich. In einem Satz mit Existenzphrase wird der Erwäger erfragbar [14b] {12-4.3 (3)}.
|
(1) Im Strukturmodell ist die Präpositionalphrase eine Inhaltsphrase und kann wie folgt dargestellt werden.
| Funktion der Präpositionalphrase | Gruppe / Präposition | ||||
| [1] | Prädikat | {O} {*} | nasa | {OD} {**} | {2-4.8} |
| [2] | Subjekt | {O} | nasa | {OD} | {2-4.8} |
| [3] | Objunkt | {O} | nasa | {OD} | {3-2.2} |
| [4] | Subjunkt (Attribut zu Substantiv) | {O} | nasa | {OD} | {8-7.6} |
| [5] | Disjunkt (unabängig) | {O} | {5-3} | ||
| Attribut in der Präpositionalphrase | Gruppe / Präposition | ||||
| [6] | Adjunktphrase | {O} {*} | {10-2 (1)} | ||
| [7] | Adverbphrase | {O} | {10-2 (1)} | ||
| [8] | Nominalphrase | {O} | nasa | {10-3} | |
| [9] | Nominalphrase {***} | may | {10-4} | ||
| [10] | Subjunkt (Nominalphrase {***}) | {10-4} | |||
| {*} = Präpositionen der tungkol Gruppe. | |||||
| {**} = may, mayroọn, walạ, marami. | |||||
| {***} = Auch substantivisches Partizip. | {10-4.1} | ||||
(2) Syntaktisch zeigen Präpositionalphrasen zwei Besonderheiten:
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_O.html
Neben den Inhaltswörtern besitzt die filipinische Sprache Bestimmungswörter und Kurzwörter. Letztere beiden können nicht Kernwort einer Phrase sein, sie bilden also keine Phrasen. Damit können sie keine Attribute besitzen und nicht Interklitbezugswort sein. Pronomen, die im Interklit als Enklit verwendet werden, sind ebenfalls Kurzwörter, weil sie in ihrem gegenwärtigen Gebilde keine Phrasen sind.
Mit Ausnahme von einigen Konjunktionen sind Kurzwörter ein- oder zweisilbig, also morphologisch kurz.
(1) Bestimmungswörter (panandạ) stehen in Funktionsphrasen, um deren syntaktische Funktion anzuzeigen. Sie besitzen keinen semantischen Inhalt, oder dieser tritt weit hinter die syntaktischen Funktion zurück.
Die Bestimmungswörter sind ang, ay, ng, sa und nang (Schlüssel {TT}, {TP}, {TW}, {TK} und {T0}). Die Ligatur als Bestimmungswort der Subjunktphrase wird in in Abschnitt {11-5} gesondert behandelt.
(2) In den entsprechenden Kapiteln über Subjekt, Objunkt und Adjunkt haben wir die Verwendung der Bestimmungswörter mit Nominalphrasen betrachtet. Die dort auftetenden Besonderheiten möchten wir hier nochmals verdeutlichen:
|
Kurzwörter (katagạ, 'particles') gehören unterschiedlichen Wortarten an {1-7.1 (3)}:
(1) In einem Enklitgebilde folgt das Enklit (enklitisches Kurzwort, Schlüssel {../HG}, hutagạ, 'second position clitic') nach einem Bezugswort (salitạng makatukoy) {11-6.1}. Eine Gruppe Adverbien und einige Konjunktionen zählen zu den Enkliten. NG- und ANG-Pronomen können enklitisches Verhalten (gawịng hutagạ) zeigen und damit zu Enkliten werden.
(2) Wie unterscheiden zwei Arten von Enklitgebilden:
(1) Wir sprechen von einem einfachen Enklitgebilde (yaring hutagạng payạk), wenn das Enklit eine syntaktische und semantische Beziehung zum vorangehenden Bezugswort besitzt, jedoch keine Beziehung zu dem folgenden Wort bzw. der folgenden Phrase [1-3]. Die einfachen Enklitgebilde bestehen aus zwei Elementen – Bezugswort und Enklit (bzw. Enkliten). Sie werden mit enklitischen Adverbien [1 2] und Konjunktionen [3] gebildet.
| ||||||||||||
(2) Nach einem einfachen enklitischen Gebilde [4a 5a] kann ein NG- oder ANG-Pronomen folgen. Das Enklitgebilde und das Pronomen stehen dann nebeneinander, und das Pronomen nimmt enklitisches Verhalten an. Damit wird es zum Enklit und in das Enklitgebilde aufgenommen. Die Regeln für die Reihenfolge von Enkliten gelten auch für das Pronomen [4b|c 5b|c] {11-4.3}.
| ||||||||||||||||||
(3) {Θ} Wenn ein Pronomen mit enklitischem Verhalten ein einfaches Enklitgebilde bildet, wird die Positionierung des Pronomens in Bezug zu anderen Phrasen nicht geändert. Es bleibt offen, ob das Pronomen ein phrasenbildendes Inhaltswort ist oder ein Kurzwort, das keine Phrasen bilden kann. In den Sätzen [6 7] hat das Pronomen ein Attribut. Dann ist es mit Sicherheit ein Inhaltswort.
| ||||||||||
(4) Substantive oder NG-Pronomen sind das Kernwort der Objunktphrase. Sie besitzen nachlaufendes Verhalten {3-1 (3)}. In einfachen Enklitgebilden zeigen NG-Pronomen enklitisches Verhalten. Aus beiden Blickwinkeln ist ihre Positionierung verständlich.
(5) {Θ} Nachfolgend möchten wir einfache Enklitgebilde an Hand einiger Beispielssätze erläutern:
| |||||||||
(1) Ein Enklit steht unmittelbar nach seinem Bezugswort. Das Enklit kann seine Phrase nicht verlassen [1b]. Daher steht es an zweiter Position in der Phrase und – entsprechend der Positionierung der Phrase im Satz – an unterschiedlichen Positionen im Satz. Wenn das Bezugswort dem am Satzanfang stehenden Prädikat angehört, steht das Enklit nur "zufällig" an zweiter Position im Satz [2]. In [3] bezieht sich das Enklit auf den gesamten Teilsatz, steht also "berechtigt" an zweiter Stelle im Teilsatz.
|
(1) Häufig kommen mehrere Enklite an die gleiche Stelle im Satz zu stehen (Enklitbündel, kumpọl ng hutagạ). Für deren Reihenfolge gelten feste Regeln, die für einfache Enklitgebilde {HG} und für Interklitgebilde gelten {GG}.
|
(2) {Θ} Obige Regeln zeigen folgendes Prinzip der Reihenfolge:
(1) In Kapitel {5-2} haben wir die Ligatur (pang-angkọp, 'linker' oder 'ligature', Schlüssel {L} bzw. {.. .L}) als Bestimmungswort der Subjunktphrase beschrieben.
(2) Die Ligatur wird weiterhin zur Anbindung von Ligatursätzen verwendet. In der Regel steht die Ligatur am Beginn eines nachgestellten Teilsatzes. Auffällig ist die syntaktische und semantische Verwandtschaft der Ligatur in Subjunkten und in Teilsätzen {13A-441 Θ}.
(3) Daneben wird eine Ligatur nach einem enklitischen Kurzwort verwendet, wenn eine Disjunktphrase als Interklitbezugswort dient {5-3.5}.
(4) {Θ} Wir gehen davon aus, dass es sich in allen Fällen (1-3) um die gleiche Ligatur handelt. Obwohl die Funktion der Ligatur in den Fällen (3) uns nicht deutlich ist, ordnen wir sie uneingeschränkt den Bestimmungswörtern und damit den Funktionswörtern zu.
Die Ligatur hat zwei unterschiedliche Formen. Das angehängte Morphem -ng wird nach Vokal, Po [ ʔ ] oder -n Endung [1a 2b 3b] verwendet (wobei Po [ ʔ ] oder -n der Endung wegfallen). Die andere Form ist das separate Wort na [1b 2a]. Eine Anzahl Wörter enden auf -ng, dieses -ng ist mit der Ligatur nicht zu verwechseln [2a]. Angehängtes -ng und separates Wort na haben die gleiche Funktion. In bestimmten Fällen kann die na Form der Ligatur entfallen {5-2.2}.
Statt der -ng Form kann die na Form verwendet werden. Davon wird oft bei Eigennamen Gebrauch gemacht, um die Namen morphologisch nicht ändern zu müssen ([3a], jedoch Mariang Makiling). Ligatursätze, insbesondere längere, werden häufig mit na eingeleitet, auch wenn -ng phonologisch zulässig wäre, vermutlich, um den Ligatursatz deutlicher zu abzutrennen [4].
| |||||||||||||||||
Das Wort na der Ligatur ist morphologisch dem Adverb na gleich, hat aber syntaktisch und semantisch nichts mit diesem zu tun.
(1) Ein vorangestelltes Subjunkt mit Ligatur kann zum Bezugswort eines Enklitgebildes werden [1a|b 2a|b 3a|b]. Oder dem Bezugswort folgt ein Subjunkt mit Ligatur [4a|b 5a|b] oder ein Ligatursatz [6a|b]. Das Enklit nach dem Bezugswort übernimmt dessen Ligatur [1b 4b 6b]. Dabei kann eine weggelassene na Ligatur als -ng Form gebildet werden [2a|b]. Stehen mehrere Enklite zusammen, so erhält das letzte die Ligatur [1c 3c 5b]. Dadurch bleibt die enge Beziehung zwischem Bezugswort vor dem Enklit und dem ersten Wort nach diesem erhalten.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Wenn die -ng Form der Ligatur möglich ist, muss diese stehen. Dies ist bei den meisten Enkliten der Fall. Nach den wenigen abweichenden Enkliten (Beispiele daw, lamang, tulọy) entfällt die Ligatur, eine Bildung mit dem getrennten Wort na ist nicht möglich [3b].
(3) In den obigen Teilen dieses Abschnitts werden Subjunkte mit einer Ligatur behandelt (die entfallen sein kann [2a]). Wenn das Bezugswort eine Unverträglichkeit hat, erhält das Enklit (bzw. das letzte der Enklite) keine Ligatur [7] {5A-221}. Auch andere Gebilde ohne Ligatur können als Bezugswort dienen. Dann besitzt das Enklit ebenfalls keine Ligatur [8a|b 9].
| ||||||||||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_taga_1.html
Der Interklit (Schlüssel {GG..}, panggitagạ) ist ein besonderes Gebilde der filipinischen Sprache, das auf dem enklitischen Verhalten von Pronomen beruht. Der Interklit besteht aus drei Teilen:
| Interklitbezugswort (enklitisches Bezugswort) |
Enklit | Interklitkernwort |
| Syntaktische Beziehung Semantische Beziehung | ||
Das Enklit folgt auf das Bezugswort, aber es steht vor einem Interklitkernwort. Die Beziehung zwischen Bezugswort und Enklit ist rein syntaktisch, während zwischen Enklit und Kernwort eine semantische Beziehung besteht.
(2) Interklitbezugswort. Das Interklitbezugswort ist ein Inhaltswort. Jedoch sind nicht alle Inhaltswörter als Bezugswort qualifiziert {11-6.1}. Das Interklitbezugswort braucht nicht am Satzanfang zu stehen, so dass das Enklit nicht immer an der zweiten Position im Satz steht.
(3) Enklit. In Interklitgebilden sind Personal- und Demonstrativpronomen Enklite, also keine Inhaltswörter {11-6.2}.
(4) Interklitkernwort. Das Kernwort des Objunktinterklits ist das Kernwort der Phrase, dem das NG-Pronomen semantisch angehört.
Der Subjektinterklit besitzt kein "natürliches" Kernwort. Trotzdem betrachten wir diese Gebilde als Interklit, da das ANG-Pronomen (semantisches Subjekt) an andere Positionen im Satz gesetzt werden kann als einer Subjektphrase zugänglich sind. Im Allgemeinen folgt beim Interklit dem ANG-Pronomen das Kernwort des Prädikats, das als Interklitkernwort betrachtet wird. Es gibt auch andere Gebilde mit Subjektinterklit {11-6.3 (4)} {11-6.5 (4)}.
(5) {Θ} Nachfolgend möchten wir Interklitgebilde an Hand einiger Beispielsätze erläutern:
| |||||||||||
Vorbemerkung
Im Allgemeinen gelten die nachfolgenden Ausführungen ebenfalls für einfache enklitische Gebilde.In anderem Zusammenhang verwenden wir den Begriff Bezugswort (salitạng kaugnạy) für das Kernwort der Phrase, auf das sich eine untergeodnete Phrase oder ein untergeordneter Teilsatz bezieht. Dort besteht eine syntaktische und semantische Verbindung. Innerhalb einer Inhaltsphrase verwenden wir den Begriff Kernwort (salitạng pang-ubod).
(1) Vorangestellte Subjunkte bilden eine erste Gruppe von Interklitbezugswörtern:
| |||||||||||||||
(2) Weitere Interklitbezugswörter sind:
| |||||||||||||
(3) Neben Inhaltswörtern können Disjunkt- und Adjunktphrasen als Interklitbezugswort dienen. Die gesamte Funktionsphrase ist der Interklitbezug; sie wird durch das Enklit nicht gespalten.
| |||||||||||||
(4) Als Interklitbezug können u.a. nicht dienen:
(5) Die Phrase, aus der das Interklitbezugswort hervorgeht, bestimmt, ob dessen (letztes) Enklit eine Ligatur erhält oder nicht {11-5.2}. Ist diese Phrase ein Subjunkt, so wird in der Regel die -ng Form der Ligatur gesetzt.
(6) {Θ} Aus syntaktischer Sicht können die Interklitbezugswörter eingeteilt werden:
(1) In Interklitgebilden zeigen ANG- und NG-Pronomen enklitisches Verhalten, sie werden zu Enkliten (hutagạ ng panggitagạ) mit folgenden Eigenschaften:
(2) Enklite in Interklitgebilden sind Personal- und Demonstrativpronomen [1-4].
| ||||||||||||||||
Nahezu stets bilden einsilbige Personalpronomen Interklitgebilde (es gibt keine einsilbigen Demonstrativpronomen) [1], häufig zweisilbige Personalpronomen [2] und weniger häufig Demonstrativpronomen [3 4]. Auf Interklitbildung kann verzichtet werden, was besonders bei Demonstrativpronomen geschieht [5]. In einigen Fällen ist die Bildung eines Interklits nicht möglich [6].
|
(3) Sind in einem Satz mehrere Pronomen, die einen Interklit bilden können, so können Subjekt- und Objunktinterklit auftreten [7 8] (Enklitbündel {11-4.3}). Das Dualpronomen kitạ bildet gleichzeitig Subjekt- und Objunktinterklit [9]. Zwei Personalpronomen bilden nahezu regelmäßig doppelten Interklit [7-9]. Die Kombination von Personal- und Demonstrativpronomen ist weniger häufig [10], so dass ein Demonstrativpronomen als zweites Pronomen auch dem Kernwort des Prädikats nachgestellt bleiben kann [11].
| |||||||||||||||||||||||
(4) Interklitpronomen sind Kurzwörter, bilden also keine Phrasen. Das Pronomen muss also allein sein, Gebilde wie mga itọ können keinen Interklit bilden.
In [12a 13a 14a] sind Pronomen mit Attribut das Subjekt. Trotzdem kann ein Subjektinterklit gebildet werden. Das Pronomen – Kernwort des Subjekts – wird Enklit [12b 13b 14b]. Sein Attribut wird eine Phrase am Ende des Satzes. Dabei wird die Nominalphrase gespalten.
|
(5) In einem Interklitgebilde können zusätzlich enklitische Adverbien zusammen mit dem (bzw. den) Interklitpronomen ein Enklitbündel bilden (na in [10 11]), für das ebenfalls die Regeln nach {11-4.3} gelten.
(6) {Θ} Ist eine Verbphrase das Prädikat des Satzes, können Pronomen Argumente des Verbs sein (Subjekt und Objunkt). Das ändert sich nicht, wenn diese Pronomen Enklite werden; sie besitzen weiterhin als Argumente Fokus bzw. Funktion des Verbs. Ist das semantische Subjekt ein Enklit (ANG-Pronomen), wird es in das Prädikat eingeschlossen {11-6.3 (3) Θ}.
(1) Das Kennzeichen des Subjektinterklits (Schlüssel {GGT}, panggitagạng paniyạk [tiyak]) ist, dass das Enklit das semantische Subjekt des Satzes ist [1a|b]. Da dieses keiner Phrase angehört, kann das Enklit beim Subjektinterklit stets die zweite Position im Satz [1b 2 3] (oder Teilsatz [4a 4b]) einnehmen. Das Interklitkernwort ist in der Regel das Kernwort des Prädikats, im Allgemeinen ein Verb [1-4].
| |||||||||||||
(2) Der Subjektinterklit kann auch gebildet werden, wenn das Prädikat kein Verb ist (Nominalphrase [5], Adjektivphrase [6], Existenzphrase [7]).
| |||||||||||
(3) {Θ} Beim Subjekt- und Existenzinterklit ist das Enklit das semantische Subjekt. Es ist ein ANG-Pronomen mit enklitischem Verhalten. Als Kurzwort bildet es syntaktisch keine Subjektphrase und wird Teil einer anderen Phrase. Der Satz ist ein subjektloser Nicht-Regelsatz {13-2.2.1}.
(4) Wenn sich kein mögliches Bezugswort vor dem Kernwort des Prädikats befindet [8a 8b], kann letzteres als Interklitbezugswort dienen, sofern es ein nachgestelltes Subjunkt [8c 8d] oder ein Adjunkt [9] als Attribut besitzt; das ANG-Pronomen kommt nach dem Kernwort und vor dem Attribut zu stehen.
| ||||||||||||||||||
(1) Beim Objunktinterklit (Schlüssel {GGW}, panggitagạng pantuwịd) ist das Enklit ein NG-Pronomen [1-7]. Dieser Interklit kann gebildet werden, wenn das Pronomen Argument des prädikativen Verbs ist. In der Regel ist ein vorangestelltes Subjunkt das Interklitbezugswort [1-3]. Auch können andere Wörter oder Phrasen dazu dienen [4].
| |||||||||||
(2) Gebilde, bei denen das Objunkt einer Nominalphrase als Attribut zugeordnet ist, können ebenfalls als Objunktinterklit betrachtet werden [5-7]. In diesen Sätzen gehören alle drei Bestandteile des Interklits derselben Nominalphrase an, doch besteht in der Regel zwischen Bezugswort und Enklit kein semantischer Zusammenhang (z.B. in Satz [5] sind hindị und ko nur über das Kernwort der Phrase balak semantisch verbunden). Das NG-Pronomen nimmt auch bei diesen Gebilden die zweite Position innerhalb seiner Phrase ein, und daher nicht immer die zweite Position im Satz [6 7].
| |||||||||
(1) Der Existenzinterklit (Schlüssel {GGD}, panggitagạng pangkaroọn [doọn]) ist ein Subjektinterklit in Sätzen, deren Prädikat eine Existenzphrase ist. Daher ist das Enklit ein ANG-Pronomen. Ein Existenzinterklit ist möglich, wenn der Existenzphrase ein Subjunkt angehört. In die Existenzphrase wird das ANG-Pronomen eingefügt.
(2) Existenzphrasen mit mayroọn, walạ und marami besitzen ein Subjunkt als Attribut. Hier ist das Existenzwort das Interklitbezugswort [1-3].
| |||||||||
(3) Ein Existenzinterklit ist ebenfalls möglich, wenn das Substantiv der Existenzphrase ein vorangestelltes Attribut besitzt. Dieses kann als Interklitbezugswort dienen. Dieser Interklit ist mit der Kurzform des Existenzwortes may möglich [4a|b 5-7|
| |||||||||||||
(4) Wenn das Attribut in der Existenzphrase ein substantivisches Partizip ist, kann es ein nachgestelltes Attribut besitzen {10-4.1}. In [8] wird das semantische Subjekt akọ in die Existenzphrase eingeschoben. Das Partizip marinịg ist das erste mögliche Bezugswort im Satz. Deshalb steht akọ zwischen ihm und vor dem Attribut tinig at kalabọg.
| |||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_taga_2.html
(1) Fragesätze werden nach den Regeln des Strukturmodells gebildet und erfordern keine besonderen Regeln. Das Interrogativum wird vorzugsweise an den Satzanfang gestellt. Auch dies entspricht dem Strukturmodell, dass die erste Phrase in allen Sätzen besonderes Gewicht besitzt.
Nicht alle Phrasen sind erfragbar. Häufig muss der syntaktische Bau des Satzes geändert werden, um die erwünschte Phrase erfragen zu können.
(2) Daneben werden Interrogativa zusammen mit Konjunktionen verwendet, um unbestimmte Mengenbegriffe ('Indefinita') zu bilden {8-4.3.1}.
Wir bezeichnen Fragen, bei denen eine Phrase erfragt wird, als Phrasenfragen und deren Interrogativa als Phraseninterrogativa (salitạng pananọng na pamparirala).
Wir vermeiden den Begriff Ergänzungsfrage und schließen damit Undeutlichkeiten zu Ergänzungs- und Ersetzungssatz aus {13-4}. Eine Bezeichnung wie W-Frage verbietet sich in Filipino.
(1) Die filipinische Sprache besitzt zwei Interrogativpronomen (Schlüssel {HN}, panghalịp na pananọng) in der Grundform. Mit sino werden Personen erfragt [1], sein Gegenstück für Dinge ist anọ [2]. Da mit diesen Pronomen das Prädikat erfragt wird, bezeichnen wir sie als AY-Formen. Die entsprechenden SA-Pronomen sind kanino für Personen [3] und saạn (sa) für Dinge [4] {8-4.6 (5)}. Die SA-Interrogativpronomen können in Verbindung mit Präpositionen verwendet werden [5], nasaạn (sa) ist eine Interrogativpräposition [6]. Das NG-Interrogativpronomen nino wird selten verwendet [7], da es als enklitisches NG-Pronomen nicht an den Satzanfang gestellt werden kann. Für die Interrogativpronomen lässt sich folgendes Schema aufstellen, in dem auch die Pluralformen mit Stammdoppelung aufgenommen sind.
| ANG | AY | NG | SA | ||
| Singular und Plural | Personen | Nicht vorhanden | sino | nino | kanino |
| Dinge | anọ | Nicht vorhanden {*} | saạn [nasaạn] | ||
| Plural | Personen | sinu-sino | ninu-nino | kani-kanino | |
| Dinge | anụ-anọ | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | ||
| {*} Seltener werden Formen mit Bestimmungswörtern wie ng anọ gebildet. | |||||
|
(2) Umgangssprachlich werden Interrogativpronomen mit ang zu sinong oder anọng zusammengezogen [9a|b] {2-2.2 (3)}. Dies ist zu unterscheiden vom adjektivischen Gebrauch {12-2.2}.
|
(1) Eine Anzahl Interrogativa verhalten sich wie Adjektive, wir bezeichnen sie als Interrogativadjektive (Schlüssel {UN}, pang-uring pananọng). Zu dieser Gruppe gehören alịn, ilạn, tagasaạn. In den Sätzen [1 2 4a] werden die Interrogativadjektive prädikativ verwendet.
(2) Die Interrogativadjektive können wie andere Adjektive in Nominalphrasen als Attribut stehen [3 4b]. Sie erhalten dann eine Ligatur, bilden also Subjunkte.
(3) Das gleiche gilt für die attributiv verwendeten Interrogativpronomen sino, anọ und kanino [5a 5b 6], die den Schlüssel {U//HN} erhalten.
(4) Das Interrogativadjektiv magkano wird als Prädikat verwendet [7], jedoch nicht als Attribut {9-3 (3)}. Eine weitere Besonderheit ist das spanische Lehnwort kumustạ |como esta| 'wie geht es' [8]; in der filipinischen Syntax ist es ein Interrogativadjektiv.
|
Interrogativadverbien (Schlüssel {AN}, pang-abay na pananọng) sind bakit, kailạn, paano, gaanọ [1-5] und ba {12-3}. Wie bei anderen Adverbien stellt sich die Frage (mit Ausnahme von ba, das enklitisches Kurzwort ist), ob sie unabhängig im Satz stehen oder als Attribut einer anderen Phrase zugeordnet sind. Unabhängig sind mit Sicherheit bakit und kailạn [1]. Sie besitzen keine Ligatur; wir zählen ihre Phrasen zu den Disjunkten. gaanọ wird in Verbindung mit Adjektiven verwendet [2], während paano mit Verben (und selten mit Substantiven) verwendet wird [3 4]. Attribute und Subjunkte sind diese Gebilde, wenn sie eine Ligatur besitzen [4] und vermutlich auch, wenn diese fehlt [2 3]. In Verbindung mit gaanọ wird das Präfix von ma- Adjektiven zu ka- abgewandelt [2]. Die Interrogativadverbien können prädikativ verwendet werden [5] {2-4.7 (3)}.
|
Die filipinische Sprache besitzt Interrogativverben (pandiwang pananọng), bei denen die Verbform bereits eine Frage beinhaltet. Dazu gehören umanọ (anọ), anuhịn.
Die filipinische Sprache besitzt ein enklitisches Interrogativadverb ba (Schlüssel {AN/HG}, pang-abay na pananọng), das die verkürzte Form von bagạ ist. Es wird für Entscheidungsfragen verwendet, und die Frage bezieht sich im Allgemeinen auf die Richtigkeit des gesamten Satzes [1]. ba wird dann als enklitisches Kurzwort an die zweite Position im Satz gestellt. Eine Möglichkeit ist, den fraglichen Satz als Aussagesatz zu lassen und einen verkürzten Frageteilsatz di ba zuzufügen [2]. In Phrasenfragen kann ba zur Verstärkung der Frage dem Interrogativum nachgestellt werden [3].
|
In der filipinischen Sprache sind nicht alle Phrasen erfragbar. Neben dem Prädikat können Adjunkte und unabhängige Phrasen erfragt werden. Die wichtigste Einschränkung ist die Bestimmtheit des Subjekts. Von Ausnahmen abgesehen, sind Objunkte ebenfalls nicht erfragbar. Hier ist der Grund das nachlaufende Verhalten der Objunktphrasen, das in der Regel verhindert, die Fragephrase an den Satzanfang zu stellen.
Es gibt also in der filipinischen Sprache verbotene Fragen. Dieser Mangel wird dadurch behoben, dass die filipinische Sprache eine hohe Flexibilität besitzt, Phrasen durch geeignete syntaktische Mittel zu tauschen.
Ein am Satzanfang stehendes zu erfragendes Prädikat besitzt besonderes Gewicht. Auch hat das Prädikat keine Bestimmtheit an sich und kann daher gut als Fragephrase verwendet werden. Diese Bedingungen werden durch das Satzmuster {13-2.3 Θ [2*]} erfüllt. Das Interrogativpronomen sino oder anọ bildet das Prädikat [1-3].
|
Da in der Regel die Antwort hohe Bestimmtheit besitzt, wird entweder dem Prädikat Bestimmtheit verliehen, oder der Antwortsatz wird so gebildet, dass die Antwortphrase das Subjekt mit Bestimmtheit an sich bildet. Die Antwort [4] hat die gleiche syntaktische Struktur wir die Frage [3], ist aber semantisch nicht gut, da der bestimmte tatay das unbestimmte Prädikat ist. Durch ein adverbiales ANG im Prädikat wird dieser Defekt behoben [5]. Ist die Antwort ein Personenname mit dem Artikel si, so ist auch das Prädikat als bestimmt gekennzeichnet [6]. Gleiches gilt für Personalpronomen als Antwort [7]. Soll die Antwort unbestimmt bleiben, so kann ebenfalls die syntaktische Struktur des Fragesatzes erhalten bleiben [8].
Ein attributives Interrogatvadjektiv kann im Prädikat verwendet werden [9]. In Satz [10] ist das Fragewort im Prädikat die Interogativpräposition nasaạn.
| |||||||||||||||||||
Das Subjekt im filipinischen Satz besitzt stets ein hohes Maß an Bestimmtheit {2-3.1}. Daher ist eine Erfragung des Subjekts ausgeschlossen. Prädikat und Subjekt können ihre Rollen tauschen [1a|b]. Bei der Erfragung des Subjekts wird es nach einem solchen Tausch das erfragbare Prädikat [1b 1c]. In der Antwort gelten die gleichen Regeln, die oben bei der Erfragung des Prädikats dargestellt wurden.
| ||||||||||
(1) Die Objunktphrase besitzt nachgestelltes Verhalten; im possessiven Gebrauch wird sie dem Substantiv nachgestellt und ebenso als Argument dem Verb. Da ein Objunkt nicht am Satzanfang stehen kann, kann es – von Ausnahmen abgesehen – nicht erfragt werden. Um das Objunkt als Argument des Verbs erfragen zu können, werden Aktiv- und Passivverben gewechselt [1a|b]. Damit wird das zu erfragende Objunkt zum Subjekt des Satzes gemacht und dieses wiederum zum Prädikat [1c|d]. Dieses Verfahren ist nur möglich, wenn es geeignete Aktivverben gibt. In einigen Wortfamilien werden bestimmte Aktivverben nahezu ausschließlich für diese Fragesätze verwendet (i. Allg. mag- Verben); in der Antwort werden Passivverben verwendet [2].
| ||||||||||||||||||
(2) Zur Erfragung des possessiven Objunkts (Objunktphrase als Teil der Nominalphrase) kann das SA-Interrogativpronomen kanino(ng) verwendet werden, das dem Substantiv adjektivisch vorangestellt wird [3a] {8-4.7}. Eine Antwort in Form eines possessiven Objunktes ist möglich [3c 3d].
| ||||||||||||
(3) In Sätzen mit Potenzialadverbien mit nominativem Verhalten ist der Erwäger ein Objunkt und kann daher nicht erfragt werden. Durch Bildung eines Existenzsatzes wird er zum Subjekt, das zum erfragbaren Prädikat getauscht werden kann {10-4.1 (4)}.
(4) In Sätzen mit Katatapos als Prädikat ist der Täter ein Objunkt in einem subjektlosen Satz [4a] {6-6.6}. Dieses Objunkt ist aus den oben dargestellten Gründen nicht erfragbar. Häufig wird ein nahezu ungrammatikalisches Gebilde zur Erfragung des Täters gewählt [4b]. Der grammatikalisch richtige Weg ist, statt des Katatapos das Aktivverb zu verwendet, bei dem der Täter nach Tausch von Prädikat und Subjekt erfragt werden kann [4c].
|
Bei der Erfragung von Adjunkten und unabhängigen Phrasen gibt es (fast) keine Beschränkungen, da diese Phrasen am Satzanfang stehen können. Außerdem besitzen sie keine besondere Bestimmtheit. Zu ihrer Erfragung werden die SA-Formen der Interrogativpronomen kanino und saạn [1] oder Interrogativadverbien verwendet [2 3]. Ist die Adjunktphrase Argument eines Verbs, so kann sie bei der Erfragung vor das Verb gestellt werden [1a|b].
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_tanong.html
Die Struktur der Phrasen und ihre Beziehungen zueinander folgen in der filipinischen Sprache verhältnismäßig festen Regeln. Dies ist beim Bau komplizierterer Sätze nicht länger der Fall. Nahezu alle Gebilde, die semantisch verständlich sind, werden grammatikalisch akzeptiert. Dies erschwert eine systematische Betrachtung des Baus komplizierterer Sätze (Beispiel {13A-101 Σ}).
(1) Mit Hilfe des Begriffs Teilsatz (Schlüssel {S-..}, sugnạy) kann der einfache Satz (Schlüssel {S-1}, pangungusap na payạk), der aus nur einem Teilsatz besteht, von einem zusammengesetzten Satz (Schlüssel {S-Tb}, pangungusap na tambalan) mit mehreren Teilsätzen unterschieden werden.
(2) Wir definieren einen Teilsatz dadurch, dass er ein Prädikat besitzt [1a 1b 2a 2b]. Ist der Teilsatz verkürzt [2b], muss er zu einem einfachen Satz mit diesem Prädikat erweitert werden können [2c]. Damit schließen wir unabhängige Phrasen [3] und einige Gebilde mit Konjunktionen [4] als Teilsätze aus.
| |||||||||||||
(3) Viele Teilsätze, aber auch Attribute werden mit einer Ligatur verbunden. Ein solches Attribut kann erweitert werden, so dass ein Ligatursatz entstehen kann {13A-441 Θ}. Konjunktionen können Teilsätze einleiten, aber auch innerhalb von Teilsätzen verwendet werden (als Konjunktion oder als Adverb). Für verknüpfungslose Teilsätze bestehen keine festen Regeln bezüglich trennender Satzzeichen; auch werden Satzzeichen zur Abtrennung von unabhängigen Phrasen verwendet.
Wir teilen einfache Sätze in zwei Gruppen ein, Regelsätze und Nicht-Regelsätze. Unter einem Regelsatz (pangungusap na batayạn) verstehen wir einen einfachen Satz, der Prädikat, Subjekt und möglicherweise unabhängige Phrasen besitzt {1-5.1 (4)}. Seine Struktur ist
{P-P} {P-T} {P-../L}
(2) Besondere Formen der Regelsätze sind Imperativsätze {13-2.1.3} und Fragesätze {12}.
(3) Die Reihenfolge von Prädikat und Subjekt kann unterschiedlich sein; das macht den Satzbau sehr flexibel. Es gibt jedoch eine vorzugsweise verwendete kanonische Reihenfolge (ayos na karaniwan), bei der das Subjekt nach dem Prädikat folgt. Umgekehrt ist die nichtkanonische Reihenfolge (ayos na kabalikạn). Bis heute gibt es linguistische Diskussionen, wann welche Reihenfolge "angemessen" ist {13A-211}. Im Schlüsselsystem wird der Schlüssel der Reihenfolge an den Schlüssel des Teilsatzes gefügt {14A-9}.
Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für den einfachen Satz und für Teilsätze.
(1) Die kanonische Reihenfolge von Prädikat und Subjekt wird in der Umgangssprache fast regelmäßig angewandt und vorwiegend in der Schriftsprache. Das Kernwort des Prädikats steht vor dem Subjekt. Sätze mit kanonischer Reihenfolge werden mit dem Schlüssel {S-../PT} bzw. {S-../YPT} gekennzeichnet.
| |||||||
(1) Bei nichtkanonischer Reihenfolge steht das Subjekt vor dem Prädikat. Vor das Prädikat wird das Bestimmungswort ay gesetzt [1]. Die Schlüsselbezeichnung ist {S-../TYP}.
(2) In vielen Fällen liegen besondere Gründe vor, wenn die nichtkanonische Reihenfolge gewählt wird.
| |||||||||||||
(3) Einige Gruppen von Regelsätzen werden nur sehr selten in nichtkanonischer Reihenfolge gebildet. Dazu gehören
(4) Die nichtkanonische Reihenfolge kann als besonderes Stilmittel verwendet werden {W Stat P-S 3.1 "Daluyong"}. In der Umgangssprache sind Sätze in nichtkanonischer Reihenfolge selten.
(1) Im Allgemeinen sind Imperativsätze (pangungusap na pang-utos) Regelsätze. Vorzugsweise werden sie mit Verben und in kanonischer Reihenfolge gebildet [1]. Auch gibt es subjektlose Nicht-Regelsätze [2], ebenfalls Interklitgebilde [3]. Das Verb steht in der Regel im Infinitiv [1-3]. Die filipinische Sprache besitzt keine besondere Imperativform (pautọs).
Semantisch gibt ein Imperativsatz nur Sinn, wenn der Angesprochene als potenzieller Täter die Tat ausführen oder veranlassen kann. Damit zusammenhängend, werden Imperativsätze in der Regel mit einfachen Verben gebildet [1-3]; mit Verben der Fähigkeit ist dies nicht möglich [5a]. Verneinende Imperativsätze werden mit dem Potenzialadverb huwạg (hindị) gebildet [3].
|
(2) Weil sich Imperativsätze sich nicht wesentlich von Aussagesätzen
unterscheiden, kann der Imperativsatz formal zu einem Aussagesatz gemacht werden, wenn ihm
ein Adverb zugefügt wird ('optative particle' bei
{![]() Kroeger 1991 p. 111f.}) [4 5b].
Kroeger 1991 p. 111f.}) [4 5b].
|
(3) Verblose Imperativsätze sind seltener, vermutlich wegen der mangelnden spezifischen Erkennung [6-8]. In vielen Fällen werden diese verblosen Imperativsätze vermieden, indem ein passendes Verb verwendet wird [9-11].
|
Orthografisch erhalten Imperativsätze einen Punkt, ein Ausrufezeichen kann zu ihrer besseren Erkennung gesetzt werden.
Als Nicht-Regelsätze (pangungusap na di-batayạn) bezeichnen wir Sätze mit einem Satzbau, der von dem der oben dargestellten Regelsätze abweicht. Dazu gehören Interklit-, Interpotenzialsätze und subjektlose Sätze.
(1) Der häufigste Nicht-Regelsatz ist der Subjektinterklit. Das semantische Subjekt des Satzes ist ein enklitisches Pronomen; syntaktisch besitzt der Satz kein Subjekt {11-6.3 (3) Θ}. Das Pronomen wird vor das Kernwort des Prädikats gestellt [1].
(2) Im Subjektinterpotenzial {9-6.1.1} besitzt das Subjekt sein Bestimmungswort, steht jedoch vor dem Kernwort des verbalen Prädikats [2]. Da vor diesem eine Ligatur und nicht das Bestimmungswort des Prädikats steht, zählen wir diese Gebilde zu den Nicht-Regelsätzen. Die Ähnlichkeit mit dem Subjektinterklit ist auffällig.
|
(1) Ein Satz drückt einen vollständigen Gedanken aus (buọng kaisipạn). In vielen Fällen stellt das Prädikat bereits den vollständigen Gedanken dar, so dass der Satz aus semantischen Gründen kein Subjekt benötigt (Schlüssel {S-../P0} oder {S-../YP0})
|
(2) Ebenso ohne Subjekt sind
Die direkte Rede (pagsasalitạng sinipi) ist ein zusammengesetzter Satz. Der Ankündigungssatz (sugnạy ng pagpapahayag) steht im Allgemeinen nach der direkten Rede und ist ein subjektloser Nicht-Regelsatz [1 2]. Wie die Beispiele [3 4] zeigen, können auch andere Gebilde den Ankündigungssatz bilden. Eine Besonderheit sind die Bildungen mit a- [5].
|
Steht am Ende der direkten Rede ein Punkt, so wird dieser vor dem Ankündigungssatz durch ein Komma ersetzt [6]. Andere Satzzeichen bleiben erhalten [7].
|
Unter Satzbrüchen verstehen wir Sätze, die keine einheitliche syntaktische Struktur besitzen. Ein Satz wird begonnen, dann in einer anderen Syntax fortgesetzt. Dabei entstehen zwei oder mehrere Teile, von denen keiner (oder zumindest nicht alle) einen grammatikalischen Teilsatz bildet. Dies geschieht in der gesprochenen Sprache häufig und oft unbeabsichtigt [1b]. In der geschriebenen Sprache können Satzbrüche als Stilmittel eingesetzt werden, sind jedoch selten [2]. Mit Hilfe von Satzbrüchen können Sätze mit nichtkanonischer Reihenfolge von Prädikat und Subjekt vermieden werden (kein ay nach ang kanyạng inạ in [2]).
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_usap_1.html
(1) Der einfache Satz besitzt ein Prädikat und ein Subjekt. Die anderen Phrasen (vorwiegend Objunkt und Adjunkt) sind Teile von Prädikat und Subjekt. Zusätzlich können unabhängige Phrasen im Satz stehen. Damit ergibt sich folgender Aufbau des einfachen Satzes:
{P-P} {P-T} {P-../L}
Das Wesen der unabhängigen Phrasen ist leicht zu verstehen, so dass wir sie in den folgenden Betrachtungen weglassen können. Wir können dann sagen, dass der filipinische Satz aus zwei wesentlichen Teilen besteht, Prädikat und Subjekt:
{P-P} {P-T}
(2) Wegen der Austauschbarkeit und der Symmetrie von Prädikat und Subjekt ist nicht zu erwarten, dass Prädikat und Subjekt sehr unterschiedlich voneinander sind. Andererseits unterscheidet die Sprache deutlich zwischen Prädikat und Subjekt. Strengen Regeln folgt der Gebrauch von ang und ay. Der Gebrauch dieser beiden Bestimmungswörter verdeutlicht die Unterschiede der beiden Grundelemente des Satzes. Man kann nicht deutlich angeben, was das "Wesen" von Prädikat und Subjekt ist, aber es sehr deutlich, was das Prädikat und was das Subjekt ist. Diese Schwierigkeit ist Folge der Tatsache, dass nahezu jede Phrase Prädikat, aber auch Subjekt sein kann. So kann eine Wortarteneinteilung, wie auch immer, nicht zur inhaltlichen Unterscheidung von Prädikat und Subjekt führen.
(3) Zu einem guten Verständnis des filipinischen Satzes ist es daher erforderlich, nach Unterschieden zwischen Prädikat und Subjekt zu suchen. Deutlich sichtbar ist die Bestimmtheit des Subjekts (sofern es ein Nomen ist), während ein Nomen als Prädikat diese Eigenschaft nicht a priori besitzt.
Bei {![]() Lopez 1940 p. 117} findet sich der Ansatz, dass das Subjekt mit seiner
Bestimmtheit das "Bekannte" ist, das mit dem "unbekannten" Prädikat verbunden wird
('known' – 'unknown'). Dann ist festzustellen, dass der
filipinische Satz aus zwei Grundelementen besteht, von denen eines (das Prädikat) etwas
"primärer" und etwas "unbekannter" ist und das dieses Element zu dem etwas "weniger
primären" und etwas "bekannterem" Subjekt führt.
Lopez 1940 p. 117} findet sich der Ansatz, dass das Subjekt mit seiner
Bestimmtheit das "Bekannte" ist, das mit dem "unbekannten" Prädikat verbunden wird
('known' – 'unknown'). Dann ist festzustellen, dass der
filipinische Satz aus zwei Grundelementen besteht, von denen eines (das Prädikat) etwas
"primärer" und etwas "unbekannter" ist und das dieses Element zu dem etwas "weniger
primären" und etwas "bekannterem" Subjekt führt.
(4) Bemerkenswert ist ein Unterschied im Gebrauch der Bestimmungswörter ay und ang. Die Verwendung von ay hängt ausschließlich davon ab, wo das Prädikat im Satz steht und nicht vom Bau des Prädikats. Die Verwendung bzw. das Fehlen von ang hängt ausschließlich vom Inhalt des Subjekts ab und nicht von dessen Positionierung im Satz. Dieser Unterschied zwischen Prädikat und Subjekt wird wesentlich, wenn diese Phrasen nicht am Satzanfang stehen. Es gibt Subjekte stets ohne ang (z.B. Pronomen), während Prädikate an bestimmten Positionen im Satz stets ay besitzen. Damit wird ein Subjektinterklit ermöglicht und ein Prädikatinterklit unmöglich.
(5) Für Verben als Prädikat oder Subjekt haben wir den Begriff des Arguments eingeführt. Dieser Begriff kann auf Nomina und Adjektive ausgedehnt werden, wenn sie Prädikat oder Subjekt sind. Dann können wir eine formale Gleichheit von Verb, Nomen, Adjektiv und Präpositionalphrase bei Verwendung als Prädikat und Subjekt feststellen. Wenn wir die Inhaltsphrase von Prädikat oder Subjekt, die Argumente besitzt, vereinfacht mit {P-X} bezeichnen, sehen wir zwei Formen des filipinischen Satzes in kanonischer Reihenfolge [1* 2*].
| [1*] | {P-P=P-X} {P-X(X Argument 2 Argument 3)} | {P-T=[Argument 1 mit Bestimmtheit]} | |
| [2*] | {P-P=[Argument 1 ohne Bestimmtheit]} | {P-T=P-X} {P-X(X Argument 2 Argument 3)} |
Die Satzform [1*] ist leicht zu erklären: Das "primäre, aber weniger bekannte" {P-X} als Prädikat wählt eines seiner Argumente und setzt es auf die gleiche Höhe neben sich, wobei dieses Argument "bekannt" wird. An dieser Stelle, dem Subjekt, ist nur Platz für ein Argument, die anderen Argumente müssen auf der Seite des "weniger bekannten" {P-X} bleiben.
Schwieriger ist in diesem Ansatz die Satzform [2*]. Offenbar sucht sich ein "weniger bekanntes Argument" – jetzt als Prädikat – sein {P-X} und setzt es neben sich. Bei {P-X} stehen auch hier die weiteren Argumente.
Hinzu kommen zwei weitere Formen in nichtkanonischer Reihenfolge [3* 4*], wobei die Beziehungen zwischen Prädikat und Subjekt die gleichen wie oben in [1* 2*] sind.
| [3*] | {P-T=[Argument 1 mit Bestimmtheit]} | ay | {P-P=P-X} {P-X(X Argument 2 Argument 3)} |
| [4*] | {P-T=P-X} {P-X(X Argument 2 Argument 3)} |
ay | {P-P=[Argument 1 ohne Bestimmtheit]} |
(6) Unschwer lassen sich in dieses Modell Nicht-Regelsätze ohne Subjekt einfügen [5*]. Das "primäre, aber weniger bekannte" {P-X} verzichtet, ein Argument neben sich zu setzen, und setzt die Argumente unter sich:
| [5*] | {P-P=P-X} {P-X(X Argument 1 Argument 2)} | --- |
(7) Dieses Modell erklärt gut, warum die filipinische Sprache die kanonische Reihenfolge von Prädikat und Subjekt bevorzugt. Das "primäre" Prädikat führt zum nachfolgenden Subjekt. Außerdem wird in dieser Darstellung deutlich, dass die filipinische Sprache keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Sätzen mit Verb und ohne Verb macht. Auch bleibt es für das Verständnis der Satzstruktur unerheblich, ob und wie man Wortarten definiert.
(1) Sätze mit Verben als Prädikat oder Subjekt sind bei weitem die häufigsten Sätze in der filipinischen Sprache. In der kanonischen Reihenfolge (mit Verb als Prädikat) zeigt das Verb bereits am Beginn des Satzes an, welche semantische Funktion die folgenden Argumente – Objunkte, Adjunkt und Subjekt – haben. Vorzugsweise stehen die zur Verbphrase gehörenden Phrasen unmittelbar nach dem Verb, und das Subjekt folgt am Ende des Satzes [1]. Ebenfalls am Satzanfang steht die Verbphrase, wenn sie Subjekt ist und der Satz nichtkanonische Reihenfolge besitzt [2]. Diese Sätze sind selten.
| |||||||||||||
(2) Das Verb steht nicht am Satzanfang, wenn der Satz nichtkanonische Reihenfolge besitzt [3] oder wenn das Verb Subjekt in kanonischer Reihenfolge ist [4-6]. In diesen Sätzen steht eine Nominalphrase (erstes Argument des Verbs) am Satzanfang und erhält dadurch Gewicht. Wie Satz [6] zeigt, ist dies der typische Satzbau für Phrasenfragen.
| ||||||||||||||||||||
(1) In Sachtexten sind Sätze häufig, die Nominalphrasen als Prädikat und Subjekt besitzen. Das "Bekannte" (Subjekt mit Bestimmtheit) erläutert das "Unbekannte", besonders in wissenschaftlichen Texten. Dafür eignet sich die nichtkanonische Reihenfolge [1], ist jedoch nicht immer erforderlich [2].
(2) Wenn sowohl Prädikat und Subjekt Nominalphrasen sind, schafft ein Tausch von Prädikat und Subjekt syntaktisch keinen neuen Satztyp, verändert jedoch die Semantik [3|4].
| |||||||||||||||||||
Nominalphrasen, die Adjektiven zugeordnet sind, können als Argumente betrachtet werden. Das erste Argument ist der Besitzer der Eigenschaft [1-4]. Ein weiteres Argument kann hinzukommen, die Eigenschaft näher zu beschreiben [2-4].
| |||||||||||||||||||
Sätze mit Präpositionalphrase als Prädikat oder Subjekt besitzen nur einen (oder keinen) Beteiligten, den man als Argument betrachten kann. In Existenzphrasen ist das der semantische Besitzer [1 2], in nasa Phrasen der "statische Täter" [3]. Präpositionalphrasen der tungkol Gruppe als Prädikat oder Subjekt sind selten [4].
| |||||||||||||||||||
(1) In der Regel werden Phrasen durch ihre Bestimmungswörter eingeleitet. Das gilt nicht nur für die Phrasen, die unmittelbar den Satz bilden, sondern auch für untergeordnete Phrasen. Das Ergebnis ist, dass sich im filipinischen Satz Bestimmungswörter und andere Wörter regelmäßig abwechseln. Wir stellen dies an dem folgenden Beispiel [1a] dar.
| ||||||
(2) Von diesem Satzmuster gibt es Abweichungen. Zunächst gibt es eine größere Anzahl Fälle, wo vor einem Wort kein Bestimmungswort steht. In unserem Beispiel [1b] sind dies:
|
(3) Seltener sind die Fälle, wo zwei Bestimmungswörter unmittelbar aufeinander folgen (in Beispiel [1] keine):
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_usap_2.html
(1) Neben dem einfachen Satz, bei dem ein Teilsatz allein einen vollständigen Gedanken ausdrückt, gibt es den zusammengesetzten Satz, der aus mehreren Teilsätzen gebildet wird. Wir können diese Teilsätze gruppieren entsprechend ihrer Abhängigkeit von anderen Teilsätzen. Da jedoch der syntaktische Bau aller Teilsätze im Prinzip gleich ist, ist diese Einteilung in bestimmten Fällen nur semantisch möglich.
(2) Ferner können wir Teilsätze danach unterscheiden, wie sie mit
anderen Teilsätzen in einem zusammengesetzten Satz verbunden sind {13A-401 ![]() }.
}.
(3) In einem verkürzten Teilsatz (sugnạy na pinaiklị) ist eine Phrase weggelassen, weil sie semantisch gleich einer Phrase eines anderen Teilsatzes ist {13-4.6}. Durch die Verkürzung kann das Subjekt werfallen, der Teilsatz wird ein Nicht-Regelsatz. Häufig werden Ligatursätze so gebildet.
Zusammengesetzte Sätze können aus unabhängigen Teilsätzen ohne Anbindung bestehen [1] (sugnạy na walạng pagkakakabịt, Schlüssel {S-0}). In Satz [2a] ist die Konjunktion weggelassen, der Teilsatz ist ohne Anbindung.
|
(1) Teilsätze können durch Konjunktionen (pangatnịg [katnịg]) in Beziehung zu anderen Teilsätzen gesetzt werden. Wir sprechen dann von Konjunktions-Teilsätzen oder kurz Konjunktionssätzen (Schlüssel {S-K}). Besondere Sätze bilden einige Konjunktionen zusammmen mit Fragewörtern {13-4.2.1}. Einige Konjunktionen (wie upang und bago) werden mit Verben im Infinitiv verbunden {13-4.2.2}.
(2) Die Mehrzahl der Konjunktionen sind Kurzwörter [1-3], einige davon enklitisch (Beispiel man [2]). Einige Konjunktionen können an der zweiten Stelle im Satz stehen, obwohl sie nicht enklitisch sind [3a|b]. Einige Konjunktionen können mit einer Ligatur verwendet werden [4] oder sie dienen als Bezugswort eines Enklitgebildes [5], in diesen Fällen sind sie Inhaltswörter. Konjunktionen können nicht deutlich von anderen Wortarten unterschieden werden, vor allem nicht von Adverbien [3b 4].
|
| Konjunktionen | |||||
| at | bagamạn (ba) | bago | dahil | habang | |
| hanggạt (hanggạng) | kahit | kapạg (pag) | kasị | ||
| kayạ | kundị | kung | man | nang | ngunit |
| o | pag | para | pagkạt (pag) | pero | |
| sapagkạt | subalit | pagkatapos (tapos) | tuwịng | upang | |
| yamang | |||||
(3) Innerhalb eines Teilsatzes können Konjunktionen verwendet werden, um besondere Beziehungen zwischen Phrasen auszudrücken. Dabei können gleichartige Phrasen verbunden werden [6], oder es kann eine besondere semantische Beziehung einer Phrase angezeigt werden [7]. In letzterem Fall werden Konjunktionen Adverbien sehr ähnlich.
|
Die Konjunktionen kung, kahit und man werden zusammmen mit Interrogativa verwendet [1 2] {8-4.3.1}. Diese werden dabei in Indefinitpronomen, -adjektive oder -adverbien gewandelt. Die Konjunktion bagamạn (ba) |baga+man| kann ebenfalls zu dieser Gruppe gerechnet werden [3].
|
(1) Einige Konjunktionen leiten untergeordnete Teilsätze ein, deren Verb im Infinitiv steht [1]. Dazu gehören nang, para, upang und pagkatapos (tapos). Andere Konjunktionen (bago, kung) können wahlweise mit Infinitiv oder Zeitform verbunden werden [2|3]. Die mit diesen Konjunktionen gebildeten Teilsätze sind häufig verkürzt [1 2].
|
(2) Die Konjunktion upang kann in ein Affix pang- oder pampa- gewandelt werden und mit dem Verb verschmolzen werden [4-6]. Die Verschmelzung ähnelt einem Adjektiv, und die Syntax wird entsprechend angepasst. Ob die entstehende Bildung noch als verkürzter Teilsatz betrachtet werden kann, ist fraglich.
|
(1) Unter Ligatursätzen (Ligaturteilsatz, Schlüssel {S-L}, sugnạy na makaangkọp [panlapạg]) verstehen wir Teilsätze, die mit der Ligatur angeschlossen werden. Entsprechend der Stufenfunktion der Ligatur {5-2 (2)} eignet sie sich zum Anschluss von untergeordneten Teilsätzen. Häufig wird das getrennte Wort na vorgezogen, auch wenn -ng phonologisch möglich ist. Ligatursätze können den übergeordneten Teilsatz ergänzen oder eine seiner Phrasen. In letzterem Fall ist das Kernwort dieser Phrase das Bezugswort (salitạng kaugnạy) des Ligatursatzes. Auch kann der Ligatursatz ein Argument im übergeordneten Teilsatz ersetzen {6-2.5}.
(2) In der überwiegenden Zahl der Ligatursätze steht nach der Ligatur das das Prädikat bildende Verb am Anfang des Teilsatzes {13-4.3.1}. In 'besonderen' Ligatursätzen steht kein Verb am Anfang des Ligatursatzes {13-4.3.2}.
In der überwiegenden Zahl der Ligatursätze steht die das Prädikat bildende Verbphrase am Anfang des Teilsatzes. Eines der Argumente des Verbs wird nicht wiederholt, wenn es gleich dem Bezugswort des Ligatursatzes ist. Deshalb ist der Ligatursatz verkürzt. Beispiele für diese Gebilde sind die Sätze [1a 2a 3a 3b]. In [1a|b 2a|b] ist im Ligatursatz das Subjekt weggelassen (Nicht-Regelsatz), in [3a|c 3b|d] das Objunkt. Verkürzt, aber Regelsätze sind die Ligatursätze [3a 3b]. Der Ligatursatz kann sich auf den gesamten übergeorneten Teilsatz beziehen [4 5a], besitzt dann kein Bezugswort und ist in der Regel nicht verkürzt [4] (jedoch [5a|b]). Steht ein Fragewort am Anfang des untergeordneten Satzes, wird ein Konjunktionssatz mit kung gebildet [6].
In der Regel wird der Ligatursatz dem Bezugswort nachgestellt. Er kann auch vorangestellt werden [2a].
| |||||||||||||||||||||||||
(1) In den hier betrachteten Ligatursätzen steht kein Verb am Anfang des Ligatursatzes. In der Regel werden diese Ligatursätze mit einer Ligatur verbunden, jedoch kann die Ligatur durch ein Bestimmungswort ergänzt oder ersetzt werden.
(2) Eine erste Gruppe dieser besonderen Ligatursätze sind verblose Teilsätze mit kanonischer Reihenfolge von Prädikat und Subjekt. Am Anfang des Teilsatzes steht das Prädikat (Substantiv [1 2], Adjektiv [3] oder Existenzphrase [4]).
| |||||||||||
(3) Eine zweite Gruppe sind Ligatursätze, bei denen am Teilsatzanfang nicht das Prädikat steht (in [5] das Subjekt mit ang, in [6] das Subjekt ohne Bestimmunswort, in [7] ein unabhängiges Adjunkt mit sa). Nach der Ligatur steht das Bestimmungswort der ersten Phrase des Ligatursatzes {13-3 Θ (3)}.
| ||||||||||||
(4) Eine dritte Gruppe wird von zusammengesetzten Sätzen gebildet, bei denen der zweite Teilsatz das Prädikat des zusammengesetzten Satzes ist (Ersetzungssatz Prädikat) [8a 9], während der erste Teilsatz das Subjekt ist. Die Teilsätze sind ohne Anbindung (also nicht Ligatursätze im engeren Sinn), da keine Ligatur vor dem Bestimmungswort ay steht, um die Teilsätze zu verbinden.
| ||||||||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_usap_3.html
Wir bezeichnen als 'Ligaturgebilde' alle Gebilde, die eine Ligatur besitzen. Ligaturgebilde sind Attribute (Subjunktphrase) oder Teilsätze (Ligatursatz) {13A-441 Θ}. Eine besondere Betrachtung verdienen dabei Sätze mit verbundenen Verben {6-7.2}.
Verbundene Verben bilden zusammengesetzte Sätze mit dem übergeordneten Verb als Prädikat des übergeordneten Satzes und dem untergeordneten Verb als Prädikat eines Ligatursatzes. Damit werden die verbundenen Verben syntaktisch getrennt, jedes Verb kann in seinem Teilsatz seine Argumentstruktur entfalten. Die Verben sind dann nur noch semantisch verbunden. Diese Gebilde sind mit verbundenen Verben stets möglich, aber weniger elegant als einfache Sätze. Sie werden daher in der Regel nur verwendet, wenn der Bau eines einfachen Satzes auf Schwierigkeiten stößt:
| |||||||||||||||
Wenn die Argumentstruktur des untergeordneten Verbs zu der des übergeordneten "passt", kann ein einfacher Satz gebildet werden [1-3]. Die Argumente beider Verben werden in einer Argumentstruktur zusammengefasst. Wenn das untergeordnete Verb keine Argumente (oder keine eigenen [3]) besitzt, ist der Satz einfach. Das Subjunkt des untergeordneten Verbs wird Argument des übergeordneten. Wenn der Satz einfach ist, kann er auch als zusammengesetzt betrachtet werden [4].
| ||||||||||||||||||||
In {9-6..} betrachten wir die Potenzialadverbien (Modalwörter). Verbundene Verben werden in {6-7.2} und den vorangegangenen Abschnitten behandelt. Hier möchten wir einige Eigenschaften beider Gruppen vergleichen.
| Modalwörter | Verbundene Verben | |
| Gebilde | ||
| Modalwort + Verb | Übergeordnetes Verb + untergeordnetes Verb | |
| Modalwort ist Attribut des Verbs. | Im zusammengesetzten Satz bildet
das untergeordnete Verb einen Ligatursatz. Im einfachen Satz ist das untergeordnete Verb Argument des übergeordneten Verbs. | |
Argumente | ||
| Das Modalwort besitzt keine Argumente. | Beide Verben besitzen Argumente. | |
| Argumentstruktur des Verbs kann wegen des Modalwortes verändert werden. | Ein einfacher Satz wird ermöglicht, wenn beide Argumentstrukturen konfliktfrei zu einer zusammengefasst werden können. | |
| Im zusammengesetzten Satz kann im untergeordneten Teilsatz auf die Wiederholung von Argumenten verzichtet werden. | ||
| Reihenfolge der Argumente wird durch Regeln von Interklit und Interpotenzial bestimmt. | Reihenfolge der Argumente im einfachen Satz wird durch Bedingung "konfliktfrei" bestimmt. | |
Satz | ||
| Stets einfacher Satz. | Zusammengesetzter Satz ist stets möglich, kann häufig zu einfachem Satz verschmolzen werden. | |
| Sätze mit Modalwörtern besitzen nur ein Subjekt (oder sind subjektlos). | Zusammengesetzter Satz kann zwei Subjekte besitzen. | |
Morphologische Wortarten | ||
| Die Bezeichnung Potenzialadverb unterstreicht, dass Modalwörter keine Verben sind. | Beide Verben besitzen Verbaffigierung, Diathese, Tempus und eigene Argumente. | |
Eine besonderer Satzbau in der filipinischen Sprache ist, dass ein übergeordneter und ein untergeordenter Teilsatz das gleiche Subjekt besitzen [1]. Der voranstehende Teilsatz hat kanonische Reihenfolge von Prädikat und Subjekt und endet daher mit dem Subjekt. Diese Phrase bildet das Subjekt des nachfolgenden Teilsatzes, der nichtkanonische Reihenfolge besitzt und daher mit dem Subjekt beginnt, das jedoch nicht wiederholt wird. Wir bezeichnen den untergeordneten Teilsatz als 'Teilsatz mit gemeinsamem Subjekt' (sugnạy na may magkasamang paniyạk, Schlüssel {S-T}). Wir betrachten den übergeordneten Teilsatz als Regelsatz und den untergeordneten als Nicht-Regelsatz ohne Subjekt. Der erste der beiden Teilsätze kann eine Konjunktion besitzen [2]. Sätze wie [3] können ebenfalls als Teilsätze mit gemeinsamem Subjekt betrachtet werden.
| Teilsatz 1 | Prädikat | Subjekt | |
| Teilsatz 2 | ay | Prädikat |
|
Im verkürzten Teilsatz ist eine Phrase weggelassen. Sie wird nicht wiederholt, wenn sie bereits in einem anderen Teilsatz steht. Wenn das Subjekt weggelassen wird, ist der verkürzte Teilsatz ein Nicht-Regelsatz.
Der Satz muss semantisch deutlich bleiben, wenn eine Phrase weggelassen wird. Das ist stets der Fall, wenn im untergeordneten Teilsatz das Subjekt des übergeordneten Teilsatzes nicht wiederholt wird {13-4.6.1}. Andere Gebilde werden in {13-4.6.2} und {13-4.6.3} beschrieben.
In den weitaus meisten verkürzten Teilsätzen wird das Subjekt weggelassen, da eine Wiederholung nicht erforderlich ist, weil das Bezugswort das Subjekt des vorangegangenen Teilsatzes ist. Der verkürzte Teilsatz wird ein subjektloser Nicht-Regelsatz.
| ||||||||||||||||||||||
Das im Teilsatz fehlende Subjekt kann sich auf eine Phrase beziehen, die nicht Subjekt ist. Der verkürzte Teilsatz ist ein subjektloser Nicht-Regelsatz. Wenn der Teilsatz unmittelbar auf ein Bezugswort folgt, ist es unerheblich, welche Funktion das Bezugswort im übergeordneten Satz besitzt [1-3].
| ||||||||||||||||||
(1) In einer Anzahl von Fällen kann auf die Wiederholung einer Phrase verzichtet werden, obwohl sie nicht Subjekt des Teilsatzes ist. Der Teilsatz ist ein verkürzter Regelsatz. Definitionsgemäß gehören einfache Sätze nicht zu der hier betrachteten Gruppe [2] {9A-611 Θ (2)}.
(2) Mit der Konjunktion bago werden verkürzte Teilsätze gebildet, denen das Prädikat fehlt [3].
| ||||||||||||||||
Die filipinische Syntax besitzt eine hohe Flexibilität in der Wahl des Satzbaues. Im westlichen Stil (pananalitạng kanluranịn, pananalitạng pormạl) wird diese Flexibilität verwendet, um die Syntax weitgehend an die von europäischen Sprachen anzupassen. Vorbild war früher die spanische Sprache, heute ist es die englische Sprache. Der westliche Stil zeichnet sich durch Folgendes aus (Beispiele in {13A-511}):
Der westliche Stil hat eine lange Tradition in den Philippinen. Bereits das erste in den
Philippininen gedruckte Buch {![]() DC 1593} zeigt Elemente dieses Stils, und noch bei Lopez
{
DC 1593} zeigt Elemente dieses Stils, und noch bei Lopez
{![]() Lopez 1941} wird in den Beispielsätzen regelmäßig die
nichtkanonische Reihenfolge von Prädikat und Subjekt verwendet. Der westliche Stil in
Schulbüchern soll der Eindruck vermitteln, dass dieser Stil das "richtige, gute" Filipino
sei, das bei "formalen Anlässen" zu verwenden sei. Von einigen akademischen Texten
abgesehen, kommt der westliche Stil in der außerschulischen Schriftsprache und in der
gesprochenen Sprache so gut wie nicht vor. Häufig wird suggeriert, dass der westliche Stil
erforderlich sei, um moderne Sachtexte darzustellen. Ein Gegenbeweis ist ein akademischer
Text von E. Q. Javier {W Javier}. Eine
besonders gute Übersetzung ohne jegliche Elemente des westlichen Stils hat
{
Lopez 1941} wird in den Beispielsätzen regelmäßig die
nichtkanonische Reihenfolge von Prädikat und Subjekt verwendet. Der westliche Stil in
Schulbüchern soll der Eindruck vermitteln, dass dieser Stil das "richtige, gute" Filipino
sei, das bei "formalen Anlässen" zu verwenden sei. Von einigen akademischen Texten
abgesehen, kommt der westliche Stil in der außerschulischen Schriftsprache und in der
gesprochenen Sprache so gut wie nicht vor. Häufig wird suggeriert, dass der westliche Stil
erforderlich sei, um moderne Sachtexte darzustellen. Ein Gegenbeweis ist ein akademischer
Text von E. Q. Javier {W Javier}. Eine
besonders gute Übersetzung ohne jegliche Elemente des westlichen Stils hat
{![]() Ching 1991} vorgenommen ('Le petit prince' von A.
de Saint-Exupery).
Ching 1991} vorgenommen ('Le petit prince' von A.
de Saint-Exupery).
Mit Taglish wird ein Stil bezeichnet, in dem häufig englische Einsprengsel in der filipinischen Sprache verwendet werden. Taglish beeinflusst die filipinische Syntax kaum. Die englischen Einsprengsel bilden gesonderte (Teil-) Sätze oder werden vollständig in die filipinische Syntax eingepasst (Beispiel: yellow na bulaklạk).
Taglish und westlicher Stil schließen einander weitgehend aus.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_usap_4.html
{1A-101 ![]() } Zitat
Martin Luther
} Zitat
Martin Luther
'Denn man mus nicht die buchstaben inn der Lateinischen sprachen fragen / wie man sol Deudsch reden / wie diese Esel thun / Sondern man mus die mutter ihm hause / die kinder auff der gassen / den gemeinen man auff dem marckt drümb fragen / und den selbigen auff das maul sehen / wie sie reden / und darnach dolmetschen / so verstehen sie es denn / und mercken / das man Deudsch mit ihn redet.'
Martin Luther: Sendbrief vom Dolmetschen (1530, nach der Ausgabe des Max Niemeyer Verlages, Halle, 1968).
Wenn wir dieses Zitat auf unsere Studien der filipinischen Sprache anpassen dürfen, können wir sagen:
"Man muss nicht die spanische oder englische Grammatik befragen, wie man Filipino reden soll. Sondern man muss die Mutter zu Hause, die Kinder auf der Straße und die einfachen Leute auf dem Markt fragen und muss ihnen auf den Mund sehen, wie sie reden. Danach muss man die Grammatik aufbauen, damit diese Menschen es verstehen und ihre eigene Sprache darin erkennen."
{1A-111 ![]() } Philippinische Linguistik und fremde
Sprachen
} Philippinische Linguistik und fremde
Sprachen
Ernesto Lopez wird als Vater der philippinischen Linguistik betrachtet. Alle seine
Arbeiten sind in Englisch abgefasst (mit Ausnahme der wenigen in Deutsch und
Französisch), und häufig ist sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, welche Entsprechungen
filipinische Gebilde im Englischen besitzen (viele Beispiele in
{![]() Lopez 1941}). Beispielsätze sind nahezu regelmäßig im
westlichen Stil abgefasst.
Lopez 1941}). Beispielsätze sind nahezu regelmäßig im
westlichen Stil abgefasst.
{1A-112} Muttersprache
Ein geeigneter Begriff für Muttersprache ('mother tongue') ist in den Philippinen wenig gebräuchlich; wir übernehmen von {W Salazar 1.1.17} den Ausdruck wikang kinagisnạn ('Sprache, in der man aufgewachsen ist'). Häufig werden Begriffe wie katutubong wika ('einheimische Sprache') verwendet. Das Wort katutubo wird im Allgemeinen mit sinauna 'aus der Urzeit' und makaluma 'altmodisch' assoziert, hat also in der Regel eine negative Wertung. Damit wird die besondere Funktion der Muttersprache in der persönlichen Entwicklung nicht gesehen.
Für den Begriff 'Sprachgefühl' ('speech-feeling' bei
{![]() Bloomfield 1917 § 332}) verwenden wir eine wörtliche Übersetzung
pakiramdạm-wika F, während sich bei
{
Bloomfield 1917 § 332}) verwenden wir eine wörtliche Übersetzung
pakiramdạm-wika F, während sich bei
{![]() Lopez 1941 p. 94}) das deutsche Wort 'Sprachgefühl' findet. In der
modernen Linguistik urteilt der Muttersprachler mit seinem Sprachgefühl über die
Grammatikalität.
Lopez 1941 p. 94}) das deutsche Wort 'Sprachgefühl' findet. In der
modernen Linguistik urteilt der Muttersprachler mit seinem Sprachgefühl über die
Grammatikalität.
{1A-121} Gegenwartssprache in den Philippinen
Die Sprache im philippinischen Alltag ist ein kompliziertes und wenig erforschtes Thema. In der Regel findet man (zu) viel Information über die verschiedenen Sprachen und Dialekte, aber wenig über den Gebrauch der Landessprache. Um dieses Problem zu umgehen, wollen wir zwischenzeitlich einen Begriff Kayumanggi (Kayumanggị ist ein einheimisches Wort, das Hautfarbe und Rasse der Filipinos beschreibt) einführen, der bedeuten soll "die offizielle Hochsprache oder eine andere Sprache bzw. ein Dialekt philippinischen Ursprunges". Kayumanggi ist also eine Abgrenzug gegenüber Englisch, Chinesisch, Spanisch usw.
Wer als Besucher in die Philippinen kommt, sieht ein englischsprachiges Land vor sich. Im Hotel gibt es englischsprachige Zeitungen. Speisekarten und auch die Hotelrechnung sind in Englisch. Im Supermarkt und in anderen Geschäften findet man alle Produkte mit englischen Beschriftungen. Betritt man eine Buchhandlung, wird man fast nur englischsprachige Bücher finden. Englisch ist die geschriebene Amts- und Handelssprache. Gesetze, Steuererklärungen, Verträge und Geschäftskorrespondenz sind in Englisch. Man sieht also nur Englisch.
Anders wird das Bild, wenn man Filipinos zuhört. Zunächst versucht jeder Filipino, zu einem Ausländer Englisch zu sprechen. Im großstädtischen Bereich ist häufig sein Englisch ausgezeichnet. In weit abgelegen Provinzen können sich die Englischkenntnisse auf ein paar einfache Sätze beschränken. Insofern ist der häufig gehörte Satz richtig "In den Philippinen spricht jeder Englisch".
Wie sprechen die Filipinos untereinander? Zu Hause wird in beinahe allen Familien ein Kayumanggi gesprochen, zu erwähnen sind noch chinesischsprechende Familien chinesischer Abkunft (es gibt auch chinesischsprachige Zeitungen). Der Verfasser schätzt, dass in weniger als einem Prozent der philippinischen Familien (beide Elternteile gebürtige Filipinos) am Familientisch Englisch gesprochen wird. Das bedeutet, das auch heute noch für mehr als 95 Prozent der Filipinos Englisch nicht die Muttersprache ist. Es ist auch der Satz richtig "In den Philippinen spricht fast niemand Englisch".
Geht man in verschiedene Grundschulen, zeigt sich ein differenziertes Bild. Privatschulen (etwa die Hälfte der Kinder gehen auf private Schulen) haben nahezu ausschließlich englische Schulnamen, bei staatlichen Schulen ist etwa gleich häufig Paaralang elementarya und Elementary School zu lesen. Man wird fast nur englischsprachige Schulbücher finden und auch im Schulsekretariat wird Englisch geschrieben und gelesen. In den Klassenzimmern wird man häufig die Situation antreffen, dass der Lehrer eine Rechenaufgabe, die in Englisch im Buch steht, zunächst in Englisch erklärt und bei Unverständnis in der Schülerschaft – und das kommt häufig vor – das Ganze in einem Kayumanggi wiederholt. Das ist zwar "illegal", aber oft pädagogisch erfolgreich. In den Schulpausen ist es unterschiedlich. In den Dorfschulen hört man dann kein Wort Englisch mehr. In besseren Privatschulen wird das magtagalog 'sich in Tagalog unterhalten' im Schulhof bestraft.
Wenn man in ein Büro oder zu einer Behörde geht, sieht man auf den Schreibtischen wieder nur englischsprachige Papiere. Vom Umgang mit Ausländern abgesehen, kann man ein interessantes Sprechverhalten feststellen. Die englischsprachigen Papiere werden in Englisch gelesen. Je weiter man sich vom Papier entfernt, desto weniger Englisch und desto mehr Kayumanggi hört man. Nun folgen die englische und die Kayumanggi-Grammatik beim Satzbau völlig verschiedenen Gesetzen. Es gibt also einen Umkipppunkt im Gespräch. Erst werden Kayumanggi-Wörter in englisch konstruierte Sätze eingefügt, und dann plötzlich englische Wörter in Kayumanggi-Sätzen verwendet. Dabei werden die Kayumanggi-Flexionsregeln korrekt auf die englischen Wörter angewandt (Itetẹks kitạ.'Ich werde dir/Ihnen eine Kurznachricht senden.'). In den Philippinen ist Englisch also die geschriebene Handelssprache und nur sehr selten die gesprochene Handelssprache.
Nach diesen Beobachtungen aus dem täglichen Leben wird deutlich, dass Kayumanggi vorwiegend eine gesprochene und viel weniger eine geschriebene Sprache ist. Naturgemäß ist die gesprochene Sprache weniger formalisiert als die geschriebene Sprache. Verstärkt wird dieser Effekt, dass die meisten Sprecher keinen regelmäßigen Zugang zu geschriebener Sprache haben und daher eine Korrektur der gesprochenen Sprache durch Geschriebenes nicht stattfinden kann. Andererseits wird kein Abgleich zwischen offiziellen oder akademischen Dokumenten und dem täglichen Leben erzwungen, da diese sich nicht berühren und nicht aneinander "reiben" können.
Das meiste geschriebene Kayumanggi wird in einer englischsprachigen Umgebung verfasst. Es kann sein, dass es sich direkt um Übersetzungen aus dem Englischen handelt (so ist vermutlich der filipinische Verfassungstext eine Übersetzung aus dem englischen Original) oder dass zumindest der Schreiber durch die englische Sprache – bewusst oder unbewusst – beeinflusst ist. Wenn ich in Deutschland kein einziges deutsches Buch und nur englische Bücher in meinem Haus oder Büro habe, und ich fange an, einen deutschen Text zu verfassen, so wird der vermutlich etwas anglisiert sein. Ähnliches geschieht nun täglich in den Philippinen, das geschriebene Kayumanggi ist häufig anglisiert, und der Leser liest anglisiertes Kayumanggi und wird im Falle einer Antwort weiter anglisieren.
{1A-151 ![]() } Verwendung fremdsprachiger Fachausdrücke in
der philippinischen Linguistik
} Verwendung fremdsprachiger Fachausdrücke in
der philippinischen Linguistik
(1) In der philippinischen Linguistik besteht keine einheitliche Aufffassung, wie fremdsprachige Fachausdrücke {*} in die filipinischen Sprache eingepasst werden. Die Mehrzahl der ausländischen Fachausdrücke hat seinen Ursprung in der altgriechischen und lateinischen Sprache. Die europäischen Sprachen gehen bei der Eingliederung in der Regel vom griechischen oder lateinischen Original aus. In den Philippinen wird die spanische oder englische Ableitung zugrunde gelegt. Dies erzeugt eine Anzahl von Problemen, die unterschiedlich gelöst werden. Auf Schwierigkeiten stößt vor allem, dass in der englischen Sprache das orthografische Wortbild von griechischen oder lateinischen Lehnwörtern weitgehend dem der Ursprungssprache entspricht, während diese Wörter phonologisch stark verändert werden.
{*} In den Philippinen kann der Begriff fremdsprachige Fachausdrücke nahezu gleichgesetzt werden mit englische Fachausdrücke, da andere Sprachen nicht in Betracht gezogen werden.
(2) Eine Methode (Beispiel {![]() Aganan 1999}) behält
die englische Ableitung orthografisch unverändert bei und unterstellt, dass der Leser so
viel Englisch kann, dass er die englischen Wörter richtig ausspricht. Dabei werden die
englischen Wörter wortartspezifisch übernommen (neben
'verb' das Adjektiv 'verbal'
und nicht
Aganan 1999}) behält
die englische Ableitung orthografisch unverändert bei und unterstellt, dass der Leser so
viel Englisch kann, dass er die englischen Wörter richtig ausspricht. Dabei werden die
englischen Wörter wortartspezifisch übernommen (neben
'verb' das Adjektiv 'verbal'
und nicht pangverb). Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dass bei
internationaler Kommunikation die englischen Wörter deutlich erkennbar bleiben. Der
scheinbare Nachteil dieser Methode ist, dass diese englischen Wörter sichtbar Fremdwörter
in der filipinischen Sprache bleiben.
(3) Die Mehrzahl der philippinischen Autoren (Beispiel
{![]() Paz 2003}) wendet jedoch Methoden an, die englischen Ableitungen in
englischer Phonologie beizubehalten und an die filipinische Orthografie anzupassen, um
das filipinische Prinzip von Gleichheit von Aussprache und Schreibweise beizubehalten.
Dabei treten erhebliche Probleme auf. Zunächst besitzt die filipinische Orthografie
nur unzureichende Mittel, um dies zufriedenstellend zu ermöglichen (Beispiele sind
<agriment>, <vawel>, <titser>). Des weiteren ist
die englische Aussprache keineswegs so eindeutig, dass sich daraus ein eindeutiges
filipinisches Schriftbild ableiten ließe (Beispiel Englisch
'enclitic' wird zu Filipino <inklitik>,
<enklitik> oder <ingklitik>).
Häufig werden noch Anpassungen an die alte Tagalog-Phonologie vorgenommen (Beispiel:
Ersatz des Lautes [ f ] <f> oder
<ph> durch [ p ]
<p> in <diptong>).
In der Regel werden die Wörter als wortartfreie Wurzeln importiert, so dass auf sie die
filipinische Affigierung angewandt wird (Beispiel: pagkaklasifay). Durch diese
Methode entstehen also Wörter, die nicht mehr englisch sind, aber nur schwer in das
filipinische Laut- und Schriftbild passen. Ob mit dieser Methode eine gute
Verständlichkeit innerhalb der filipinischen Sprache hergestellt werden kann, ist
schwer festzustellen. Deutlich ist, dass die Verbindung zum englischen Schriftbild und zur
englischen Aussprache weitgehend verloren gehen kann (Beispiele: Englisches
'clause'
[klɔ:z] wird zu <klos> mit
vermutlicher filipinischer Aussprache [klɔs];
'vowel' ['vaʊəl] wird
zu <vawel> mit vermutlich
['fa:.vɛl];
richtiger (aber trotzdem nicht richtig) wäre wohl <vaw-el>
['faʊ.ʔɛl]).
Paz 2003}) wendet jedoch Methoden an, die englischen Ableitungen in
englischer Phonologie beizubehalten und an die filipinische Orthografie anzupassen, um
das filipinische Prinzip von Gleichheit von Aussprache und Schreibweise beizubehalten.
Dabei treten erhebliche Probleme auf. Zunächst besitzt die filipinische Orthografie
nur unzureichende Mittel, um dies zufriedenstellend zu ermöglichen (Beispiele sind
<agriment>, <vawel>, <titser>). Des weiteren ist
die englische Aussprache keineswegs so eindeutig, dass sich daraus ein eindeutiges
filipinisches Schriftbild ableiten ließe (Beispiel Englisch
'enclitic' wird zu Filipino <inklitik>,
<enklitik> oder <ingklitik>).
Häufig werden noch Anpassungen an die alte Tagalog-Phonologie vorgenommen (Beispiel:
Ersatz des Lautes [ f ] <f> oder
<ph> durch [ p ]
<p> in <diptong>).
In der Regel werden die Wörter als wortartfreie Wurzeln importiert, so dass auf sie die
filipinische Affigierung angewandt wird (Beispiel: pagkaklasifay). Durch diese
Methode entstehen also Wörter, die nicht mehr englisch sind, aber nur schwer in das
filipinische Laut- und Schriftbild passen. Ob mit dieser Methode eine gute
Verständlichkeit innerhalb der filipinischen Sprache hergestellt werden kann, ist
schwer festzustellen. Deutlich ist, dass die Verbindung zum englischen Schriftbild und zur
englischen Aussprache weitgehend verloren gehen kann (Beispiele: Englisches
'clause'
[klɔ:z] wird zu <klos> mit
vermutlicher filipinischer Aussprache [klɔs];
'vowel' ['vaʊəl] wird
zu <vawel> mit vermutlich
['fa:.vɛl];
richtiger (aber trotzdem nicht richtig) wäre wohl <vaw-el>
['faʊ.ʔɛl]).
Einige Autoren haben die Probleme offenbar erkannt und sie über den Umweg der spanischen Sprache zu lösen versucht. Dabei gehen sie davon aus, dass spanische Orthografie und Phonologie besser zur filipinischen Sprache passen als die des Englischen. So kann man neben fonoloji auch ponolohiya finden.
(4) Wir haben keine Ansätze des naheliegenden Weges gefunden, die altgriechischen oder lateinischen Wörter direkt an die filipinische Sprache anzupassen (Beispiel: Vom griechischen φωνή [fo'nɛ] könnten palafonehan, pangfone abgeleitet werden).
{1A-201} Bezeichnungen für Funktionsphrasen
(1) Neben Prädikat und Subjekt betrachten wir vier weitere Funktionsphrasen, die sich durch ihre Bestimmungswörter unterscheiden. Dieser Ansatz erfordert vier verschiedene (neue) Namen für diese Phrasen.
(2) Neue Bezeichnungen Objunkt und pantuwịd führen wir für die NG-Phrase ein. Mit der Verwendung des Stammes tuwịd wird eine Verbindung zu dem in der Literatur verwendeten Begriff layon na tuwiran 'direktes Objekt' geschaffen.
(3) Unsere Bezeichnungen für die SA-Phrase sind Adjunkt und pandako. Der Stamm dako ist ein Substantiv 'Richtung'. So soll sich in diesem Namen widerspiegeln, dass eine SA-Phrase eine räumliche oder zeitliche Richtung angibt oder dies im übertragenen Sinn tut (Empfänger).
(4) Durch die Ligatur wird eine Stufe, also eine Über- und Unterordnung angezeigt. Deshalb haben wir den Namen Subjunkt und panlapạg gewählt. Der Stamm lapạg bezeichnet 'eine oder mehrerere übereinanderliegenden Ebenen, Stockwerke'.
(5) NANG-Phrasen stehen selbständig im Satz, sie besitzen keine syntaktische Verbindung zu einer anderen Phrase und werden häufig ohne Bestimmungswort verwendet. Ihr Bestimmungswort nang dient vorwiegend der Abgrenzung von anderen Phrasen. Daher sind für uns die Bezeichnungen Disjunkt und pang-umpọg passend für diese Phrasen. Der Stamm umpọg beschreibt den 'den Zusammenstoß zweier harter Gegenstände'.
Diese Begriffe sind gleichermaßen für unabhängige Phrasen, Attribute von Nomina und für Argumente von Verben geeignet.
Zuordnung von Phrasen in der Literatur → {1A-611 ![]() }.
}.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_ugnay_1A.html
{1A-511 ![]() } Struktur des filipinischen
Satzes
} Struktur des filipinischen
Satzes
In der filipischen Sprache werden alle Sätze nach Muster [1] gebildet.
|
Wir zitieren
{![]() Himmelmann 1987 p. 76}:
Himmelmann 1987 p. 76}:
'Die Beziehung zwischen Prädikat und Prädikationsbasis ist eine simple Zuschreibung oder Gleichsetzung (X ist Y), wie sie im Nominal- oder Äquationalsatz der meisten Sprachen geläufig ist. … Im Tagalog sind Sätze durchgängig nach dem Muster des Äquationalsatzes aufgebaut, die Verbalsatzstruktur (mit von einem Verb abhängiger Argumentenstruktur) fehlt völlig.'
Damit wird ein tiefgreifender Unterschied zwischen europäischen Sprachen und Filipino (Tagalog) herausgestellt. Um es bildlich auszudrücken: Das aktive Tun des europäischen Verbs fehlt im Filipino, es ist durch das inaktive Gleichsetzen zweier Begriffe oder Bilder ersetzt. Es gibt keine einzigartige Funktion des Verbs, es ist eines von mehreren Inhaltswörtern.
{1A-521 Θ} Kasus und Deklination in der filipinischen Sprache
(1) In der linguistischen Literatur über Filipino werden häufig Begriffe wie Nominativ,
Genitiv, Dativ oder Lokativ verwendet. Bei der Verwendung dieser
Bezeichnungen kann angenommen werden, dass es in der filipinischen Sprache eine Art
Deklination oder Kasuskonzept gibt. Allgemein wird in der Linguistik der Begriff Kasus
'for inflectional languages that have declension' verwendet. In
der Tat besitzt Filipino ein solches Schema, das eine wichtige Eigenschaft eines
Kasuskonzeptes besitzt, nämlich 'die verschiedenen syntaktischen Rollen
des Substantivs im Satz zu kennzeichnen' {![]() Duden Gr}. Vereinfacht
kann dieses Schema wie folgt dargestellt werden:
Duden Gr}. Vereinfacht
kann dieses Schema wie folgt dargestellt werden:
| Kasus | Phrase | Entsprechung | |
| ANG-AY-Kasus | ANG-Phrase | Subjekt | Nominativ |
| AY-Phrase | Prädikat | Nominativ | |
| NG-Kasus | NG-Phrase | Objunkt | Genitiv, Akkusativ, Ergativ |
| SA-Kasus | SA-Phrase | Adjunkt | Dativ, Lokativ |
| -NG/NA-Kasus | -NG/NA-Phrase | Subjunkt | 'Appellation Appositional' { |
| ?-Kasus | ?-Phrase | Disjunkt | ?? |
(2) Der Begriff Deklination bezieht sich ausschließlich auf Nomina. Da eine solche Beschränkung in Filipino nicht besteht, wäre ein Ansatz, die Definition des "filipinischen Kasuskonzepts" abzuändern und auf alle Inhaltswörter bzw. -phrasen auszudehnen.
Eine weitere Problematik zeigt sich im Begriff Nominativ. Die filipinische Sprache macht deutliche Unterschiede zwischen Prädikat und Subjekt. Der Subjekt-Nominativ zeigt nicht nur die syntaktische Funktion sondern auch eine semantische Bestimmtheit an; letztere besitzt der Prädikat-Nominativ nicht. Es ist also zweifelhaft, ob man in der filipinischen Sprache von einem Nominativ sprechen kann.
Außer den Pronomen zeigen keine anderen filipinischen Nomina eine morphologische Form von Kasusdeklination, sofern man von den Bestimmungswörtern absieht. Wenn man ein Kasussystem in der filipinischen Sprache anwenden will, hat man sich an diesen Bestimmungswörtern zu orientieren.
Bei {![]() Lopez 1941 p. 37} wird eine 'appellation
Appositional' für mit der -ng/na Ligatur angeschlossene Phrasen eingeführt.
Noch schwieriger erscheint uns die Einordnung der Disjunktphrasen in ein Kasuskonzept.
Eine Gruppe davon sind Nominalphrasen, die eigentlich besonders gut in ein Kasuskonzept
passen sollten.
Lopez 1941 p. 37} wird eine 'appellation
Appositional' für mit der -ng/na Ligatur angeschlossene Phrasen eingeführt.
Noch schwieriger erscheint uns die Einordnung der Disjunktphrasen in ein Kasuskonzept.
Eine Gruppe davon sind Nominalphrasen, die eigentlich besonders gut in ein Kasuskonzept
passen sollten.
Wir verzichten auf Kasusbegriffe und Deklination. Dadurch entfällt für uns auch die Frage, ob Filipino eine 'inflectional language that has declension' ist.
(3) In diesem Zusammenhang zitieren wir
{![]() Bloomfield 1917 § 119}:
Bloomfield 1917 § 119}:
'Constructions 2 and 3 (Gebilde mit
ng und sa) make it possible to speak, in a very wide
sense, of three "cases" in which an object expression may stand: "subjective", "disjunctive"
and "local"; but it is to be observed that these "cases" are not confined to any class
of words when it stands in the object construction (Gebilde
mit ang)*.'
' * Although grammatical
terms are necessarily and properly employed in different meanings when referring to
different languages, the Tagalog constructions in question are so different
from what is ordinarily understood by "cases" that the above terminology has been avoided
in the following sections.'
{1A-611 ![]() } Zuordnung von Phrasen (neben Subjekt und
Prädikat)
} Zuordnung von Phrasen (neben Subjekt und
Prädikat)
(1) {![]() Bloomfield 1917 § 119} unterscheidet vier Arten von
'Attributes':
Bloomfield 1917 § 119} unterscheidet vier Arten von
'Attributes':
Wir gehen von dem Bloomfield'schen Ansatz aus, den wir jedoch leicht modifizieren.
In § 120 unterscheidet Bloomfield zwischen 'loosely joined attributes', die etwa unseren unabhängigen Phrasen entsprechen, 'closely joined attributes', die etwa unsere Attribute sind, und 'enclitic attributes'.
Bei Bloomfield werden die 'expressions of indefinite quantity' (Existenzphrasen) getrennt von den 'attributes' behandelt (§§ 69 - 71).
(2) {![]() Lopez 1941 p. 269 ff.}
spricht von 'Enlargement
by Apposition' (Subjunkt), 'by Attribution' (Objunkt),
'by the Locative' (Adjunkt) und 'Other Forms
of Enlargement' (Präpositionen
usw.).
Lopez 1941 p. 269 ff.}
spricht von 'Enlargement
by Apposition' (Subjunkt), 'by Attribution' (Objunkt),
'by the Locative' (Adjunkt) und 'Other Forms
of Enlargement' (Präpositionen
usw.).
(3) Bei {![]() Aganan 1999 p. 81 f.} werden NG- und SA-Phrase zu einem
Begriff Objekto zusammengefasst, der dann in die semantischen Begriffe
tagaganap, layon, tagatanggap, ganapan, atbp.
eingeteilt wird. Diese Einteilung
findet sich im Abschnitt Pagpapalawak ng Panaguri
('Erweiterungen des Prädikats').
Aganan 1999 p. 81 f.} werden NG- und SA-Phrase zu einem
Begriff Objekto zusammengefasst, der dann in die semantischen Begriffe
tagaganap, layon, tagatanggap, ganapan, atbp.
eingeteilt wird. Diese Einteilung
findet sich im Abschnitt Pagpapalawak ng Panaguri
('Erweiterungen des Prädikats').
{1A-621} Eigenschaften der Attribute
| |||||||||||||||
{1A-631 Σ} Satzanalyse: Duale Identität der Phrasen
| Laging si Tan Sua ang nilalapitan ng babaeng nakaitịm tuwing bumibilị sa tindahan. {W Nanyang 11.2} Immer hat sich die Frau in Schwarz an Tan Sua gewandt, wenn sie etwas gekauft hat. | |
| [1] laging si Tan Sua ang nilalapitan ng babaeng nakaitim | [2] tuwing bumibili sa tindahan |
| {S-0/L/PT} | {S-K/P0} |
Zusammengesetzter Satz. Der Teilsatz [2] ist verkürzt, das Subjekt babaeng nakaitim wird nicht wiederholt {13-4.4.2}. | |
| [1] Laging si Tan Sua ang nilalapitan ng babaeng nakaitim. | ||||||||
| laging si Tan Sua | ang nilalapitan ng babaeng nakaitim | |||||||
| {P-P=P-N} | {P-T=P-D} | |||||||
| laging si Tan Sua | ang | nilalapitan ng babaeng nakaitim | ||||||
| {P-N(P-L Y/Ta N/Ta)} | {P-D(DB P-W)} | |||||||
| laging | si Tan Sua | nilalapitan | ng babaeng nakaitim | |||||
| {P-L=P-A} | {P-W=P-N} | |||||||
| babaeng nakaitim | ||||||||
| {P-N(N P-L)} | ||||||||
| -ng nakaitim | ||||||||
| {P-L=P-U} | ||||||||
| laging | si | Tan Sua | ang | nilalapitan | ng | babaeng | nakaitim | |
| A.L | Y/Ta | N/Ta | TT | DB10/K | TW | N.L | U | |
Regelsatz mit Prädikat und Subjekt in kanonischer Reihenfolge. | ||||||||
Der Inhalt der Prädikatsphrase ist eine Nominalphrase. Das Prädikat hat kein Bestimmungswort, da es am Satzanfang steht. Teil der Nominalphrase ist das Attribut laging. Dies ist eine Subjunktphrase mit dem Adverb lagi als Inhalt. | ||||||||
Die Inhaltsphrase des Subjekts ist eine Verbphrase. Vor dem Subjekt steht das Bestimmungswort ang. | ||||||||
Das Verb besitzt das Argument ng babaeng nakaitim; dieses Objunkt ist Teil der Verbphrase. | ||||||||
Der Inhalt des Objunkts ist die Nominalphrase babaeng nakaitim. | ||||||||
Das Attribut | ||||||||
| zu babae ist ein Subjunkt. Seine Inhaltsphrase ist das Adjektiv nakaitim. | ||||||||
{1A-632} Kombinationen von Funktions- und Inhaltsphrasen
Die Zahlen in nachfolgender Tabelle beziehen sich auf eine Analyse von 213 Phrasen aus unserem Werkstatt-Korpus (je fünfzig Phrasen aus {W Aesop}, {W Daluyong}, {W Karla} und {W Salazar 1996})
| Nomen | Vollverb | Partizip | Adjektiv | Adverb | Präp. | Gesamt | |
| Prädikat | 10 | 29 | . | 7 | . | 5 | 51 |
| Subjekt | 31 + 5* | 3 | 1 | . | . | . | 40 |
| Objunkt | 33 | – | . | – | – | . | 33 |
| Adjunkt | 23 | – | 1 | – | . | . | 24 |
| Subjunkt | 6 + 7** | – | 4 | 22 | 17 | 2 | 58 |
| Disjunkt | 1 | – | – | – | 5 | 1 | 7 |
| Gesamt | 116 | 32 | 6 | 29 | 22 | 8 | 213 |
* = Subjektinterklit. ** = SA-Personalpronomen.
. = Selten (nicht in Stichprobe). – = Wird nicht gebildet.
{1A-633 Θ} Paradigma ang - ng - sa der Nominalphrasen
(1) Unsere Auffassung der dualen Identität der Phrasen wird in der Regel in der linguistischen Literatur nicht geteilt. Vielmehr herrschen dort Darstellungen vor, die die Nominalphrase in den Vordergrund stellen. Trotz Unterschieden zwischen verschiedenen Autoren kann vereinfachend gesagt werden, dass Nominalphrasen (bzw. 'determiner phrases') eine Art Paradigma bilden, das durch die Elemente ang - ng - sa gefüllt wird. Einige Autoren verbinden dies mit der Verwendung des Begriffes Kasus, eine Gruppe verwendet explizit den Begriff Kasus, eine andere Gruppe nur implizit, wenn sie die ang Phrase als Nominativ usw. bezeichnet. Häufig werden Begriffe wie Subjekt und Objekt mit diesen Phrasen verbunden, wobei stillschweigend vorausgesetzt werden muss, das Subjekte und Objekte Nominalphrasen sind. Vereinfacht können die verschiedenen Ansätze wie folgt zusammengefasst werden.
| Nominalphrase |
| ang |
| ng |
| sa |
Auf den ersten Blick ist diese Betrachtungsweise eine gute Beschreibung für die filipinische Sprache, zumal die Mehrheit der Phrasen mit ang, ng und sa ein Nomen als Kernwort besitzen {1A-632}. Hinzu kommt, dass Pronomen ein entsprechendes Paradigma besitzen {8A-401 Θ}.
(2) Wir teilen diese Auffassung nicht, da ein solches Paradigma für Nominalphrasen in zwei Richtungen "offen" ist. Einerseits sind einige Gruppen von ang Phrasen keine Nominalphrasen (Abschnitt (3)). Andererseits gibt es größere Gruppen von Phrasen, deren Kernwort ein Nomen ist, die jedoch in obiges Schema nicht passen (Abschnitte (4-6)).
(3) Phrasen mit ang, deren Kernwort kein Nomen ist.
Es handelt sich dabei offenbar nicht um ein paar Ausnahmen, sondern um ganze Gruppen
von Phrasen. Man hat einen bemerkenswerten Ausweg zu dem Problem gefunden. Weil nicht sein
kann, was nicht sein darf, wird postuliert, dass das Kernwort einer ang Phrase
stets zu einem Nomen werde {2A-102 ![]() (2-6)}.
(2-6)}.
(4) Nominalphrasen als Prädikat.
Filipino ist eine Sprache, die kein Verb im Satz erfordert. Daher können Nomina bzw.
Nominalphrasen das Prädikat bilden. Dies ist also die erste Gruppe von Nominalphrasen,
die in obigem Paradigma "keinen Platz findet". Das Wort ay, das einigen Prädikaten
vorangestellt wird, kann nicht in obiges Schema aufgenommen werden, da die Mehrheit
der ay Phrasen keine Nominalphrasen sind. Die überwiegende Zahl der Prädikate steht
am Satzanfang und erhält kein Bestimmungswort, entsprechende Nominalphrasen besitzen also
weder ang, ng noch sa.
(5) Nominalphrasen mit Ligatur.
Einige Gruppen von Nominalphrasen werden mit Hilfe einer Ligatur mit der übergeordneten
Phrase verbunden, wobei Ligatur und ang - ng - sa einander
ausschließen. Diese Ligaturphrasen (die wir Subjunkte nennen) können Attribute sein, aber
auch Argumente von Verben. Auch hier ist die Aufnahme
der Ligatur in das Paradigma keine Lösung des Problems, da die Mehrheit der
Ligaturphrasen keine Nominalphrasen sind.
In dem Schema von {![]() Lopez 1941 §80}
der 'Articles of the Proper Noun and the Common Noun' gibt es
eine weitere Gruppe 'Appellation Appositional' für Phrasen
mit der -ng/na Ligatur {1A-521 Θ}.
Lopez 1941 §80}
der 'Articles of the Proper Noun and the Common Noun' gibt es
eine weitere Gruppe 'Appellation Appositional' für Phrasen
mit der -ng/na Ligatur {1A-521 Θ}.
(6) Nominalphrasen ohne Bestimmungswort.
Weitere Gruppen von Nominalphrasen passen nicht in obiges Paradigma, weil sie weder
ang, ng noch sa besitzen. Dazu gehören Präpositionalphrasen
und disjunktive Nominalphrasen.
{1A-701 ![]() } Wortarten in der linguistischen
Literatur
} Wortarten in der linguistischen
Literatur
(1) {![]() Bloomfield 1917} führt für Tagalog zwei Wortarten
'full words' und 'particles' ein.
'Full words' sind in § 55 definiert: 'In contrast
with the particles, full words act not only as attributes, but also as
subject or predicate, and any full word may, in principle, be used in any of these three
functions.'; 'particles' sind also eine Restgruppe. In § 54
werden die 'particles' unterteilt in
'to stand in the relations' und 'to express the
relations'.
Die Definition der Wortarten bei Bloomfield ist syntaktisch (der § 55 ist der vierte
Paragraph im Teil 'B. Syntax').
Bloomfield 1917} führt für Tagalog zwei Wortarten
'full words' und 'particles' ein.
'Full words' sind in § 55 definiert: 'In contrast
with the particles, full words act not only as attributes, but also as
subject or predicate, and any full word may, in principle, be used in any of these three
functions.'; 'particles' sind also eine Restgruppe. In § 54
werden die 'particles' unterteilt in
'to stand in the relations' und 'to express the
relations'.
Die Definition der Wortarten bei Bloomfield ist syntaktisch (der § 55 ist der vierte
Paragraph im Teil 'B. Syntax').
Wir haben die Definition der Inhaltswörter bei Bloomfield etwas erweitert. Wir verstehen darunter alle Wörter, die Phrasen bilden können (damit ist z.B. araw-araw ein Inhaltswort, § 258). Die verbleibende Restklasse teilen wir – ähnlich wie Bloomfield – in Funktions- und Kurzwörter.
In § 56: 'Independent of this classification into parts of speech are certain less important groupings of words and certain phrase types, some of which will appear in the course of the analysis.' Die 'less important groupings' entsprechen etwa den konventionellen Wortarten. Sie werden in der Arbeit von Bloomfield weitaus häufiger verwendet als seine mehr theoretischen Wortarten. Ein Punkt verdient Aufmerksamkeit, der Teilsatz 'independent of this classification into parts of speech'; Inhalts- und Funktionswörter sind also keine "Überklassen" der konventionellen Wortarten.
(2) Eine andere Gruppe betrachtet die Problematik der
filipinischen Wortarten als weniger erheblich und übernimmt die klassischen Wortarten.
Wegen der dabei auftretenden Probleme werden Anpassungen vorgenommen. Die verschiedenen
Wortarten werden in jeweils eine der Gruppen 'Full words / Particles'
eingeteilt. Bei {![]() Lopez 1941 p. 36} gehören die Pronomen zu den Partikeln,
während sie bei {
Lopez 1941 p. 36} gehören die Pronomen zu den Partikeln,
während sie bei {![]() Aganan 1999 p. 21} und
{
Aganan 1999 p. 21} und
{![]() Santiago 2003-B p. 121} Inhaltswörter sind.
Santiago 2003-B p. 121} Inhaltswörter sind.
(3) Bei {![]() Aganan 1999 p. 21} sind Inhaltswörter (pangnilalamạn)
ein Überbegiff für Nomina, Verben, Adjektive und Adverbien.
Aganan 1999 p. 21} sind Inhaltswörter (pangnilalamạn)
ein Überbegiff für Nomina, Verben, Adjektive und Adverbien.
{1A-711} Beispiele zu den syntaktischen Wortarten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{1A-731} Stammwörter
Wir beachten die nachfolgenden Regeln für Stammwörter (ohne grammatische Begründung):
{1A-8011 ![]() } Bemerkungen zur Struktur der
filipinischen Syntax bei L. Bloomfield
} Bemerkungen zur Struktur der
filipinischen Syntax bei L. Bloomfield
(1) Wir fassen aus dem Werk von L. Bloomfield {![]() Bloomfield 1917}
zusammen:
Bloomfield 1917}
zusammen:
(2) Wir kommentieren die Bloomfield'schen Ansätze an folgenden Stellen:
{1A-8012 ![]() } Bemerkungen zur Struktur der filipinischen
Syntax bei N. Himmelmann
} Bemerkungen zur Struktur der filipinischen
Syntax bei N. Himmelmann
Wir zitieren aus dem Werk von N. Himmelmann {![]() Himmelmann 1987
p. 78}:
Himmelmann 1987
p. 78}:
'Es gibt also fünf grundlegende morphosyntaktische Positionen im Tagalog: Prädikat (Markierung: Satzanfangstellung bzw. ay), attributives Gefüge (na), attributives Gefüge mit referentiellem Attribut (ng), Umstandsbestimmungen (im weitesten Sinne) (sa) und Prädikationsbasis. Letztere ist notwendig referentiell und wird deshalb immer durch eine ang-Phrase realisiert, ang aber markiert nicht Prädikationsbasen per se, sondern Referentialität. Die Beziehung zwischen Prädikat (P) und Prädikationsbasis (PB) ist eine simple Zuschreibung oder Gleichsetzung (X ist Y), wie sie im Nominal- oder Äquationalsatz der meisten Sprachen geläufig ist. Sie wird nicht segmental realisiert, sondern zum einen durch die Stellung (P vor PB), zum andern durch das Fehlen eines besonderen Markers gekennzeichnet; alle anderen morphosyntaktischen Relationen sind dagegen explizit (segmental) markiert. Zur Prädikatsphrase gehören alle mit dem prädikativen Kern verbundenen Elemente; d.h. alles, was mit durch ng, na oder sa dem Kern attribuiert wird.'
Wir sehen folgende prinzipiellen Übereinstimmungen mit unserer Darstellung:
{1A-8013 ![]() } Bemerkungen zur Struktur der filipinischen
Syntax bei P. Schachter und F. T. Otanes
} Bemerkungen zur Struktur der filipinischen
Syntax bei P. Schachter und F. T. Otanes
Die 'Tagalog Reference Grammar' von P. Schachter und F. T.
Otanes {![]() Schachter 1972}
betrachtet weitgehend Bauprinzipien entsprechend der semantischen Funktionen
(oft im Vergleich zur englischen Sprache). Deshalb treten zwangsläufig
syntaktische Strukturen etwas in den Hintergrund. Bezüglich dieser sind besonders zu
erwähnen:
Schachter 1972}
betrachtet weitgehend Bauprinzipien entsprechend der semantischen Funktionen
(oft im Vergleich zur englischen Sprache). Deshalb treten zwangsläufig
syntaktische Strukturen etwas in den Hintergrund. Bezüglich dieser sind besonders zu
erwähnen:
{1A-8014 ![]() } Bemerkungen zur Struktur der filipinischen
Syntax bei C. Lopez
} Bemerkungen zur Struktur der filipinischen
Syntax bei C. Lopez
Wir fassen aus dem Werk von C. Lopez {![]() Lopez 1941} zusammen:
Lopez 1941} zusammen:
{1A-8015 ![]() } Bemerkungen zur Struktur der
filipinischen Syntax bei Sangguniang Gramatika der UP
} Bemerkungen zur Struktur der
filipinischen Syntax bei Sangguniang Gramatika der UP
Wir fassen aus dem Grammatikbuch der UP {![]() Aganan 1999}
zusammen:
Aganan 1999}
zusammen:
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_ugnay_2A.html
{2A-101} Verwendung des Begriffs paniyak für das Subjekt
In der traditionellen filipinischen Grammatik wurde das Wort simuno für das Subjekt verwendet. Dieser Begriff ist nicht sehr zutreffend, wenn man ihn im Sinne von pasimuno ng kilos 'Auslöser der Tätigkeit' betrachtet; er ist auf das Subjekt im Aktivsatz beschränkt.
In der neueren Grammatik wurde das Wort simuno durch paksạ ersetzt. Die allgemeine Bedeutung des Wortes paksạ ist 'Gesprächsgegenstand'. Damit wurde das gleiche Problem wie in der englischen Sprache mit dem Wort 'subject' geschaffen, das u.a. zwei Bedeutungen besitzt ('subject of a clause' als syntaktischer Begriff und pinag-uusapan 'subject of a story' als semantischer Begriff).
Bei {![]() Schachter 1972 p. 60} wird der Begriff
'subject' durch 'topic' ersetzt:
'One of the chief distinctions between the Tagalog topic and the
English subject is that the topic never expresses a meaning of indefiniteness while
a subject may or may not.' (vgl. auch {
Schachter 1972 p. 60} wird der Begriff
'subject' durch 'topic' ersetzt:
'One of the chief distinctions between the Tagalog topic and the
English subject is that the topic never expresses a meaning of indefiniteness while
a subject may or may not.' (vgl. auch {![]() Katagiri 2006}).
Katagiri 2006}).
Zur Vermeidung der oben angeführten Schwierigkeiten bilden wir das Wort paniyạk für das grammatische Subjekt wegen dessen Bestimmtheit (katiyakạn).
{2A-102 ![]() } Subjekt und Nominalphrase, Funktion
von ang
} Subjekt und Nominalphrase, Funktion
von ang
Vorbemerkung
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Subjekt und Nominalphrase. Sie gelten nicht für substantivisch verwendete Partizipien und Adjektive.
(1) Wir zitieren {![]() Bloomfield 1917} § 55: 'Full words
act not only as attributes, but also as subject and predicate, and any full word may,
in principle, be used in any of these three functions.' Wir übertragen diese Aussage
in unsere Terminologie: "Nahezu jede Inhaltsphrase kann Prädikat oder Subjekt im
filipinischen Satz bilden."
Bloomfield 1917} § 55: 'Full words
act not only as attributes, but also as subject and predicate, and any full word may,
in principle, be used in any of these three functions.' Wir übertragen diese Aussage
in unsere Terminologie: "Nahezu jede Inhaltsphrase kann Prädikat oder Subjekt im
filipinischen Satz bilden."
(2) Andererseits wird das Subjekt der filipinischen Sprache
häufig mit einem Nomen identifiziert. Bereits bei
{![]() Bloomfield 1917} finden wir in § 88: 'The
subject of a sentence is always an object expression' ('object expression'
entspricht etwa der Nominalphrase). Ist
das Subjekt kein Nomen an sich, so wird es "nominalisiert"
('objectivized'). Zitat aus § 104 (wo ein Tausch von Prädikat
und Subjekt beschrieben wird): 'The transient part of the
sentence (etwa das Verb) being put into object
construction and used as subject'.
Bloomfield 1917} finden wir in § 88: 'The
subject of a sentence is always an object expression' ('object expression'
entspricht etwa der Nominalphrase). Ist
das Subjekt kein Nomen an sich, so wird es "nominalisiert"
('objectivized'). Zitat aus § 104 (wo ein Tausch von Prädikat
und Subjekt beschrieben wird): 'The transient part of the
sentence (etwa das Verb) being put into object
construction and used as subject'.
Es ist dann naheliegend, das Wort ang dem Nomen (und nicht dem Subjekt) zuzurechnen; in § 61: 'When a word or phrase denotes an element of experience viewed as an object, it is, with certain exceptions, preceded by the atonic particle ang'. Zu diesen Ausnahmen zählen:
(3) Der Gedanke der "Nominalisierung" findet sich ebenfalls bei
anderen Autoren. Wir zitieren {![]() Schachter 1972 p. 150}:
Schachter 1972 p. 150}:
'In a derived sentence, then, an adjectival or verbal may occupy virtually any sentence position that, in a basic sentence, is occupied exclusively by an unmarked noun: An adjectival or verbal used as something other than an unmarked predicate or a modifier is said to be nominalized, or a nominalization. Tagalog adjectivals and verbals undergo no change of form when they are nominalized.'
Ähnliches finden wir bei
{![]() Aganan 1999}.
Aganan 1999}.
| 'Ayon naman sa makabagong gramatika na batay sa estruktural pagkakabuo, tumutukoy ang pangngalan sa anumang salitang isinusunod sa mga panandang ang/ang mga, ng/ng mga, sa/sa mga, si/sina, ni/nina, kay/kina.' (p. 22) | Entsprechend der modernen Grammatik, die dem strukturellen Bauprinzip gemäß ist, werden alle Wörter, die auf die Bestimmungswörter ang/ang mga, ng/ng mga, sa/sa mga, si/sina, ni/nina, kay/kina folgen, als Substantive betrachtet. |
| 'Laging pariralang nominal ang paksa ng pangungusap sa Filipino. Nanganagahulugan ito na laging may nauunang pananda o marker (ang, si/sina) ang paksa, kung hindi ito panghalip.' | In Filipino ist das Subjekt des Satzes stets eine Nominalphrase. Das heißt, dass das Subjekt stets ein vorangehendes Bestimmungswort oder einen Markierer besitzt, wenn es kein Pronomen ist. |
| 'Ginagamit ang ang sa anumang bahagi ng panalita na ginawang nominal, maging ito ay pangngalan, pang-uri, pang-abay, o maging pararilang modal, eksistensiyal, o preposiyonal.' (p. 75) | ang wird mit jeder Wortart oder Phrase verwendet, die nominal geworden ist; das werden Substantive, Adjektive, Adverbien oder modale, existentielle und präpositionale Phrasen. |
Beide Autoren distanzieren sich offenbar etwas von diesen Aussagen; bei Schachter steht
einschränkend 'is said to be' und bei Aganan
'ayon naman sa makabagong gramatika na batay sa estruktural
pagkakabuo', beides ohne Quellenangaben. Bei {![]() Schachter 1972}
wird ausführlich die Bestimmtheit des Subjekts betrachtet; jedoch wird die Frage
nach der Bestimmtheit von nominalisierten Subjekten nicht gestellt.
Schachter 1972}
wird ausführlich die Bestimmtheit des Subjekts betrachtet; jedoch wird die Frage
nach der Bestimmtheit von nominalisierten Subjekten nicht gestellt.
(4) In konventionellen Grammatikbüchern sind Erklärungen zu
ang häufig undeutlich. So finden wir in {![]() Villanueva 1868/1998 vol. 4 p. 56 f.}:
Villanueva 1868/1998 vol. 4 p. 56 f.}:
| 'Ang mga pangngalan ay sinasamahan ng isa o dalawang salitang tinatawag na pantukoy.' | Substantive werden von einem oder zwei Wörtern begleitet, die Artikel genannt werden. |
| 'Ang mga pantukoy na ang, ang mga, si at sina ay mga pananda sa simuno ng pangungusap.' | Die Artikel ang, ang mga, si und sina sind Markierer für das Subjekt des Satzes. |
{![]() Santiago 2003-B p. 228} fasst beides in einem Satz zusammen.
Santiago 2003-B p. 228} fasst beides in einem Satz zusammen.
| 'Ang mga pananda ng pambalarilang gamit ng isang salita [sa loob ng pangungusap] ay ang mga pantukoy na si, sina, ang at ang mga, …' | Die Markierer für die grammatische Funktion eines Wortes [innnerhalb eines Satzes] sind die Artikel si, sina, ang und ang mga. |
(5) Das in {1A-633
![]() } dargestellte
ang - ng - sa Paradigma der Nominalphrasen setzt voraus, dass
ang der Nominalphrase zuzurechnen ist. Die "Nominalisierung"
passt nicht zu diesem Schema.
} dargestellte
ang - ng - sa Paradigma der Nominalphrasen setzt voraus, dass
ang der Nominalphrase zuzurechnen ist. Die "Nominalisierung"
passt nicht zu diesem Schema.
(6) Wir haben weder bei Bloomfield noch bei anderen Autoren eine Begründung dafür gefunden, warum alle ang Phrasen Nominalphrasen sein sollen, zumal 'Tagalog adjectivals and verbals undergo no change of form when they are nominalized.' (Zitat in Absatz (3)). Auch unsere eigenen Studien haben keine Hinweise in diese Richtung erbracht. Im Allgemeinen wird die Wortart nicht verändert, wenn das Wort in einer anderen syntaktischen Funktion verwendet wird.
{2A-211 ![]() } ay als Bestimmungswort
} ay als Bestimmungswort
(1) Die Einordnung von ay als Bestimmungswort wird - vor allem in älteren Quellen - nicht uneingeschränkt geteilt.
(2) Bei {![]() Bloomfield 1917 § 53}
steht: 'The particle 'y expresses the predicative
relation' (Im entsprechenden Beispielsatz steht 'y
statt ay.) und bei {
Bloomfield 1917 § 53}
steht: 'The particle 'y expresses the predicative
relation' (Im entsprechenden Beispielsatz steht 'y
statt ay.) und bei {![]() Himmelmann
2005 p. 9} 'The predicate marker ay
signals the beginning of the predicate'.
Himmelmann
2005 p. 9} 'The predicate marker ay
signals the beginning of the predicate'.
(3) In anderen Quellen wird ay dem Satz als Ganzes
zugeordnet. Lopez spricht von einer
'linguistic copula'
{![]() Lopez 1941 p. 264} oder einem 'particle
(equalizing sentence)' {
Lopez 1941 p. 264} oder einem 'particle
(equalizing sentence)' {![]() Lopez 1940 p. 117}.
Lopez 1940 p. 117}.
(4) Im Wörterbuch von L.J. English
{![]() LJE ay} wird phänomenologisch beschrieben, wenn nach
einer unabhängigen Phrase oder einem Teilsatz ay vor dem Prädikat steht:
LJE ay} wird phänomenologisch beschrieben, wenn nach
einer unabhängigen Phrase oder einem Teilsatz ay vor dem Prädikat steht:
'ay2 ligature used instead of a comma, as Bukas ay magpasyál tayo, which could also be: Bukas, magpasyál tayo: Tomorrow let's take a walk (go for a short trip).'
(5) Bei {![]() Villanueva 1968/1998
vol. 4 p. 71} wird ay als ein Verbindungs- oder Hilfsverb
(pandiwang pang-angkọp bzw. pandiwang pantulong)
betrachtet. Bei {
Villanueva 1968/1998
vol. 4 p. 71} wird ay als ein Verbindungs- oder Hilfsverb
(pandiwang pang-angkọp bzw. pandiwang pantulong)
betrachtet. Bei {![]() Santiago 2003-B p. 231} wird eine Untergruppe der
panandạ (Bestimmungswörter) eingeführt mit der Bezeichnung pangawing
(Verbindungswörter), zu der als einziges Wort ay gehört und das als bilang pananda
ng ayos ng pangungusap als Markierer der Reihenfolge im Satz dient.
Santiago 2003-B p. 231} wird eine Untergruppe der
panandạ (Bestimmungswörter) eingeführt mit der Bezeichnung pangawing
(Verbindungswörter), zu der als einziges Wort ay gehört und das als bilang pananda
ng ayos ng pangungusap als Markierer der Reihenfolge im Satz dient.
{2A-231 ![]() } Tausch von Prädikat und
Subjekt
} Tausch von Prädikat und
Subjekt
(1) Die Darstellung von {![]() Bloomfield 1917} in § 55 kann als Voraussetzung für die Möglichkeit
des Tausches von Prädikat und Subjekt gesehen werden: 'Full words
act not only as attributes, but also as subject and predicate, and any full word may,
in principle, be used in any of these three functions.'
Bloomfield 1917} in § 55 kann als Voraussetzung für die Möglichkeit
des Tausches von Prädikat und Subjekt gesehen werden: 'Full words
act not only as attributes, but also as subject and predicate, and any full word may,
in principle, be used in any of these three functions.'
(2) Ein weiterer Hinweis in unsere Richtung findet sich bei
{![]() Lopez 1941 p. 267 f.,
§ 156}:
Lopez 1941 p. 267 f.,
§ 156}:
'[6a] Akọ'y guro. Guro akọ. I am (a) teacher. (Teacher I.) I am a teacher. [6b] Ang guro'y akọ. Akọ ang guro. (The teacher is I.) I am the teacher. (I the teacher.) I am the teacher. [7a] Itọ'y paaralạn. Paaralạn itọ. This is (a) schoolhouse. (Schoolhouse this.) This is a schoolhouse. [7b] Ang paaralạn ay itọ. Itọ ang paaralạn. (The schoolhouse is this.) This is the schoolhouse. (This the schoolhouse.) This is the schoolhouse. Various types of words may be used either as subject or as predicate. In [6a], a personal pronoun is subject to a predicative common noun which in [6b] has changed places as well as in use; a demonstrative pronoun can also be a subject [7a] or a predicate [7b].'
{2A-232 ![]() } Tausch von Prädikat und Subjekt und
europäische Sprachen
} Tausch von Prädikat und Subjekt und
europäische Sprachen
(1) Der Tausch von Prädikat und Subjekt in der filipinischen Sprache ist eine Besonderheit, der eine Entsprechung in indoeuropäischen Sprachen fehlt. Dies kann zu Schwierigkeiten beim Verständnis und bei Übersetzungen führen. Deshalb soll der Sachverhalt näher an einem einfachen Beispiel betrachtet werden.
In der filipinischen Sprache können die Begriffe pagọng und matalino in vier verschiedenen Aussagesätzen verbunden werden [1-4]. In europäischen Sprachen sind nur zwei Kombinationen möglich: 'Die Schildkröte ist klug.' und 'Klug ist die Schildkröte'. In den deutschen Sätzen ist das Substantiv 'Schildkröte' stets das Subjekt, und das Adjektiv 'klug' ist stets ein Teil des Prädikats.
Das Verständnis der filipinischen Sätze erfordert eine andere Betrachtung. Sowohl pagọng und matalino können das Prädikat oder auch das Subjekt sein. Da ebenfalls die Reihenfolge geändert werden kann, ergeben sich vier Möglichkeiten entsprechend den vier Satzformen in {13-2.3 Θ [1*-4*]}:
| ||||||||||||||||||||||||||
In den ersten beiden Sätzen wechseln Prädikat und Subjekt ihre Funktionen. Satz [3] ist eine nichtkanonische Umstellung von Satz [1], und Satz [4] von [2]. In einer indoeuropäischen Sprache sind nur Sätze ähnlich zu Satz [1] und [3] möglich, eine Entsprechung zu Satz [2] und [4] besteht nicht.
(2) Bei Übersetzungen in europäische Sprachen wird häufig versucht, Entsprechungen zu den Sätzen [2] und [4] zu schaffen. Häufig werden Gebilde gewählt wie 'Die Schildkröte ist diejenige, die klug ist.' (vielleicht in Anlehnung an französische Fragen wie 'Est-ce que vous allez chez Legros?'). Damit wird jedoch das Problem nicht gelöst. Im deutschen Haupt- und Nebensatz bleibt die 'Schildkröte' das Subjekt und 'klug' das Prädikat im Nebensatz. Der Zusatz von 'diejenige' hat keinen Tausch von Prädikat und Subjekt bewirkt. Eine richtigere (aber keineswegs richtige) Übersetzung trägt der Tatsache Rechnung, dass in indoeuropäischen Sprachen Subjekte Nominalphrasen sind, sie lautet 'Das klug Seiende ist Schildkröte.'
(3) Bei Übersetzungen in die englische Sprache werden filipinische Verben gern mit englischen Partizipien übersetzt [5c 6b 6c] ('progressive', Verlaufsform). Dabei können zusammengesetzte Sätze entstehen [6b]. Übersetzungen wie [5c 6b] betrachten wir als nicht angemessen; vermutlich sind [5d 6c] zutreffender. In den Sätzen [7 8] bewirkt die Voranstellung des Prädikats keine besondere Betonung; Übersetzungen mit betonendem Teilsatz können als sinnentstellend angesehen werden [7c 8c].
|
(4) {![]() Lopez 1941 p. 38 ff.}
bevorzugt in seinen Beispielsätzen regelmäßig die nichtkanonische Reihenfolge (was wir als
westlichen Stil bezeichnen); die Satzmuster [3 4] überwiegen [9a 10a].
Lopez 1941 p. 38 ff.}
bevorzugt in seinen Beispielsätzen regelmäßig die nichtkanonische Reihenfolge (was wir als
westlichen Stil bezeichnen); die Satzmuster [3 4] überwiegen [9a 10a].
|
{2A-301 ![]() } Bestimmtheit in Filipino und in
europäischen Sprachen
} Bestimmtheit in Filipino und in
europäischen Sprachen
(1) Zwischen dem Subjekt in der filipinischen Sprache und in indoeuropäischen Sprachen besteht ein grundsätzlicher Unterschied; das filipinische Subjekt hat Bestimmtheit an sich, während in indoeuropäischen Sprachen Bestimmtheit durch besondere Maßnahmen erlangt wird, in der Regel durch Verwendung von bestimmten Artikeln ('der - die - das - die'; im Englischen der 'definite article the'), die die Bestimmtheit einer Nominalphrase anzeigen.
So ergibt sich eine Schnittmenge, bei der filipinisches ang
indoeuropäischen bestimmten Artikeln entspricht. Außerhalb dieser Schnittmenge drücken in
europäischen Sprachen bestimmte Artikel auch in Nominalphrasen, die nicht das
Subjekt bilden, Bestimmtheit aus. Entsprechende filipinische Phrasen (etwa Objunkte
und Adjunkte) können nicht mit Hilfe des Bestimmungswortes ang bestimmt gemacht
werden. Ebenso – auf der anderen Seite außerhalb der Schnittmenge – wird in
Filipino ang zur Subjektkennzeichnung verwendet, wenn das Subjekt kein Nomen ist.
Entsprechende europäische Gebilde sind nicht möglich, da dort das Subjekt stets ein Nomen
ist {2A-232 (2) ![]() }.
}.
(2) Die filipinische Sprache besitzt keine besonderen Werkzeuge, um fehlende Bestimmtheit anzuzeigen. In den indoeuropäischen Sprachen erfüllen unbestimmte Artikel ('ein'; im Spanischen 'un - una - unos - unas') diesen Zweck. Da diese im Filipino fehlen, wird das Numelale isạ häufig (besonders im westlichen Stil {13-5.1}) als eine Art "unbestimmter Artikel" verwendet {8-7.2 (2)}. In der Regel erlaubt jedoch ein geeigneter Satzbau, die entprechende Nominalphrase z.B. als Prädikat oder als ein Objunkt unbestimmt zu lassen.
{2A-311 ![]() } Bestimmtheit des Subjekts
} Bestimmtheit des Subjekts
(1) Bei {![]() Lopez 1940 p. 111, 113} ist das 'Bekannte'
('known') das Subjekt und das 'Unbekannte'
('unknown') das Prädikat:
Lopez 1940 p. 111, 113} ist das 'Bekannte'
('known') das Subjekt und das 'Unbekannte'
('unknown') das Prädikat:
'Arrangement of a simple thought into a known (subject) and an unknown (predicate).'
'The participation of emotion, of suspense, is particularily clear in questions in which the unknown must always form the predicate.'
(2) Bei {![]() Schachter 1972 p. 60}
spielt die Bestimmtheit des Subjekts eine wichtige Rolle:
Schachter 1972 p. 60}
spielt die Bestimmtheit des Subjekts eine wichtige Rolle:
'One of the chief distinctions between the Tagalog topic and the English subject is that a topic never expresses a meaning of indefiniteness, while a subject may or may not.'
{2A-331 Σ} Satzanalyse: Adverbiales ANG
| Ngayọng akọ ay may sapạt nang edạd ngunit kauntịng kaalamạn, napạgtantọ kong ang pagkalingạ ng magulang ang tunạy kong hinahanap. {W Damaso 4.1} Jetzt bin ich alt genug, habe nur wenig Kenntnis, und mir wird bewusst, dass ich in Wirklichkeit danach strebe, mich auf die Suche nach meinen Eltern zu machen. | ||||
| [1] Ngayong ako ay may … | [2+3] napagtanto kong ang pagkalinga … hinahanap | |||
| {S-0/L/TYP} | {S-Tb(S-0 S-L]} | |||
| [2] napagtanto ko- | [3] -ng ang pagkalinga … hinahanap | |||
| {S-0/L/P0} | {S-L/PT} | |||
Der zusammengesetzte Satz besteht aus zwei voneinander unabhängigen Teilsätzen [1 2+3]. | ||||
Der zweite unabhängige Teilsatz [2+3] besteht aus zwei Teilsätzen. [2] ist der übergeordnete subjektlose Teilsatz, dessen Subjekt der Ligatursatz [3] ist. | ||||
napagtantong hanapin sind verbundene Verben. Der Satz ist zusammengesetzt, weil das Subjekt tunay kong hinahanap des untergeordneten Teilsatzes nicht zu dem übergeordneten Verb passt {13-4.4.1}: | ||||
| [1] Ngayọng akọ ay may sapạt nang edạd ngunit kauntịng kaalamạn Jetzt bin ich alt genug, habe nur wenig Kenntnis | ||||||||||
| ngayong ako ay may sapat nang edad ngunit kaunting kaalaman | ||||||||||
| {S-0/L/TYP} | ||||||||||
| ngayong | ako | ay may sapat nang edad ngunit kaunting kaalaman | ||||||||
| {P-L=P-A} | {P-T=P-N} | {P-P=P-OD} | ||||||||
| may sapat nang edad ngunit kaunting kaalaman | ||||||||||
| {P-OD(OD P-N K P-N} | ||||||||||
| sapat nang edad | kaunting kaalaman | |||||||||
| {P-N(U A/HG.L N)} | {P-N(U.L N)} | |||||||||
| ngayong | ako | ay | may | sapat | nang | edad | ngunit | kaunting | kaalaman | |
| A.L | HT | TP | OD | U | A/HG.L | N | K | U.L | N | |
| jetzt | ich | genug | schon | Alter | aber | wenig | Kenntnis | |||
Das Adverb ngayon aus der kanina Gruppe wird hier mit Ligatur verwendet {9-5.3 (1)}. Syntaktisch ist es ein Attribut zu ako (und damit Teil des Subjekts), während es sich semantisch auf den gesamten Teilsatz bezieht. | ||||||||||
| [2] napạgtantọ ko mir wird bewusst | |||
| napagtanto ko | |||
| {S-0/L/P0(P-P=P-D(DB P-W))} | |||
| napagtanto | ko | ||
| DB10/N | TW.HT | ||
| bewusst | ich | ||
Subjekt des Teilsatzes [2] ist der Ligatursatz [3] {2-4.9 (1)}. | |||
| [3] -ng ang pagkalingạ ng magulang ang tunạy kong hinahanap dass ich in Wirklichkeit danach strebe, mich auf die Suche nach meinen Eltern zu machen | ||||||||
| -ng ang pagkalinga ng magulang ang tunay kong hinahanap | ||||||||
| {S-L/PT)} | ||||||||
| ang pagkalinga ng magulang | ang tunay kong hinahanap | |||||||
| {P-P=P-N} | {P-T=P-D} | |||||||
| ang pagkalinga ng magulang | tunay kong hinahanap | |||||||
| {P-N(A/UG N P-W)} | {P-D(A//U TW.HT.L DB} = {GGW} | |||||||
| -ng | ang | pagkalinga | ng | magulang | ang | tunay | kong | hinahanap |
| .L | A/UG | N | TW | N | TT | A//U | TW.HT.L | DB |
| Ausschau | Eltern | echt | ich | suchen | ||||
Der Kern dieses Teilsatzes ist Pagkalinga ang hinahanap ko. Wie häufig bei Sätzen mit hanapin, wird das Verb zum Subjekt gemacht und das Prädikat mit einem adverbialem ANG versehen (Beispiel: Ang mga bata ang hinahanap ko.). | ||||||||
Da wir adverbiales ANG als proklitisches Adverb betrachten {2-3.3 (2) Θ}, ist ang nach dem Bestimmungswort, der Ligatur -ng von ko, kein zweites Bestimmungswort {13-3 (3)}. Es ist Teil der Nominalphrase. | ||||||||
{2A-332 Σ} Satzanalyse: Adverbiales ANG (Zusatzgewicht für Existenzphrase im Prädikat), Attribute zu Existenzphrase
| Ngunit tanging ang may mabubuting kaloobạn lamang ang maaaring makakuha nito. {W Samadhi 4.1} {13A-101 [5] Σ} Aber um das zu bekommen, braucht man viel Willensstärke. Wörtlich: aber besonders der, der gute Willensstärken hat, kann den [Topf des Reichtums] bekommen. | ||||||||||
| ngunit tanging ang may mabubuting kalooban lamang ang maaaring makakuha nito | ||||||||||
| {S-K/L/PT} | ||||||||||
| ngunit | tanging ang may mabubuting kalooban lamang | ang maaaring makakuha nito | ||||||||
| {P-P=P-OD(A//U.L A/UG OD P-N)} | {P-T=P-D} | |||||||||
| mabubuting kalooban lamang | ||||||||||
| {P-N(U.L N A/HG)} | ||||||||||
| ngunit | tanging | ang | may | mabubuting | kalooban | lamang | ang | maaaring | makakuha | nito |
| K | A//U.L | A/UG | OD | U/M.L | N | A/HG | TT | AH.L | DT10/W | TW.HP/3 |
| aber | besonders | vorhanden | gut | Willens- stärke | eben | kann | erhältlich sein |
dies | ||
Neben dem "gemeinen" Attribut (der Nominalphrase mabubuting kalooban lamang) besitzt das Existenzwort may zwei weitere Attribute: das adverbial verwendete Adjekiv tangi mit Ligatur (es ist daher Subjunkt und keine unabhängige Phrase) und und das Adverb ang. Die Attribute stehen innerhalb der Existenzphrase, sind aber nicht Teil der Nominalphrase. | ||||||||||
Das adverbiale ANG steht nicht am Anfang des Prädikats, sondern vor der Existenzphrase. Daher verstärkt es nur die zum Prädikat gehörige Existenzphrase. | ||||||||||
Als proklitisches Adverb kann das adverbiale ANG die Ligatur von tanging nicht übernehmen. So bleiben die Ligatur von tanging und das Adverb ang nebeneinander stehen. | ||||||||||
| |||||||
{2A-431} Vollverben und Partizipien
[1] Die Betrachtunges des Abschnitts {2-4.3} gelten, wenn die Verbphrase Prädikat bzw. Subjekt des Satzes ist. Dann besitzt das Verb Argumente, und es ist Vollverb (Verb mit globaler Wirkung).
(2) Als Partizipien bezeichnen wir Verben, wenn sie keine Argumente besitzen können und daher keine globale Wirkung haben. Sie können an Stelle von Adjektiven, Adverbien und Substantiven verwendet werden und unterscheiden sich dabei syntaktisch von Vollverben. Morphologisch unterscheiden sich Partizipien und Vollverben nicht.
Der Unterschied zwischen Vollverben und Partizipien wrd besonders deutlich, wenn Partizipien in Existenzphrasen verwendet werden [1|2].
|
{2A-451 Σ} Satzanalyse: Untergeordnetes Verb als Subjekt mit Bestimmungswort ang
| [1] Sinikap ng lobo ang tumalọn upang makaahong palabạs. {W Äsop 3.1.1} Der Wolf versuchte zu springen, um da heraus zu kommen. | |||||||
| sinikap ng lobo ang tumalon | upang makaahong palabas | ||||||
| {S-0/L/PT} | {S-K/B/P0} | ||||||
| sinikap ng lobo | ang tumalon | ||||||
| {P-P=P-D} | {P-T=P-D} | ||||||
| sinikap | ng | lobo | ang | tumalon | upang | makaahong | palabas |
| DB10/N | TW | N/Es | TT | DT01/W | K | DT00/W.L | A |
| anstreben | Wolf | springen | um | nach oben kommen | nach draussen | ||
Das mit ang markierte Subjekt tumalon ist ein dem Prädikat sinikap untergeordnetes Verb im Infinitiv. Der Satz besitzt Verben sowohl als Prädikat und Subjekt. Dies wird deutlich, wenn das untergeordnete Verb zum Prädikat eines Ligatursatzes gemacht wird [3]. | |||||||
Der untergeordnete Konjunktionssatz ist subjektlos. | |||||||
Alternative Gebilde:
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-P_A.html
{3A-401 Σ} Satzanalyse: Wechsel von Objunkt nach Adjunkt, Nominalphrase ohne Kernwort
| Iniayos muna (ni Bidong) ang higaạn ni Lino bago ang sa kaniyạ. {W Daluyong 15.05} Zuerst richtete Bidong das Bett von Lino, und dann sein eigenes. | ||
| [1] Iniayos muna (ni Bidong) ang higaan ni Lino | [2] bago ang sa kaniya | |
| {S-0/L} | {S-K/B} | |
| [2] bago ang sa kaniya | ||||||
| bago [iniayos] ang [higaan] sa kaniya | ||||||
| [iniayos] | ang [higaan] sa kanya | |||||
| {P-P=P-D( |
{P-T=P-N} | |||||
| [higaan] sa kaniya | ||||||
| {P-N( | ||||||
| bago | ang | sa | kaniya | |||
| K | TT | TK | HT/K | |||
Häufig bildet die Konjunktion bago einen verkürzten Teilsatz, in dem das Prädikat nicht wiederholt wird {13-4.6.3 (2)}. | ||||||
Die Nominalphrase, die das Subjekt bildet, besitzt kein Kernwort | ||||||
Da das Kernwort der Nominalphrase entfallen ist, wird das Attribut vom Objunkt zum Adjunkt geändert (ang higaan niya → ang sa kanya). | ||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-W_A.html
{5A-201 Θ} Attribut und ergänzte Phrase
Als abhängige Phrase ist das Subjunkt ein Attribut. Da das Subjunkt vor oder nach der ergänzten Phrase steht, kann die Frage entstehen, welche Phrase das Attribut ist und welche ergänzt wird. Das geschieht in folgenden Fällen:
Der Satz muss sinnvoll bleiben, wenn das Attribut entfernt wird.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
{5A-221} Unverträglichkeit mit der Ligatur
(1) Unverträglichkeit von hindị mit der Ligatur
Die Ligatur entfällt nach hindị [1] bzw.
nach dem letzten Interklitkurzwort, wenn hindị einen Interklit bildet [2].
Außerhalb davon bleibt eine Ligatur erhalten [3 4].
|
{Θ} Wir betrachten die mit hindị gebildeten Phrasen als Subjunkte, da zwischen hindị und dem unmittelbar nachfolgenden Bezugswort eine enge Beziehung besteht, obwohl Phrasen mit hindị keine Ligatur besitzen. Das Adverb hindị kann Attribute erhalten (halos hindị) und dient außerdem als Interklitbezugswort. Aus diesem Grund bildet hindị Adverbphrasen und ist Inhaltswort. Ähnliches gilt für die Adverbien bakạ und sana.
(2)
Die Interrogativadverbien
paano (anọ) und
gaanọ (anọ) werden mit
und ohne Ligatur verwendet.
(3)
kapuwạ,
kạpwa
wird ohne Ligatur verwendet.
(4) Einige spanischen Lehnwörter
werden regelmäßig ohne Ligatur verwendet. Dazu gehören
mas [5],
mẹdyo,
mịsmo als Adverb [6],
siguro [7]:
|
{5A-301} Übersicht über unabhängige Phrasen und Beispiele
|
{5A-302 ![]() } Adverbialphrasen
} Adverbialphrasen
Wenn man den semantischen Begriff Adverbialphrase einführt, ergibt sich folgender Zusammenhang:
| Unabhängige Adverbialphrasen (unabhängig im Satz) |
Syntaktisch abhängige Adverbialphrasen (Bestandteil einer anderen Phrase) | ||
| Adjunktphrasen | Subjunktphrasen
Kurzwörter (Keine Phrasen.) | ||
Disjunktphrasen
|
|||
Bei {![]() Aganan 1999 p. 64 ff.} werden als
pang-abay 'Adverb' alle Phrasen betrachtet,
die dem obengenannten Begriff Adverbialphrase entsprechen. Dazu gehören u.a. Phrasen, die
kein Adverb besitzen (Beispiel sa eskuwelahạn).
Aganan 1999 p. 64 ff.} werden als
pang-abay 'Adverb' alle Phrasen betrachtet,
die dem obengenannten Begriff Adverbialphrase entsprechen. Dazu gehören u.a. Phrasen, die
kein Adverb besitzen (Beispiel sa eskuwelahạn).
{5A-321 Σ} Satzanalyse: Gerundphrase
| Paglabạs ko ng bạnyo, isạng matabạng matandạng lalaki ang naghihintạy sa akin. {W Damaso 3.6} Als ich aus dem Bad kam, wartete ein dicker alter Mann auf mich. | |||||||||||
| paglabas ko ng banyo | isang matabang matandang lalaki | ang naghihintay sa akin | |||||||||
| {P-0=P-ND} | {P-P=P-N} | {P-T=P-D} | |||||||||
| paglabas | ko | ng banyo | |||||||||
| ND | {P-W} | {P-W} | |||||||||
| paglabas | ko | ng | banyo | isang | matabang | matandang | lalaki | ang | naghihintay | sa | akin |
| ND | TW.HT | TW | N | UB.L | U.L | U.L | N | TT | DT01/K | TK | HT/K |
| Außenseite | ich | Bad | eins | dick | alt | Mann | warten | ich | |||
Die unabhängige Gerundphrase wird durch ein Komma vom nachfolgenden Prädikat getrennt. Ein alternatives Gebilde ist Paglabas ko ng banyo ay isang … | |||||||||||
Die Gerundphrase ist kein verkürzter Teilsatz, da eine Erweiterung zu einem vollständigen Satz nicht möglich ist {5-3.2}. | |||||||||||
Das Gerundium besitzt zwei Attribute, die Objunkte ko ("Täter") und ng banyo ("lokativ") | |||||||||||
Das Verb lumabas {DT01/fg|fn} besitzt im Allgemeinen ein Adjunkt, kann aber auch ein lokatives Objunkt {DT10/fg|fn} erhalten. | |||||||||||
{5A-341} Sätze mit nang
In unserem Werkstatt-Korpus haben wir 129 Sätze mit nang untersucht (Schreibung <nang>).
{5A-351 Σ} Satzanalyse: Interklit mit disjunktiver Nominalphrase und Ligatur
| [1] Ilạng araw ko nang hindị nasasalamịn ang isạng larawang mahạl sa akin. {W Uhaw 3.2} Einige Tage schon betrachte ich ein Bild nicht [mehr], das mir teuer ist. | |||||||||
| ilang araw na | hindi nasasalamin ko | ang isang larawan | |||||||
| {P-0=P-N} | {P-P=P-D} | {P-T=P-N} | |||||||
| ilang araw ko nang hindi nasasalamin | |||||||||
| {GGW/P-0|(HT A/HG.L)|(A DB)} | |||||||||
| ilang | araw | ko | nang | hindi | nasasalamin | ang | isang | larawan | |
| U.L | N | TW.HT | A/HG.L | A | DB10/K | TT | U.L | N | |
| einige | Tag | ich | schon | nicht | betrachten | eins | Bild | ||
Die disjunktive Nominalphrase ilạng araw na erhält eine Ligatur wegen des enklitischen Kurzwortes na [2 3] und wird somit zum Subjunkt. | |||||||||
Bezugs-"Wort" des Interklits ist die zum Subjunkt gewordene Disjunktphrase {11-6.1 (3)} | |||||||||
Das Pronomen ko wird an den Anfang seiner Phrase (Prädikat hindi ko nasasalamin) bzw. vor diese Phrase gestellt, um mit dem enklitischen Kurzwort na einen Interklit zu bilden. | |||||||||
| |||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_P-L_A.html
{6A-101 Θ} Tempus- bzw. Aspektflexion der filipinischen Verben
Die deutlich ausgeprägte Tempus- bzw. Aspektflexion ist eine Besonderheit des Filipino (und der anderen philippinischen Sprachen). Andere west-malayo-polynesische Sprachen (z.B. Bahasa Indonesia) besitzen eine solche Flexion nicht. Diesen Sprachen entspricht die Möglichkeit, den Wortstamm statt einer Flexionsform zu verwenden {6-6.3}.
{6A-102} Einteilungen der Verben
Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele der Einteilungen nach verschiedenen Kriterien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{6A-103 Θ} Zeitformen und Partizipien
Zwischen den filipinischen Partizipien und den Zeitformen der Vollverben besteht kein morphologischer Unterschied. Daher ist der Gedanke naheliegend, nur von einer Klasse Vollverb/Partizip zu sprechen. Dieser Gedanke wird dadurch gestützt, dass Partizipgebilde als verkürzte Ligatursätze betrachtet werden können, deren Zeitform syntaktisch zum Partizip in einem verkürzten Gebilde geworden ist {13A-441 Σ}.
Dieser morphologischen Klasse Vollverb/Partizip kann man zwei unterschiedliche Namen geben. Es ist berechtigt zu sagen, die filipinische Sprache besitzt keine Verben, sondern benutzt stattdessen Partizipien. Ebenso kann man sagen, dass es Zeitformen der Verben gibt, die als Partizipien verwendet werden. Wir betrachten diesen Unterschied als rein terminologisch und nicht sachlich. Wir benutzen in unserer Arbeit die zweite Ausdrucksweise.
Trotz des fehlenden morphologischen Unterschieds benutzen wir den Begriff Partizip als syntaktische Beschreibung für eine Gruppe von Verwendungen der Zeitformen, bei denen das Verb keine globale Wirkung im Satz besitzt. Ein weiterer Grund dafür ist, dass der Infinitiv nur selten als Partizip stehen kann, so dass hier ein Unterschied zwischen Vollverb und Partizip besteht.
{6A-201 Θ} Definition von Argument und Attribut
(1) Argumente (kaganapan) sind die Nominalphrasen, die dem Prädikat (bzw. dem Subjekt) semantisch zugeordnet sind {*}. Das erste Argument ist das Subjekt im Fokus des Verbs. Weitere Argumente sind die dem Verb zugeordneten Objunkte, Adjunkte oder Subjunkte. Der Begriff Argument ist semantisch, er beschreibt eine Phrase, die zum Verständnis erforderlich ist.
{*} In {13-2.3 (5)} wird der Begriff Argument auf Nicht-Verb-Prädikate ausgedehnt.
(2) Attribute (panuring) sind Gebilde, die syntaktisch dem Kernwort einer Inhaltsphrase untergeordnet sind {1-6.2 (2)}. Attribut ist also ein syntaktischer Begriff. Wenn ein Vollverb das Prädikat bildet, ist das Subjekt ein Argument, jedoch kein Attribut des Verbs (es ist nicht Teil der Verbphrase), während die anderen Argumente auch Attribute sind (Bestandteil der Verbphrase).
{6A-202} Argumentstruktur im Schlüsselsystem
Die Argumentstruktur wird im Schlüsselsystem dargestellt.
Zunächst unterscheiden wir zwischen Passiv- und Aktivverben mit Schlüssel {DB..} und {DT..} [1 2]. Verben in subjektlosen Sätzen erhalten den Schlüssel {D..} [3 6 7]. Anschließend fügen wir die Zahl der dem Verb zugeordneten Objunkte (erste Ziffer) und der Adjunkte (zweite Ziffer) hinzu. In einigen Fällen sind Subjunktphrasen Argumente von Verben; in unserem Schlüsselsystem wird die Zahl dieser Subjunkte als dritte Ziffer zugefügt [4 5]. Wir stellen die aktuelle syntaktische Situation dar. Weicht diese von der üblichen Argumentstruktur des Verbs ab, so kann letztere zugefügt werden ([6 7] rechte Spalte).
| ||||||||||||||||||||||||||
{6A-311 ![]() } Fokusklassen bei Schachter et
Otanes
} Fokusklassen bei Schachter et
Otanes
In dem Werk {![]() Schachter 1972 pp. 283-330} werden die verschiedenen
Fokusklassen ausführlich dargestellt. Wir möchten sie mit unseren vergleichen und die
Abweichungen kurz erläutern.
Schachter 1972 pp. 283-330} werden die verschiedenen
Fokusklassen ausführlich dargestellt. Wir möchten sie mit unseren vergleichen und die
Abweichungen kurz erläutern.
| Schachter et Otanes | Unsere Darstellung | |||
| Keine besondere Bezeichnung | {../f0} | Kein Fokus | ||
| Actor focus | AF | Überbegriff für Aktivverben | ||
| Actor focus | AF | {../fg} | Täter | |
| Secondary actor focus | A2F | {../fg} | Ausführender Täter | |
| Actor permitting or causing the action | AF | {../fh} | Veranlasser | |
| Keine besondere Bezeichnung | {../ft} | Erwäger | ||
| Social verbs | AF | {../fr} | Reziprok | |
| Intransitive verbs that are essentially non-actional in character | AF | {../fs} | Zustand | |
| Goal focus | GF | Überbegriff für Passivverben | ||
| Object focus | OF | {../ft} | Tatobjekt | |
| Referential focus 'Referential focus' ist eine Art Tatobjektfokus, wobei das Tatobjekt in einem entsprechenden Aktivsatz eine Präpositionalphrase, im Allgemeinen mit tungkọl, bildet. |
RfF | Unabhängige Präpositionalphrase, nur scheinbar Argument des Verbs. | ||
| Benefactive focus | BF | {../fp} | Empfänger | |
| Directional focus | DF | {../fn} | Ort | |
| Locative focus | LF | {../fn} | Ort | |
| Wir verzichten auf eine Unterscheidung zwischen Richtung und Ort. | ||||
| Causative focus | CF | {../fs} | Ursache | |
| Keine besondere Bezeichnung | {../fl} | Austausch | ||
| Instrumental focus | IF | {../fm} | Werkzeug | |
| Reservational focus | RF | 'Reservational focus' ist in etwa eine Sonderform, wenn Verben von 'reservational' an Stelle von 'instrumental' Adjektiven abgeleitet sind. | ||
| Measurement focus | MF | Keine besondere Erwähnung. | ||
{6A-321} Häufigkeit von Aktiv und Passiv
(1) Wir haben 2005 eine statistische Untersuchung der Häufigkeit von Aktiv und Passiv vorgenommen {W Akt-Pass}. In den meisten Texten wird in über 80 % der Fälle (wenn eine Wahlmöglichkeit besteht) das Passiv vorgezogen.
(2) Wir haben die Häufigkeit der Zeitformen von einigen Verben in unserem Werkstatt-Korpus (Grammatikbücher ausgenommen) gezählt. Die Zahlen in |..| enthalten auch "nicht verbal" verwendete Formen (Beispiel {N//V..}). Gerundien werden nicht gezählt.
| Stamm | Passiv | Aktiv |
| sabi | sabihin |200| | magsabi |8| |
| kita | makita |170| | magkita |15| |
| bigạy | bigyạn |30|, ibigạy |35| | magbigạy |30| |
| puntạ | puntahạn |12| | pumuntạ |15|, magpuntạ |25| |
{6A-3421} Täter und Veranlasser
(1) Wir unterscheiden bei den Verben der Veranlassung zwischen (ausführendem) Täter und Veranlasser (Initiator). Wir beziehen diese Begriffe auf die Grundbedeutung des Wortstammes des Verbs [1-3]. In Satz [4] besitzt das Verb keine Modalität des Veranlassens, stattdessen bezeichnet der Wortstamm utos des Verbs utusan semantisch die Tätigkeit des Veranlassens. Deshalb besitzt es aus grammatischer Sicht nur einen Täter (der die Tat des Aufforderns ausführt) und keinen Veranlasser.
| |||||||||||
(2) {![]() Schachter 1972 p.
321 ff.} bezeichnet die Verben der Veranlassung als 'indirect-action
verbs'. Der Veranlasser wird als 'actor' und der ausführende
Täter als 'secondary actor' betrachtet.
Schachter 1972 p.
321 ff.} bezeichnet die Verben der Veranlassung als 'indirect-action
verbs'. Der Veranlasser wird als 'actor' und der ausführende
Täter als 'secondary actor' betrachtet.
(3) Bei {![]() Ramos 1985 p. 267}
werden die Begriffe 'causative actor (initiator, causer)' für
den Veranlasser und 'non-causative actor (agent)' für den
ausführenden Täter verwendet.
Ramos 1985 p. 267}
werden die Begriffe 'causative actor (initiator, causer)' für
den Veranlasser und 'non-causative actor (agent)' für den
ausführenden Täter verwendet.
(4) {![]() Santiago 2003 B p. 192}
bezeichnet den Veranlasser als pagpapagawa sa iba.
Santiago 2003 B p. 192}
bezeichnet den Veranlasser als pagpapagawa sa iba.
{6A-3431} Zustand, Veränderung eines Zustandes und zustandsähnliche Tätigkeit
Es gibt einen fließenden Übergang zwischen Verben, die echte Zustände, Veränderungen von Zuständen und zustandsähnliche Tätigkeiten beschreiben.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{6A-401} Syntax der Verben mit Suffix -an
{6A-611} Tabelle der Flexionsformen
Das Zeichen & kennzeichnet die Doppelung der ersten Stammsilbe.
| Aus Präfixanlaut m wird n in Präteritum und Präsens | |||||
| Affix | Stamm | Infinitiv | Präteritum | Präsens | Futur |
| ma- | tulog | matulog | natulog | natutulog & | matutulog & |
| alịs | maalịs | naalịs | naaalịs & | maaalịs & | |
| ma- | dinịg | marinịg | narinịg | naririnịg & | maririnig̣ & |
| ma--an | sakịt | masaktạn | nasaktạn | nasasaktạn & | masasaktạn & |
| ma--an | alam | malaman | nalaman | nalalaman & | malalaman & |
| mag- | handạ | maghandạ | naghandạ | naghahandạ & | maghahandạ & |
| isạ | mag-isạ | nag-isạ | nag-iisạ & | mag-iisạ & | |
| sulat | magsulạt {*} | nagsulạt | nagsusulạt & | magsusulạt & | |
| mag--an | tulong | magtulungạn {*} | nagtulungạn | nagtutulungạn & | magtutulungạn & |
| mag-um- | piglạs | magpumiglạs | nagpumiglạs | nagpupumiglạs | magpupumiglạs |
| magka- | doọn (dito) | magkaroọn | nagkaroon | nagkakaroọn | magkakaroọn |
| magka- | sundọ | magkasundọ | nagkasundọ | nagkakasundọ | magkakasundọ |
| magkang- | galit | magkanggagalit | nagkanggagalit | nagkakanggagalit | magkakanggagalit |
| magpa- | dala | magpadalạ | nagpadalạ | nagpapadalạ | magpapadalạ |
| mai- | bigạy | maibigạy | naibigạy | naibibigạy & | maibibigạy & |
| maipa- | kita | maipakita | naipakita | naipapakita | maipapakita |
| maipag- | kailạ | maipagkailạ | naipagkailạ | naipagkakailạ & | maipagkakailạ & |
| maka- | basa | makabasa | nakabasa | nakakabasa | makakabasa |
| maka- | kita | makakita | nakakita | nakakakita | makakakita |
| makapạg- | aral | makapạg-aral | nakapạg-aral | nakakapag-aral | makakapag-aral |
| makapạgpa- | baryạ | makapạgpabaryạ | nakapạgpabaryạ | nakakapagpabaryạ | makakapagpabaryạ |
| makapang- | tiwala | makapaniwala | nakapaniwala | nakakapaniwala | makakapaniwala |
| maki- | alam | makialạm | nakialạm | nakikialạm | makikialạm |
| mang- | pulạ | mamulạ | namulạ | namumulạ & | mamumulạ & |
| amọy | mangamọy | nangamọy | nangangamọy & | mangangamọy & | |
| mapạg- | tantọ | mapạgtantọ | napạgtantọ | napạgtatantọ & | mapạgtatantọ & |
| {*} !! Verb mit Unregelmäßigkeiten in der Betonung. | |||||
| -an und i- erhalten zusätzlich Infix -in- in Präteritum und Präsens | |||||
| Affix | Stamm | Infinitiv | Präteritum | Präsens | Futur |
| -an | bayad | bayaran | binayaran | binabayaran & | babayaran & |
| puntạ | puntaḥan | pinuntaḥan | pinupuntaḥan & | pupuntaḥan & | |
| haya | hayaan | hinayaan | hinahayaan & | hahayaan & | |
| i- | abọt | iabọt | iniabọt | iniaabọt & | iaabọt & |
| bigạy | ibigạy | ibinigạy | ibinibigạy & | ibibigạy & | |
| ika- | galit | ikagalit | ikinagalit | ikinagagalit & ikinakagalit |
ikagagalit & ikakagalit |
| ipa- | dalạ | ipadala | ipinadalạ | ipinapadalạ | ipapadalạ |
| ipag- | bawal | ipagbawal | ipinagbawal | ipinagbabawal & | ipagbabawal & |
| ipang- | bigạy | ipamigạy | ipinamigạy | ipinamimigạy & ipinapamigạy |
ipamimigạy & ipapamigạy |
| isa- | gawạ | isagawạ | isinagawạ | isinasagawạ | isasagawạ |
| ka--an | bakạs | kabakasạn | kinabakasạn | kinababakasạn & kinakabakasạn |
kababakasạn & kakabakasạn |
| pa--an | tunay | patunayan | pinatunayan | pinapatunayan | papatunayan |
| pag--an | mulạ | pagmulạn | pinagmulạn | pinagmumulạn & | pagmumulạn & |
| Suffix -in wird ersetzt durch Infix -in- in Präteritum und Präsens {6A-6111} | |||||
| -in | sulat | sulatin | sinulat | sinusulat & | susulatin & |
| dalạ | dalhịn | dinalạ | dinadalạ & | dadalhịn & | |
| bati | batiin | binati | binabati & | babatiin & | |
| gawạ | gawịn | ginawạ | ginagawạ & | gagawịn & | |
| pa--in | tawad | patawarin | pinatawad | pinapatawad | papatawarin |
| pag--in | tibay | pagtibayin | pinagtibay | pinagtitibay& | pagtitibayin & |
| Infix -um- entfällt im Futur | |||||
| Affix | Stamm | Infinitiv | Präteritum | Präsens | Futur |
| -um- | alịs | umalịs | umalịs | umaalịs & | aalịs & |
| puntạ | pumuntạ | pumuntạ | pumupuntạ & | pupuntạ & | |
{6A-6111} Infix -in-, Präfix ni- oder na- (-in, -an und i- Verben)
Infix -in- wird nach dem ersten Konsonanten des Wortstamms [1-3] bzw. eines Präfixes eingefügt [5 6]. Ein Präfix i- wird dabei nicht beachtet [4 7-9].
Beginnt der Wortstamm mit einem Vokal, wird ein Präfix in- gesetzt vor den ersten Vokal des Wortstammes [10-12] bzw. vor das alleinige Präfixes i- [13].
{Θ} Eine phonologisch genaue Betrachtung zeigt, dass das vorangestellte in ein Infix -in- ist. Es besitzt kein Po [ ʔ ] als Anlaut und kann daher nicht am Wortanfang stehen. In [10-13] wird es nach dem Konsonanten Po [ ʔ ] eingeschoben (Beispiel alisịn [ʔʌlɪ'sɪn] → inalịs [ʔ + ɪn + ʌlɪs = ʔɪnʌ'lɪs]). Das Präfix i- besitzt ein Po [ ʔi ].
Soll -in- dem Wortstamm zugefügt werden und beginnt dieser mit dem Konsonanten l oder y, so wird stattdessen vor den Stamm Präfix ni- gesetzt [14-16]. Gleiches gilt für eine Anzahl von Verben mit Stammanlaut h [17 18], wenn sie mit Präfix i- gebildet werden. Ein Ersatz von -in- durch ni- findet auch bei Lehn- und Fremdwörtern statt [19] {7-2.4.1}.
Ersatz des Infixes -in- durch das Präfix na- siehe {6A-6112}.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{6A-6112} Präfix na- statt Infix -in- in Präteritum und Präsens
(1) Aus vermutlich phonologischen Gründen kann das Infix -in- durch das Präfix na- ersetzt werden. In der Alltagssprache wird davon bei -in und i- Verben häufig Gebrauch gemacht (seltener bei -an Verben). Bei Lehnwörtern, insbesondere mit Konsonatenkombination als Stammanlaut, kommen diese Bildungen ebenfalls vor (plantsahin).
Die na- Formen werden auch verwendet, wenn ein entprechendes ma- Verb nicht
gebildet wird (Beispiele napatigil ↔
mapatigil, naisaloọb ↔
maisaloob).
| Affix | Infinitiv | Präteritum | Präsens | Futur |
| -an | saktạn | sinaktạn nasaktạn [1] |
sinasaktạn nasasaktạn |
sasaktạn |
| turan | tinuran naturan [2] |
tinuturan natuturan |
tuturan | |
| -in | tanggapịn | tinanggạp natanggạp [3a] |
tinatanggạp natatanggạp |
tatanggapịn |
| plantsahin | naplạntsa |
napaplạntsa |
paplantsahin | |
| i- | iakyạt | iniakyạt naiakyạt |
iniaakyạt naiiakyạt |
iaakyat |
| ipa- | ipadalạ | ipinadalạ naipadalạ [3b] |
ipinapadalạ naipapadalạ |
ipapadalạ |
| pa--in | patigilin | pinatigil napatigil [4] |
pinapatigil napapatigil |
papatigilin |
| isa- | isaloọb | isinaloob naisaloọb [5] |
isinasaloọb naisasaloọb |
isasaloọb |
|
(2) {Θ} Das Flexionspräfix na-, das -in- ersetzt, ist nicht deutlich vom Flexionspräfix na- der ma- Verben zu unterscheiden. Hinzu kommt, dass die Modalität der Fähigkeit bei vielen "echten" Verben mit dieser Modalität im Präteritum nur schwach ausgeprägt ist {7A-301 (2)}. Trotzdem betrachten wir na- als ein Allomorph von -in-, wenn semantisch die Modalität der Fähigkeit nicht dargestellt wird.
{6A-621} Ergebnisse einer Analyse über Tempus und Aspekt
(1) Wir haben die Verwendung der Zeitformen von Verben in den Sätzen eines Romankapitels {W Nanyang 11} untersucht. Das Romankapitel erzählt eine Geschichte, die sich in der Vergangenheit abgespielt hat. Deswegen liegt vorwiegend Tempus Vergangenheit vor, Ausnahmen sind u.a. wenige Sätze in direkter Rede. Für unsere Zwecke kann das Romankapitel in drei Teile geteilt werden. Im einem ersten Teil werden sich regelmäßig wiederholende Vorgänge dargestellt "Allgemein". Aus diesen entwickelt sich eine einmalige Geschichte, die im dritten Teil dargestellt wird "Einmalig". Dazwischen liegt ein Übergangsteil "Übergang".
| {W Nanyang 11} | Nein | Gramm. | Freie Zeitform | ΣΣ | ||||||||
| D/W | D/N | D/N | D/K | D/K | D/K | D/H | D/H | Σ | ||||
| Per | ? | Imp | It | ? | … | (W) | ||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | ||
| Allgemein | 32 | 12 | 3 | 2 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 46 | 58 | |
| Übergang | 18 | 10 | 16 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 65 | |
| Einmalig | 29 | 25 | 74 | 0 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 100 | 154 | |
| ΣΣ | 79 | 47 | 93 | 2 | 15 | 49 | 7 | 11 | 6 | 183 | 309 | |
| 25 % | 15 % | 60 % | 100 % | |||||||||
| 51 % | 1 % | 8 % | 27 % | 4 % | 6 % | 3 % | 100 % | |||||
Von den insgesamt 309 Teilsätzen besitzt ein Viertel keine Zeitform ("Nein", 25 % in Spalte [1] der vorletzten Zeile in der Tabelle). Weitere 15 % verwenden den Infinitiv [2], der im untersuchten Text in allen Fällen durch syntaktische Regeln bestimmt ist "Gramm.". Somit verbleiben 183 Teilsätze, deren "freie Zeitformen" eine Untersuchung über Tempus und Aspekt erlauben. Betrachtet man diese als Gesamtheit (100 % in letzter Tabellenzeile), so ergibt sich folgendes Bild:
| |||||||||||||||||
(2) Zusätzlich haben wir eine ähnliche Untersuchung für eine Kurzgeschichte durchgeführt {W Krus} (159 Teilsätze). Die Ergebnisse sind vergleichbar mit denen des Romankapitels. Auch zu dem Ausnahmesatz [13] gibt es ein entsprechendes Beispiel [16]:
| |||||
{6A-6251 ![]() } Tempus und Aspekt in der filipinischen
Sprache
} Tempus und Aspekt in der filipinischen
Sprache
| Tempus Panahunan |
Infinitiv Pawatạs |
Präteritum Pangnagdaạn |
Präsens Kasalukuyan |
Futur Panghinaharạp | |
| Aspekt Pananạw | Perfektiv Pangganạp |
Imperfekiv Di-pangganạp |
Kontemplativ Mapagdili-dili | ||
| 'Aspect' | 'Contingent/Punctual' | 'Actual/Punctual' | 'Actual/Durative' | 'Future/Durative' | |
| { | |||||
| Aspekt | Irrealis/Perfektiv | Realis/Perfektiv | Realis/Imperfektiv | Irrealis/Imperfektiv | |
| { | |||||
| 'Aspect' { |
'Perfect' | 'Imperfect' | 'Contemplative' | ||
| Aspekto { |
Perpektibo | Imperpektibo | Kontemplatibo | ||
{*} Es wird zwischen zwei 'modes (actual, contingent)' und zwei 'aspects (punctual, durative)' unterschieden.
{6A-631 Θ} Wortstamm als verkürzte Verbform und Genus Verbi
Bei der Verwendung des Wortstammes als verkürzte Verbform ist das Genus Verbi nicht mehr sichtbar. Syntaktisch bleibt es jedoch erhalten, da Subjekt bzw. Objunkt unverändert beibehalten werden. Dadurch ergibt sich ein syntaktischer Unterschied zwischen {DB//X} und {DT//X}, der morphologisch entfallen ist.
|
{6A-6521} Iterative Gerundien
(1) Bei {![]() VCS ka-} gibt es zwei Gruppen von Verbformen mit Präfix
ka-.
VCS ka-} gibt es zwei Gruppen von Verbformen mit Präfix
ka-.
(2) Die Beispiele sind entnommen aus Domingo L. Diaz
Mabisang Wika, Aralin 13, {![]() Liwayway 15 Mayo 2006
p. 45}.
Liwayway 15 Mayo 2006
p. 45}.
|
{6A-721 Σ} Satzanalyse: Verbundene Verben (zusammengestzter Satz)
| [1] Halos apat na sịglo nang sinisikap sinupin ang bokabulạryo ng ating wika. {W Javier 3.1} Seit fast vier Jahrhunderten wird schon daran gearbeitet, den Wortschatz unserer Sprache zu sammeln. | ||||||||||||
| halos apat na siglo nang sinisikap sinupin ang bokabularyo ng ating wika | ||||||||||||
| {S-Tb(S-0/L S-L)} | ||||||||||||
| halos apat na siglo nang sinisikap | || | sinupin ang bokabularyo ng ating wika | ||||||||||
| {S-0/L/P0} | {S-L/PT} | |||||||||||
| halos apat na siglo nang | sinisikap | sinupin | ang bokabularyo ng ating wika | |||||||||
| {P-0=P-N(P-L N A/HG} | {P-P=P-D} | {P-P=P-D} | {P-T=P-N(N P-W)} | |||||||||
| halos | apat | na | siglo | nang | sinisikap | sinupin | ang | bok. | ng | ating | wika | |
| A | UB | L | N/Es | A/HG.L | DB10/K | DB10/W | MT | N/Es | TW | U//HT/K.L | N | |
| fast | vier | Jahr- hund. | schon | arbeiten | sammeln | Voka- bular |
wir | Spra- che | ||||
Der Satz mit verbundenen Verben ist zusammengesetzt. Ein einfacher Satz ist nicht möglich, da sinisikap und ang bokabularyo nicht zueinander passen [2b]. | ||||||||||||
Die disjunktive Nominalphrase halos na apat na siglo besitzt ein nachgestelltes Attribut (enklitisches Adverb na). Sie hat als einfaches enklitisches Gebilde eine Ligatur {5-3.5}. | ||||||||||||
Außer dem Ligatursatz, der das untergeordnete Verb als Prädikat besitzt, hat das Verb sinisikap kein Argument. | ||||||||||||
Zwischen den verbundenen Verben steht keine Ligatur, die na Form der Ligatur kann wegfallen [1|3 4|5] {5-2.2 (1)}. | ||||||||||||
| ||||||||||||||
{6A-722 Σ} Satzanalyse: Verbundene Verben (einfacher Satz)
| [1] Hindị maiwasang sumalimbạy sa gunitạ ni Oden ang mga tanawin ng gamasạn. {W Anak ng Lupa 3.5} Oden musste sich an die Aussichten auf die grünen Felder erinnern [konnte nicht vermieden werden, in der Erinnerung zu gleiten]. | ||||||||||||
| hindi maiwasang sumalimbay sa gunita ni Oden ang mga tanawin ng gamasan | ||||||||||||
| {S-0/L/PT} | ||||||||||||
| hindi maiwasang sumalimbay sa gunita ni Oden | ang mga tanawin ng gamasan | |||||||||||
| {P-P=P-D(A DB P-L=P-D} | {P-T=P-N(Y/M N P-W)} | |||||||||||
| hindi maiwasang | sumalimbay sa gunita ni Oden | |||||||||||
| {P-L=P-D(DT P-K)} | ||||||||||||
| hindi | maiwasang | sumalimbay | sa | gunita | ni | Oden | ang | mga | tanawin | ng | gamasan | |
| A | DB001/W.L | DT01/W | TK | N | TW.Y | N/Ta | TT | Y/M | N | TW | N | |
| nicht | vermeiden | gleiten | Erinnerung | Aussicht | bestelltes Feld | |||||||
Einfacher Satz, da beide Verben und das Subjekt zueinander passen [2 3]. | ||||||||||||
Das Subjunkt sumalimbay … ist Argument des Verbs maiwasan. | ||||||||||||
|
{6A-723 Σ} Satzanalyse: Verbundene Verben (zusammengesetzter oder einfacher Satz)
Der nachfolgende Satz kann als zusammengesetzter Satz [1] oder als einfacher Satz analysiert werden [2].
| [1] Hinayaan nilạ na natutulog si Busilak sa kama. {W Busilak 3.5} Sie ließen Schneewittchen weiter in ihrem Bett schlafen. | ||||||||
| hinayaan nila | na natutulog si Busilak sa kama | |||||||
| {S-0/L/P0} | {S-L/PT} | |||||||
| hinayaan nila | natutulog | si Busilak | sa kama | |||||
| {P-P=P-D} | {P-P=P-D} | {P-T=P-N} | {P-K/L} | |||||
| hinayaan | nila | na | natutulog | si | Busilak | sa | kama | |
| DB10/N | TW.HT | L | DT00/K | Y/Ta | N/Ta | TK | N/Es | |
| lassen | sie | schlafen | Busilak | Bett | ||||
[1] ist ein zusammengesetzter Satz, dessen übergeordneter Teilsatz ein Prädikat besitzt und in dem ein Ligatursatz das Subjekt ersetzt {13-4.4.1}. | ||||||||
Das zweite Verb natutulog steht im Präsens (imperfektiver Aspekt), da keine Konflikte bezüglich der globalen Wirkung bestehen. | ||||||||
| [2] Hinayaan nilạ na natutulog si Busilak sa kama. Sie ließen Schneewittchen weiter in ihrem Bett schlafen. | |||||||
| hinayaan nila na natutulog si Busilak sa kama | |||||||
| {S-1/PT} | |||||||
| hinayaan nila na natutulog | si Busilak | sa kama | |||||
| {P-P=P-D(DB P-W P-L=P-D} | {P-S=P-N} | {P-K/L} | |||||
| nila | na natutulog | ||||||
| {P-W=P-N} | {P-L=P-D} | ||||||
Die Argumentstrukturen beider Verben sind kompatibel, das Subjekt si Busilak passt trotz unterschiedlicher Funktionsstruktur zu beiden Verben. | |||||||
Das übergeordnete Verb besitzt drei Argumente, das Subjekt si Busilak (Empfänger oder Tatobjekt), das Objunkt nilạ (Täter) und das Subjunkt na natutulog {6-2.3 (2)}. | |||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_01A.html
{7A-101} Studie 'Syntax der einfachen Verben'
In einer Studie 'Syntax der einfachen Verben' {W Einf Verb} haben wir die Zusammenhänge zwischen Morphologie und Syntax der einfachen Verben aus 150 zufällig ausgewählten Wortfamilien (etwa 300 Verben) betrachtet. Die Studie stellt Daten zusammen, die in Kapitel {7} ausgewertet werden.
{7A-111 Θ} Präfix ma-
(1) Präfix ma-, allein und in Affixkombinationen, ist das am häufigsten verwendete Präfix in der filipinischen Sprache. Mit ma- werden Adjektive und vor allem Verben gebildet. In Präfixkombinationen steht es an der ersten Stelle der Kombination. Zur Bildung von Substantiven wird ma- (auch in Affixkombinationen) nicht verwendet.
(2) Mit dem alleinigen und unbetonten Präfix ma- geht die Sprache zwei alternative Wege, wobei in einer Wortfamilie – von Ausnahmen abgesehen – nur eine der Ableitungen vorkommt.
Die erstgenannte ma- Ableitung kann ein (kleines) Flexionsparadigma besitzen, durch Silbendoppelung wird eine Pluralform gebildet. Diese Ableitungen gehören zur Wortart der Adjektive. Beispiel:
|
Alternativ kann die ma- Ableitung Aktiv- und Passivverben bilden. Beispiel:
|
(3) Neben diesen Verben mit unbetontem Präfix ma- werden
Verben mit betontem ma- gebildet. Die Zusammenhänge zwischen den Gruppen sind
recht komplex {![]() Himmelmann 2004}.
Stark vereinfacht lässt sich folgendes Schema (ohne Affixkombinationen) aufstellen:
Himmelmann 2004}.
Stark vereinfacht lässt sich folgendes Schema (ohne Affixkombinationen) aufstellen:
| Substantiv | --- | ||||
| Adjektiv | ma- | Besitz einer Eigenschaft | magandạ | {9-2.2.1} | |
| Verb | ma- | Aktiv | Zustand, Prozess | magutom | {7-1.1} |
| Einfache Tätigkeit | matulog | {7-1.1} | |||
| Übergang | mahulog | {7-3.1 [2*]} | |||
| Passiv | Fähigkeit | madalạ | {7-3.1} | ||
| Allomorph na- und -in- | natanggạp | {6A-6112} | |||
| ma- | Aktiv | Zustand, Prozess | maibạ | {7-3.5.1 [3*]} | |
| Einfache Tätigkeit | magisịng | {7-3.5.1 [3*]} | |||
| Übergang | madapạ | {7-3.5.1 [2*]} | |||
| Passiv | Zufall, ohne Absicht | mabasa | {7-3.5.1 [1*]} | ||
(4) Als Flexionspräfix der ma- Verben wird das Präfix na- in Präteritum und Präsens gebildet {6-6.1.1}. Daneben kann aus vermutlich phonologischen Gründen das Flexionsinfix -in- durch das Präfix na- ersetzt werden {6A-6112}.
Deutlich unterscheidbar von Präfix ma- ist das Präfix mang- und seine Lautänderungen, selbst wenn dadurch morphologisch das Präfix ma- entstehen kann (Beispiele: mamahala {DB01/mang+bahala}, manilawa {DB01/mang+tiwala}).
{7A-112} Gebrauch des Präfixes ma-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{7A-113} Verbformen
narito, nandito usw.
Von Demonstativpronomen werden folgende Formen abgeleitet.
| Nahe Sprecher 1. Entfernung |
Nahe Angesprochenem 2. Entfernung | Entfernt 3. Entfernung | ||
| [1] | itọ | iyạn | iyọn | HP |
| [2] | dito | diyạn | doọn | TK.HP |
| [3] | naritọ (dito) | nariyạn | naroọn | DT00/N |
| [4] | nariritọ (dito) | naririyạn | naroroọn | DT00/K |
| [5] | nanditọ (dito) | nandiyạn | nandoọn | DT00/N |
| [6] | nandiritọ (dito) | nandiriyạn | nandoroọn | DT00/K |
Die Wörter [3-6] sind Formen von Verben mit unvollständiger Flexion und keine Adjektive:
Wie betrachten diese Formen als Präteritum und Präsens von Verben, die keine Infinitive [maritọ] usw. und auch keine Futurformen besitzen. Sie werden als Prädikat verwendet; in diesen Sätzen steht kein weiteres Verb [7-9]. Es wird keine Verneinung mit hindị gebildet [10].
|
{7A-121} Lautänderung bei Präfixen mit [ ŋ ]
(1) Die Präfixe mang-, pang-, sang- und sing- enden auf -ng [ ŋ ]. Der Endlaut wird zu [ m ] geändert, wenn die folgende Silbe mit [ b ] oder [ p ] beginnt. Eine entsprechende Änderung in [ n ] findet statt, wenn die folgende Silbe mit [ d l r s t ] beginnt.
Diese Lautänderung wird in der Schrift- und in der Umgangssprache vorgenommen. Zusätzlich kann der Anlaut des Stammes entfallen. In der Regel ist die Bedeutung beider Formen gleich (Beispiel punas → pamunas und pampunas).
Lautänderung | Anlaut Stamm |
Anlaut Stamm entfällt? | ||
| Keine | mang- pang- sang- sing- |
g h k m n w y ŋ ʔ | Nein | gamọt
[gʌ'mɔt] -
manggamọt [mʌŋ.gʌ'mɔt] abay ['ʔa:.baɪ] - pang-abay [pʌŋ'ʔa:.baɪ] |
| Ja | kahoy
['ka:.hɔɪ] -
mangahoy [mʌ'ŋa:.hɔɪ] anạk [ʔʌ'nʌk] - manganạk [mʌ.ŋʌ'nʌk] | |||
| Zu [ m ] | mam- pam- sam- sim- |
b p | Nein | bahay ['ba:.haɪ] -
pambahay [pʌm'ba:.haɪ] pulạ [pʊ'lʌ] - pampulạ [pʌm.pʊ'lʌ] |
| Ja | bilị
[bɪ'lɪ] - pamilihan
[,pa:.mɪ'li:.hʌn] patạy [pʌ'taɪ] - mamatạy [mʌ.mʌ'taɪ] | |||
| Zu [ n ] | man- pan- san- sin- |
d l r s t | Nein | dila
['di:.lʌʔ] -
mandila [mʌn'di:.lʌʔ] sayạw [sʌ'jaʊ] - pansayạw [pʌn.sʌ'jaʊ] |
| Ja | sagọt
[sʌ'gɔt] -
managọt [mʌ.nʌ'gɔt] tiwala [tɪ'va:.lʌʔ] maniwala [mʌ.nɪ'va:.lʌʔ] | |||
(2) Im Fall von Silbendoppelung beruht die Doppelung auf den neuen Sprechsilben [1-4].
| |||||||||||||||||||||||||
(3) Die mit pang- gebildeten Ordinalzahlen dalawạ - pangalawạ [pʌ.ŋʌ.lʌ'vʌ] und tatlọ - pangatlọ [pʌ.ŋʌt'lɔ] folgen nicht obigen Regeln. Eine weitere Ausnahme sind Bildungen wie pangpasarạp {13-4.2.2 (2)}.
{7A-141} Uneigentliche mag- Verben
(1) Uneigentliche mag- Verben mit Fremd- und Lehnwortstämmen (insbesondere aus dem Englischen)
| |||||||||||||
(2) Verben mit substantivischem Stammwort
Das Substantiv als Stammwort ersetzt in der Regel ein Objunkt; dadurch besitzen die
meisten dieser Verben eine {DT00/fa} Syntax (man könnte sagen {DT10-10/fa}) [4]. Statt
eines Substantives kann auch eine Nominalphrase mit Attribut das Stammwort des Verbs
bilden [5].
|
(3) mag- Verben statt -um- Verben aus
phonologischen Gründen
Das Affix -um- ist ein Infix und spaltet den Wortstamm. Wenn die Bildung eines
-um- Verbs aus phonologischen Gründen "schwierig" ist, kann stattdessen ein
mag- Verb gebildet werden. Von dieser Möglichkeit wird bei Lehn- und
Fremdwörtern häufig Gebrauch gemacht, vor allem wenn deren Wortstamm
einsilbig ist oder mit einer Konsonatenkombination beginnt. Beispiele
sind [2 6], magkrus, magshow.
|
(4) mag- Verben in Verbindung mit den
Konjunktionen pagkatapos und bago
Die Konjunktionen pagkatapos
(tapos) und
bago werden mit Verben im Infinitiv
verwendet {13-4.2.2}. Für Zeitangaben
werden aus Zahlen oder Uhrzeiten mit Hilfe des Präfixes mag- Verben der Gruppe
{V00} gebildet [9 10].
|
{7A-301} Modalität der Fähigkeit
(1) Der Begriff der Fähigkeit in der filipinischen Sprache bedarf einer genaueren Betrachtung. Die Modalität der Fähigkeit bezieht sich auf den Täter. Bei den Verben der maka- Gruppe steht dieser im Fokus {7-3.4}, und bei Verwendung dieser Verben wird die Fähigkeit besonders hervorgehoben. Aus dem gleichen Grund drücken Passivverben die Modalität der Fähigkeit in der Regel schwächer aus, da der Besitzer der Fähigkeit nicht im Fokus steht.
(2) Häufig werden Verben der Fähigkeit verwendet, wenn in der Vergangenheit von der Fähigkeit Gebrauch gemacht worden ist [1]. Bei strenger Betrachtung ist dies keine Fähigkeit, sondern eine Tatsache. Ebenso ist die Verneinung einer Fähigkeit eine Tatsache [2]. Wenn die Ausssage sich auf die Zukunft bezieht [3] oder allgemeingültig ist [4], ist die Fähigkeit "echt".
|
(2) Soll eine Fähigkeit im Allgemeinen ausgedrückt werden, also ohne Bezug zu ihrer Realisierung im Einzelfall, können Adjektive [5] oder Pozenzialadverbien [6 7] statt Verben der Fähigkeit (oder zusammen mit ihnen [6]) verwendet werden.
|
{7A-311} Verben mit unbetontem Präfix ma- im Übergang von Passiv nach Aktiv
Die ma- Verben im Übergang von Passiv nach Aktiv besitzen keine Modalität der Fähigkeit.
|
{7A-411} Verben mit Affixen magpa-, pa--an, pa--in und ipa-
| {DT..} | {DB..} | {DB..} | {DB..} | |
| magpa- | pa--an | pa--in | ipa- | |
| alịs | paalisịn | |||
| dalạ | magpadalạ | ipadalạ | ||
| hirap | magpahirap | pahirapan | ||
| kilala | magpakilala | ipakilala | ||
| kita | magpakita | ipakita | ||
Keine Modalität der Veranlassung besitzen Verben, die von Substantiven mit Präfix pa- abgeleitet sind.
|
{7A-412} "Reflexive" Verben der Veranlassung
|
Bei diesen Verben kann das Präfix zu magpati- gewandelt werden. Beispiele sind
magpatianọd
, magpatihulog, magpatirapạ
{![]() VCS magpati-}.
Diese Verben werden selten verwendet.
VCS magpati-}.
Diese Verben werden selten verwendet.
Möglicherweise ist hier der Begriff 'reflexiv' nicht geeignet, wenn man ihn als Sonderform eines transitiven Verbs betrachtet. Nach filipinischem Sprachgefühl ist magpainit vermutlich genau so wenig reflexiv wie gumising.
{7A-501} pag--in, pag--an, ipag- Verben und entsprechende einfache Passivverben
| pag--in | pag--an | ipag- | -in | -an | i- | ||
| [1] | pagluwagịn | --- | luwagạn | iluwạg | {7-5.1} | ||
| [2] | pagbutihin | butihin {U} | --- | ibuti | {7-5.1} | ||
| [3] | pag-isipan | isipin | isipan {N} | --- | {7-5.2} | ||
| [4] | paglingkurạn | --- | lingkurạn {N} | --- | {7-5.2} | ||
| [5] | pagsabihin | pagsabihan | ipagsabi | sabihin | sabihan | --- | {7-5.3} |
| [6] | pagbawalan | ipagbawal | --- | --- | --- | {7-5.3} | |
{7A-511 ![]() } papag--in
Formen
} papag--in
Formen
(1) Die mit papạg--in
gebildeten Formen können als Futur der pag--in Verben betrachtet
werden, wenn man zulässt, dass das Präfix pag- in diesen Fällen doppelungsfähig
ist {6-6.1.2}. Bei
{![]() VCS} werden sie als Verben aufgeführt (im Gegensatz zu Zukunftsformen
anderer Verben).
VCS} werden sie als Verben aufgeführt (im Gegensatz zu Zukunftsformen
anderer Verben).
| |||||||||||||
(2) Bei {![]() Schachter 1972 p. 327}
sind die papag--in Formen Infintive von Verben der Veranlassung mit
Veranlasserfokus, die mag- Verben entsprechen. Der Beispielsatz mit
Stammsilbendoppelung ist im Futur [5].
Schachter 1972 p. 327}
sind die papag--in Formen Infintive von Verben der Veranlassung mit
Veranlasserfokus, die mag- Verben entsprechen. Der Beispielsatz mit
Stammsilbendoppelung ist im Futur [5].
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_D_09A.html
{8A-321 ![]() } Numerusneutralität der filipinischen
Substantive
} Numerusneutralität der filipinischen
Substantive
(1) Die Numerusneutralität der filipinischen Substantive wird aus verständlichen Gründen in Wörterbüchern nicht deutlich gemacht. Korrekt sollte es z.B. heißen: bahay 'Haus, Häuser'.
(2) Bei {![]() Bloomfield 1917 § 251} wird von
'explicit plurality' gesprochen. Ähnlich findet man bei
{
Bloomfield 1917 § 251} wird von
'explicit plurality' gesprochen. Ähnlich findet man bei
{![]() Schachter 1972 p. 111}: 'In Tagalog,
although there is a way of explicitity pluralizing most unmarked nouns, the
pluralization of a noun need not - and, in some cases in fact, cannot - be formally
signaled if the context makes the plural meaning clear.'
Schachter 1972 p. 111}: 'In Tagalog,
although there is a way of explicitity pluralizing most unmarked nouns, the
pluralization of a noun need not - and, in some cases in fact, cannot - be formally
signaled if the context makes the plural meaning clear.'
{8A-401 Θ} Paradigma der Pronomen
In {1-6.1} haben wir sechs Funktionsphrasen vorgestellt. In {1A-632} wird gezeigt, dass Nominalphrasen Inhaltsphrasen in allen sechs sein können. Demgegenüber besitzt das Paradigma der Pronomen nur drei Formen, ANG-, NG- und SA-Pronomen. Dazu die folgenden Kommentare:
Für Pronomen gilt also das abgewandelte Paradigma:
| Funktionsphrasen | Pronomen |
| Prädikat | (ay +) ANG-Pronomen |
| Subjekt | ANG-Pronomen |
| Objunkt | NG-Pronomen |
| Adjunkt | SA-Pronomen |
| Subjunkt {PP} | SA-Pronomen + Ligatur |
| Subjunkt {PD} | ANG-Pronomen + Ligatur |
| Disjunkt | --- |
{8A-4311} Mit kung, kahit und man gebildete indefinite Begriffe
| kung | man | kahit | ||
| Interrogativpronomen {HN} → Indefinitpronomen {HS(K HN)} {8-4.3.2} | ||||
| sino | kung sino | sino man, sinumạn | kahit sino | |
| kanino | kung kanino | kanino man, kaninumạn | kahit kanino | |
| kung tungkọl sa kanino | tungkọl sa kaninumạn | kahit tungkọl sa kanino | ||
| para kaninumạn | kahit para kanino | |||
| nino | * | nino man, ninumạn | * | |
| anọ | kung anọ | anọ man, anumạn | kahit anọ | |
| saạn | kung saạn | saạn man, saanmạn | kahit saạn | |
| kung tungkọl saạn | tungkọl saạn man | kahit tungkọl saạn | ||
| ng anọ | * | * | ng kahit anọ | |
| Interrogativadjektive {UN} → Indefinitadjektive {US(K UN)} {9-2.4} | ||||
| alịn | kung alịn | alinmạn | kahit alịn | |
| Interrogativadverbien {AN} → Indefinitadverbien {AS(K AN)} {9-4.3.3} | ||||
| bakit | kung bakit | * | * | |
| kailạn | kailanmạn, kailanmạt | |||
| gaanọ | kung gaanọ | gaano man | ||
| paano | kung paano | kahit paano | ||
| ba(gạ) | kung bagạ, kumbagạ | bagamạn, bagamạt | ||
| Interrogativpräposition {ON} → Indefinitivpräposition {OS(K ON)} | ||||
| nasaan (sa) | kung nasaạn | nasaạn man | kahit nasaạn | |
{8A-721} Häufigkeit von isa als "unbestimmter Artikel"
Wir haben in unserem Werkstatt-Korpus die Verwendung von isạ nach Bestimmungswörtern untersucht. In etwa nahezu vier Prozent dieser Fälle wird isạ verwendet.
| Subjekt | ang isa | 118 | ang | 5725 | 2.1 % | |
| Prädikat | ay isa, 'y isa | 49 | ay, 'y | 1275 | 3.8 % | |
| Objunkt | ng isa | 267 | ng | 4825 | 5.5 % | |
| Adjunkt | sa isa | 220 | sa | 5875 | 3.7 % | |
| Gesamt | 654 | 17700 | 3.7 % | |||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_N_A.html
{9A-211} Abgrenzung zwischen Adjektiven und Substantiven
Die Abgrenzung von nicht affigierten Adjektiven und Substantiven bereitet Schwierigkeiten. Die Unterschiede der beiden Wortarten werden deutlich, wenn das Adjektiv attributiv mit Ligatur verwendet wird, das Substantiv jedoch ein Objunkt erhält [1a|c]. Da adjektivische Attribute dem Bezugswort voran- und nachgestellt werden können, ergibt sich hier die Möglichkeit einer Umstellung [1a|b], die bei Substantiven wegen des nachlaufenden Verhaltens der Objunkte nicht möglich ist.
|
{9A-2211} Pluralformen der ma- Adjektive
Vorwiegend werden die Pluralformen der ma- Adjektive attributiv verwendet [1-5]. Seltener sind adjektivische Prädikate [6] und die Verwendung als Substantiv [7]. In der Mehrzahl der Gebilde wird auf eine weitere Pluralanzeige verzichtet [1-3 7]. Wird mga als zusätzliche Pluralanzeige verwendet, so steht es vor dem Adjektiv [4 5].
| |||||||||||||||||||||
{9A-431} Adverb siyạ
Das 'contrast marking'
siyạ
{![]() Schachter 1972 p. 151} (bei
{
Schachter 1972 p. 151} (bei
{![]() Bloomfield 1917 § 106 f.} 'circumlocutary
definite object predicate') ist vom gleichlautenden Personalpronomen zu
unterscheiden; es kann im (bzw. als) Prädikat [1 2] oder Subjekt [3] verwendet werden.
Es kann sich auch auf Dinge und auf Pluralausdrücke beziehen. Im Gegensatz zum
Personalpronomen siyạ, das
Interklitkurzwort sein kann, kann es als Interklitbezugswort dienen, es ist
also ein Inhaltswort [4]. Dieses siyạ verhält sich weitgehend wie ein
Adverb, es bildet vorangestellte Subjunkte, kann jedoch auch als Substantiv betrachtet
werden. Es gibt keine direkte Übersetzung in europäische Sprachen; etwa
'tatsächlich gleich'
oder 'die gleiche Sache/Person tatsächlich'. Weniger deutlich ist
das Gebilde [5].
Bloomfield 1917 § 106 f.} 'circumlocutary
definite object predicate') ist vom gleichlautenden Personalpronomen zu
unterscheiden; es kann im (bzw. als) Prädikat [1 2] oder Subjekt [3] verwendet werden.
Es kann sich auch auf Dinge und auf Pluralausdrücke beziehen. Im Gegensatz zum
Personalpronomen siyạ, das
Interklitkurzwort sein kann, kann es als Interklitbezugswort dienen, es ist
also ein Inhaltswort [4]. Dieses siyạ verhält sich weitgehend wie ein
Adverb, es bildet vorangestellte Subjunkte, kann jedoch auch als Substantiv betrachtet
werden. Es gibt keine direkte Übersetzung in europäische Sprachen; etwa
'tatsächlich gleich'
oder 'die gleiche Sache/Person tatsächlich'. Weniger deutlich ist
das Gebilde [5].
|
{9A-511 Σ} Satzanalyse: Adverbphrase als Attribut eines Substantives
| [1] Hindị ko na kayang sakyạn ang kahọn ng kanyạng kaligayahang ngayọng madalịng araw. {W Madaling Araw 3.10} {*} Ich kann nicht mehr teilnehmen an seinem Glück heute in den frühen Morgenstunden [einsteigen in die Kiste seiner Glückseligkeit]. | ||||||||||||||
| {*} Im Originaltext steht ang kahong statt ang kahon ng. | ||||||||||||||
| hindi ko na kayang sakyan ang kahon ng kanyang kaligayahang ngayong madaling araw | ||||||||||||||
| {S-1/PT} | ||||||||||||||
| hindi ko na kayang sakyan | ang kahon ng kanyang kaligayahang ngayong madaling araw | |||||||||||||
| {P-P=P-D} | {P-T=P-N} | |||||||||||||
| hindi na kayang sakyan ko | kahon ng kanyang kal_hang ngayong madaling araw | |||||||||||||
| {P-D(A A/HG AH.L DB P-W)} | {P-N(N P-W)} | |||||||||||||
| hindi ko na kayang sakyan | ng kanyang kal_hang ngayong madaling araw | |||||||||||||
| {GGW/A|TW.HT|(AH D)} | {P-W=P-N(U//HT/K N P-L)} | |||||||||||||
| -ng ngayong madaling araw | ||||||||||||||
| {P-L=P-A(A P-L)} | ||||||||||||||
| -ng madaling araw | ||||||||||||||
| {P-L=P-N(U.L N)} | ||||||||||||||
| hindi | ko | na | kayang | sakyan | ang | kahon | ng | kanyang | kal. | ngayong | madaling | araw | ||
| A | TW.HT | A/HG | U.L | DB00/W | TT | N/Es | TW | U//HT/K.L | N.L | A.L | U.L | N | ||
| nicht | ich | schon | fähig | einsteigen | Kiste | er | Gl. | jetzt | früher | Morgen | ||||
Der Satzkern ist sakyan ang kahon. Das Potenzialadverb kaya ist Attribut des Verbs sakyan. | ||||||||||||||
Das Substantiv | ||||||||||||||
| kaligayahan besitzt ein nachgestelltes Subjunkt ngayong madaling araw als Attribut. | ||||||||||||||
Das Kernwort dieses | ||||||||||||||
| Attributs ist ngayon,
das wiederum ein Attribut madaling araw besitzt. Dieses Attribut ist nicht direkt
mit kaligayahan verbunden; eine Phrase | ||||||||||||||
Ein Adverb wie ngayon | ||||||||||||||
| wird nur selten als Attribut eines Substantives verwendet {8-7.5}. Es steht in diesem Fall nicht selbständig im Satz, sondern bildet ein durch die Ligatur von kaligayahan angeschlossenes Subjunkt. | ||||||||||||||
| |||||||
In [1] wird der Satz als einfacher Satz analysiert. Es ist möglich, ihn als zusammengesetzten Satz zu betrachten [4] {9A-611 Θ (2)}.
| [4] Hindị ko na kayang sakyạn ang kahọn ng kanyạng kaligayahang ngayọng madalịng araw. | ||||||
| {S-Tb(S-0/L/P0 S-L/PT)} | ||||||
| hindi ko na kaya | -ng sakyan ang kahon ng … | |||||
| {S-0/P0} | {S-L/PT} | |||||
| hindi ko na kaya | sakyan | ang kahon ng … | ||||
| {P-P=P-U} | {P-P=P-D} | {P-T=P-N} | ||||
Der zusammengesetzte Satz hat als Subjekt einen Ligatursatz {2-4.9}. | ||||||
Der Ligatursatz ist verkürzt, das Argument ko des Verbs sakyan wird nicht wiederholt. Der Ligatursatz ist ein Regelsatz mit Prädikat und Subjekt. | ||||||
{9A-611 Θ} Zur Theorie der Potenzialadverbien (Modalwörter)
(1) Wir betrachten Modalwörter als Adverbien, die Verben modifizieren. Sie besitzen keine Verbeigenschaften. Es fehlt die Tempuskonjugation. Es gibt keine Aktiv- und Passivformen, das Modus Verbi kommt vom Verb. Auch besitzen sie keine Argumente, die Argumentstruktur wird vom Verb bestimmt (obwohl das Modalwort sie verändern kann). Verbformen sind affigiert, bei der Mehrzahl der Modalwörter fehlt sie.
Modalwörter und Adverbien besitzen ähnliche Eigenschaften. Beide ergänzen Verben und diese Gebilde erhalten eine Ligatur. Deshalb zählen wir die Modalwörter zu den Adverbien und nennen sie 'Potenzialadverbien' (pang-abay na pangmarahil).
(2) Das Potenzialadverb ist Attribut zum Verb, daher werden einfache Sätze gebildet. Das Prädikat ist die Verbphrase, das Potenzialadverb ist Bestandteil dieser Phrase; es ist also kein zweites Prädikat. Nur in wenigen Fällen ist es möglich, Sätze mit Potenzialadverbien als zusammengesetzte Sätze zu betrachten.
(3) In den meisten Sätzen mit nominalem Potenzialadverb und Aktivverb fehlt ein Subjekt, der Satz ist ein Nicht-Regelsatz. Der Satz bleibt einfach, wenn ein neues Subjekt eingefügt wird, um den potenziellen Täter zu bezeichnen [1a|b]. Wenn ein Subjektinterpotenzial gebildet wird, ist dieser in einem Nicht-Regelsatz, da das Subjekt vor dem prädikativen Verb steht und statt des Bestimmungswortes ay eine Ligatur steht [2a|b] {13-2.2.1}.
|
(4) Andererseits können möglicherweise einige Sätze mit Potenzialadverbien als zusammengesetzt analysiert werden. Dann ist offenbar das Modalwort Prädikat des übergeordneten Teilsatzes; es wird ein Substantiv bzw. Adjektiv (wegen der fehlenden Konjugation kein Verb). Der untergeordnete Satz ist ein Ligatursatz, er ist das Subjekt des übergeordeten Satzes. In {2-4.9} werden ähnliche Gebilde dargestellt.
Im Folgenden wird verglichen, ob ein einfacher [..a] oder zusammengesetzter Satz [..b] mit dem Potenzialadverb vorliegt. In [1b=3a] kann na kumain ang bata ng lugaw als Ligatursatz angesehen werden, der das Subjekt des übergeorneten Teilsatzes mit dem Prädikat gusto ni Nanay bildet [3b]. In diesem Gebilde ist das Objunkt ni Nanay (der Erwäger) ein Attribut zum Substantiv gusto. Ähnlich ist der Vergleichssatz [3c]; jedoch mit dem Unterschied, dass in [3c] ein Verb das Prädikat bildet, während es in [3b] das Modalwort ist. Entsprechend können die Sätze [4-6] analysiert werden. In den zusammengesetzten Sätzen [4b 5b] ist das Modalwort der einzige Inhalt des übergeordneten Satzes.
|
In [7b 8-10] ist es nicht möglich oder in [7c] schwierig, die Sätze als zusammmengesetzt zu analysieren. [7a] hat zwei Interpotenziale, Folge davon sind [7b 7c].
|
Wir möchten zusammenfassen, dass eine Analyse als einfacher Satz stets möglich ist, während dies beim zusammengesetzten Satz in bestimmten Fällen nicht möglich oder zumindest nicht nahe liegend ist.
Modalwörter in der Linguistik → {9A-612 ![]() }
}
Gebilde mit Potenzialadverbien und mit verbundenen Verben →
{13-4.4.3 Θ}
{9A-612 ![]() } Potenzialadverbien (Modalwörter)
} Potenzialadverbien (Modalwörter)
(1) In europäischen Sprachen werden besondere Verben verwendet, um die semantische Funktion einer potenziellen Tätigkeit auszudrücken. Diese Modalverben unterliegen der Verbkonjugation, das zweite Verb steht im Infinitiv.
In unserer Darstellung sind die Modalwörter der filipinischen Sprache Adverbien, die ein Verb ergänzen.
(2) Bei {![]() Lopez 1941 p. 199 ff.} werden die Modalwörter als
'Auxiliary Verbs' bezeichnet.
Lopez 1941 p. 199 ff.} werden die Modalwörter als
'Auxiliary Verbs' bezeichnet.
(3) Bei {![]() Schachter 1972 pp. 261-273} werden die Modalwörter
in 'Chapter 4 Adjectivals' behandelt und
'may be called pseudo-verbs', da sie
'verb-like meanings' (?) haben.
Schachter 1972 pp. 261-273} werden die Modalwörter
in 'Chapter 4 Adjectivals' behandelt und
'may be called pseudo-verbs', da sie
'verb-like meanings' (?) haben.
(4) Bei {![]() Kroeger 1991 p. 205 ff.} werden die Modalwörter als
'Modal verbs' oder 'Modals' bezeichnet:
'These predicates differ from normal verbs in several respects. They are
morphologically defective, accepting neither voice nor aspect marking affixation, and
(with a single exception) allow no variation in subject-selection'. So stehen
also zwei, wenn auch unterschiedliche Verben als zwei Prädikate nebeneinander,
zunächst in zwei Teilsätzen, die durch einen Vorgang 'Clause
Reduction' in einem einfachen Satz vereinigt werden können.
Kroeger 1991 p. 205 ff.} werden die Modalwörter als
'Modal verbs' oder 'Modals' bezeichnet:
'These predicates differ from normal verbs in several respects. They are
morphologically defective, accepting neither voice nor aspect marking affixation, and
(with a single exception) allow no variation in subject-selection'. So stehen
also zwei, wenn auch unterschiedliche Verben als zwei Prädikate nebeneinander,
zunächst in zwei Teilsätzen, die durch einen Vorgang 'Clause
Reduction' in einem einfachen Satz vereinigt werden können.
Bei {![]() Kroeger 1991 p. 207 ff.} werden die
'Modals' in zwei Gruppen unterteilt. Entsprechend unserem
nominalen Verhalten sind die 'experiencer-modals'.
Dazu werden gustọ, ayaw, ibig,
nais gezählt. Die 'sentential operators'
dapat, puwede und maaari entsprechen unserem
nicht-nominalen Verhalten. 'One predicate can occur in
either of these two patterns, namely kailangan. There is a third type of predicate
which must be included in our discussion of modals. This class includes a number of words
which are basically nouns, such as kaya, ugali,
hilig etc. I will refer to words in this class as "modal nouns".
Kroeger 1991 p. 207 ff.} werden die
'Modals' in zwei Gruppen unterteilt. Entsprechend unserem
nominalen Verhalten sind die 'experiencer-modals'.
Dazu werden gustọ, ayaw, ibig,
nais gezählt. Die 'sentential operators'
dapat, puwede und maaari entsprechen unserem
nicht-nominalen Verhalten. 'One predicate can occur in
either of these two patterns, namely kailangan. There is a third type of predicate
which must be included in our discussion of modals. This class includes a number of words
which are basically nouns, such as kaya, ugali,
hilig etc. I will refer to words in this class as "modal nouns".
Ein besonderer Abschnitt bei {![]() Kroeger 1991 p. 169 ff.}
befasst sich mit huwạg, das als 'Auxiliary' von den
'Modal verbs' abgesondert wird.
Kroeger 1991 p. 169 ff.}
befasst sich mit huwạg, das als 'Auxiliary' von den
'Modal verbs' abgesondert wird.
(5) Bei {![]() Romero 2004 vol. 1 p. 109, 112} werden die Formen
gustọ und kailangan als verkürzte Verbformen der Verben
gustuhịn und kailanganin betrachtet (und
ayaw wird ebenfalls mit einem -in Verb verglichen). Damit werden
deren Gebilde zu verbundenen Verben.
Romero 2004 vol. 1 p. 109, 112} werden die Formen
gustọ und kailangan als verkürzte Verbformen der Verben
gustuhịn und kailanganin betrachtet (und
ayaw wird ebenfalls mit einem -in Verb verglichen). Damit werden
deren Gebilde zu verbundenen Verben.
(6) In den Sprachlehrgängen von {![]() Ramos 1985 p. 123}
und {
Ramos 1985 p. 123}
und {![]() Castle 2000 p. 150} werden die Modalwörter als
'pseudo-verbs' betrachtet.
Castle 2000 p. 150} werden die Modalwörter als
'pseudo-verbs' betrachtet.
{9A-801} Gesprächswörter
Wir haben eine Kurzgeschichte bezüglich der Gesprächswörter untersucht {W Piso}. Neben erzählendem Text enthält sie direkte Rede, wobei gebildete Sprecher von ungebildeten unterschieden werden können. Dieser Quelle zeigt folgende Ergebnisse.
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_U_A.html
{10A-101 ![]() } Präpositionen und ihre Phrasen
} Präpositionen und ihre Phrasen
(1) Folgende Darstellung findet sich bei {![]() Bloomfield 1917 § 270} zu
den 'particles' ayon, bukọd, kay
(kaysạ), laban, tungkọl, ukol:
'Certain words form with their attributes phrases that are used as
absolute attributes for the most part loosely joined. The phrase-forming
attributes are local'. Das heißt in unserer Terminologie: Präpositionen bilden
mit ihren Attributen Phrasen, die im Allgemeinen als unabhängige Disjunktphrasen zu
betrachten sind. Die phrasenbildenden Attribute sind Adjunktphrasen.
Bloomfield 1917 § 270} zu
den 'particles' ayon, bukọd, kay
(kaysạ), laban, tungkọl, ukol:
'Certain words form with their attributes phrases that are used as
absolute attributes for the most part loosely joined. The phrase-forming
attributes are local'. Das heißt in unserer Terminologie: Präpositionen bilden
mit ihren Attributen Phrasen, die im Allgemeinen als unabhängige Disjunktphrasen zu
betrachten sind. Die phrasenbildenden Attribute sind Adjunktphrasen.
Bezüglich nasa (§ 212): 'The particle sa has a number of derivates which are transient [verbähnlich] in meaning.'
Bezüglich der Existenzwörter (§ 69): 'To express indefinite quantities when preceeded by certain modifiers. These modifiers are the pretonic particles' may, mayroọn, walạ, … at marami.
(2) Bei {![]() Kroeger 1991 p. 203} werden die Präpositionen als
'lexical prepositions' mit 'dative NP's as
objects' betrachtet.
Kroeger 1991 p. 203} werden die Präpositionen als
'lexical prepositions' mit 'dative NP's as
objects' betrachtet.
{10A-201} Gebrauch von kaysa beim Komparativ
(1) Beim Komparativ der Adjektive {9-2.7 (2)} wird häufig die Präposition kaysạ verwendet (mit Bezug auf das Subjekt, das Prädikat oder einen Teilsatz). Wenn die zu vergleichende Phrase ein Objunkt oder Adjunkt ist, wird kaysạ sa verwendet (ein Objunkt wird dann Adjunkt {3-4 (3)}).
(2) Bezieht sich kaysạ auf Personen mit Artikel si oder sinạ, wird das Adjunkt kaysạ kay oder kaysạ kinạ gebildet. Ähnlich sind Gebilde mit Personal- und Demonstrativpronomen.
Beispielsätze im Wörterbuch kaysạ
(3) Im Wörterbuch {![]() UPD} wird kaysạ als Präposition und Konjunktion
betrachtet, bei {
UPD} wird kaysạ als Präposition und Konjunktion
betrachtet, bei {![]() VCS} als Konjunktion.
VCS} als Konjunktion.
{10A-411 Σ} Satzanalyse: Existenzphrase mit ergänztem Partizip
| Pinakiramdamạn ko kung may maririnịg akọng tinig at kalabọg. {W Angela 3.10} Ich hatte das Gefühl, als ob ich eine Stimme und etwas fallen hören würde. | |||||||||
| pinakiramdaman ko | kung may maririnig akong tinig at kalabog | ||||||||
| {S-0/L/P0} | {S-K/B/GGD} | ||||||||
| pinakiramdaman ko | may maririnig na tinig at kalabog | ako | |||||||
| {P-P=P-D} | {P-P=P-OD(OD P-N)} | {P-T=P-N(HT)} | |||||||
| maririnig na tinig at kalabog | |||||||||
| {P-N(N//DB/H L (N K N))} | |||||||||
| maririnig akong tinig at kalabog | |||||||||
| {GGD(N//PB|HT|(N K N))} | |||||||||
| pinakiramdaman | ko | kung | may | maririnig | akong | tinig | at | kalabog | |
| DB10/N | TW.HT | K | OD | N//DB/H | HT.L | N | K | N | |
| spüren | ich | wenn | hören | ich | Stimme | und | Geräusch | ||
Zusammengesetzter Satz. Der erste Teilsatz (Hauptsatz) ist ein Nicht-Regelsatz. Sein Subjekt ist der zweite Teilsatz (Konjunktionssatz). | |||||||||
Das Prädikat des Teilsatzes ist die Existenzphrase may maririnịg, sein Subjekt ist ako. Das verkürzte Existenzwort may kann nicht als Interklitbezugswort dienen. | |||||||||
Das Subjekt ako wird in die Existenzphrase eingefügt {11-6.5 (4)}. | |||||||||
Das Partizip maririnịg besitzt ein Attribut tinig at kalabọg, das als Subjunkt eine Ligatur besitzt. In einem vergleichbaren Satz mit dem Vollverb marinịg als Prädikat ist tinig das Subjekt: Naririnịg ko ang tinig niyạ. | |||||||||
Die Zukunftsform wird vermutlich verwendet, um eine Art Konjunktiv auszudrücken {6-6.2.3}. | |||||||||
{10A-412 Σ} Satzanalyse: Partizip in Existenzphrase, Wechsel von Objunkt nach Adjunkt
| Marami pa siyạng sinabing halos aking ikinabingị. {W Damaso 4.7} Er hat noch viel erzählt, wovon ich fast taub wurde. | |||||||||
| marami pa siyang sinabing halos aking ikinabingi | |||||||||
| {S-Tb(S-0/L S-L)} | |||||||||
| marami pa siyang sinabi | -ng halos aking ikinabingi | ||||||||
| {S-0/L/GGD} | {S-L/P0} | ||||||||
| marami pang sinabi | siya | halos aking ikinabingi | |||||||
| {P-P=P-OD} | {P-T=P-N(HT)} | {P-P=P-D} | |||||||
| marami pang sinabi | |||||||||
| {P-OD(OD A/HG.L N//DB)} | |||||||||
| marami pa siyang sinabi | |||||||||
| {GGD/OD|(A/HG HT)|N//DB/N} | |||||||||
| marami | pa | siyang | sinabing | halos | aking | ikinabingi | |||
| OD | A/HG | HT.L | N//DB/N.L | A/UG | U//HT/K.L | N//DB/N | |||
| viel | noch | er | sagen | beinahe | ich | taub werden | |||
Zusammengesetzter Satz. Der erste Teilsatz ist unabhängig. Der zweite Teilsatz ist ein Ligatursatz mit Bezugswort sinabi. | |||||||||
Die Existenzphrase lautet maraming sinabi, das Subjekt des Satzes ist siya 'er besitzt viel Gesagtes'. Da das Subjekt ein Personalpronomen ist, wird ein Existenzinterklit gebildet. | |||||||||
sinabi ist ein substantivisch verwendetes Partizip, das durch den Ligatursatz halos aking ikinabingi ergänzt wird. | |||||||||
Das Verb des Ligatursatzes ikabingị | |||||||||
| besitzt Ursachefokus. Sein Subjekt ist sinabi (Bestandteil der Existenzphrase im übergeordenten Satz), das im Ligatursatz nicht wiederholt wird {13-4.6.2}. | |||||||||
Das Verb sollte ein | |||||||||
| Täterobjunkt ikinabingị ko besitzen, es wird hier jedoch durch ein vorangestelltes Adjunkt ersetzt (ikinabingị ist hier ein substantivisch verwendetes Partizip), um ein einsilbiges Personalpronomen am Satzende zu vermeiden {8-4.1 (3)}. | |||||||||
{10A-413 Σ} Satzanalyse: Potenzialadverb in Existenzphrase
| At sa panahọng mahina ang negọsyo, sino ang may gustọng mawalạn ng isạng suki? {W Nanyang 22.12} Und wer möchte in Zeiten, in denen das Geschäft schlecht läuft, einen Stammkunden verlieren? | |||||||||||||
| sa panahong mahina ang negosyo | sino | ang may gustong mawalan ng isang suki | |||||||||||
| {P-K/L(N.L S-L)} | {P-P=P-N} | {P-T=P-OD} | |||||||||||
| mahina ang negosyo | may gustong mawalan ng isang suki | ||||||||||||
| {S-L(P-P=P-U P-T=P-N)} | {P-OD(OD P-N)} | ||||||||||||
| gustong mawalan ng isang suki | |||||||||||||
| {P-N(AH/N N//DT P-W)} | |||||||||||||
| sa | pan. | mahina | ang | negosyo | sino | ang | may | gustong | mawalan | ng | isang | suki | |
| TK | N.L | U | TT | N/Es | HN | TT | OD | AH.L | N//DT/W | TW | UB.L | N | |
| Zeit | schwach | Geschäft | wer | Wunsch | verlieren | eins | Kunde | ||||||
sa panahon ist unabhängige Adjunkphrase. Das Substantiv panahon wird durch den unverkürzten Ligatursatz mahina ang negosyo ergänzt. | |||||||||||||
Wegen der Bildung einer Existenzphrase kann der Erwäger erfragt werden {10-4.1 (4)}. | |||||||||||||
Das substantivisch verwendete | |||||||||||||
| Partizip nawalan ist das Attribut der Existenzphrase. Es wird ergänzt durch das Potentialadverb gusto und das Objunkt ng isang suki. | |||||||||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_O_A.html
{11A-621 Σ} Satzanalyse: Spaltung der Nominalphrase, die das Subjekt in einem Existenzsatz bildet
| [1] Walạ kamịng permanẹnteng tirahan ni Inạ. {W Material Girl 3.3} Mutter und ich haben keine feste Wohnung. | |||||
| wala kaming permanenteng tirahan ni Ina | |||||
| {S-1/GGD} | |||||
| walang permanenteng tirahan | kami ni Ina | ||||
| {P-P=P-OD} | {P-T=P-N(HT P-W)} | ||||
| wala kaming permanenteng tirahan | ni Ina | ||||
| {GGD/OD|HT|P-N} | {P-W} | ||||
| wala | kaming | permanenteng | tirahan | ni | ina |
| OD | HT.L | U/Es.L | N | TW.Y/Ta | N |
| kein | wir | ständig | Wohnung | Mutter | |
Das Subjekt kamị bildet einen Existenzinterklit und wird dabei an die frühestmögliche Position gesetzt. Da es sein Objunkt ni Inạ nicht mitnehmen kann, werden Subjekt und damit die es bildende Nominalphrase gespalten. Der zweite Teil der Nominalphrase folgt erst nach vollständigem Abschluss des Prädikats. | |||||
| |||||||
{11A-651 Σ} Satzanalyse: Existenzinterklit
| [1] Sa kabutihang-palad, may nasalubong silạng kalesang walạng pasahero. {W Nanyang 13.12} Glücklicherweise hatten sie eine unterwegs begegnete Kutsche ohne Fahrgäste. | |||||||
| sa kabutihang-palad | may nasalubong na kalesa | sila | |||||
| {P-K/L} | {P-P=P-OD(OD P-N(U//DB L N))} | {P-T=P-N} | |||||
| may | nasalubong silang kalesa | ||||||
| {GGD/U//DB|HT|N} | |||||||
| kalesang walang pasahero | |||||||
| {P-N(N P-L=P-OD)} | |||||||
| walang pasahero | |||||||
| {P-OD(OD N)} | |||||||
| sa | kabutihang-palad | may | nasalubong | silang | kalesang | walang | pasahero |
| TK | N | OD | U//DB/N | HT.L | N.L | OD.L | N |
| "gutes Schicksal" | begegnen | sie | Kutsche | ohne | Fahrgäste | ||
sa kabutihang-palad ist unabhängige Adjunktphrase. | |||||||
sila ist das Subjekt des Satzes, der eine Existenzphrase als Prädikat hat [2]. | |||||||
Die Kurzform may des Existenzwortes kann keinen Interklit bilden. | |||||||
Das Partizip nasalubong ist Attribut zu kalesa (nicht umgekehrt [3a|b]) {5A-201 Θ [4]}. | |||||||
Das Partizip nasalubong dient als Interklitbezugswort. | |||||||
walang pasahero ist Attribut zu kalesa. | |||||||
| |||||||||
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_taga_A.html
{13A-101 Σ} Satzanalyse: Zusammengesetzter Satz
|
| [1a] Kasabay sa muling … [1b] ay hindi siya … | [5] ngunit tanging … | |||||||
| [2] na sundan … | ||||||||
| [3] na ayon pa … | ||||||||
| [4] na kung saan … | ||||||||
| [1a+1b] {S-0/L} | [5] {S-K/L} | |||||||
| [1a] {P-A/L} | [1b] {GGT/A|HT|D} | |||||||
| [2] {S-L} | ||||||||
| [3] {S-L} | ||||||||
| [4] {S-K?S-L} | ||||||||
[1a+1b] bilden einen unabhängigen Teilsatz, dem der Teilsatz [5] nebengeordnet ist. | ||||||||
Die Teilsätze [2-4] sind dem Teilsatz [1a+1b] kaskadenartig untergeordnet. | ||||||||
| [1a] Kasabạy sa mulịng pagkaakit
niyạ sa nakabibighaning mga kulay nito Gleichzeitig mit seiner (Samadhi) wiederkehrenden Aufmerksamkeit für dessen (Regenbogen) faszinierende Farben | |||||||||
| kasabay sa muling pagkaakit niya sa nakabibighaning mga kulay nito | |||||||||
| {P-0=P-A(A P-K)} | |||||||||
| sa muling pagkaakit niya sa nakabibighaning mga kulay nito | |||||||||
| {P-K=P-N(U.L N P-W P-K} | |||||||||
| kasabay | sa | muling | pagkaakit | niya | sa | nakabibighaning | mga | kulay | nito |
| A | TK | U.L | N | TW.HT | TK | U//DT/K.L | Y/M | N | TW.HP |
| gleichzeitig | wieder | Aufm. | er | faszinierend | Farbe | dies | |||
[1a] ist eine unabhängige Adverbphrase mit Kernwort kasabạy, die dem Teilsatz [1a+1b] angehört. Das Adverb kasabạy wird durch eine Adjunktphrase ergänzt. | |||||||||
Das Kernwort pagkaakit der Adjunktphrase besitzt drei Attribute, vorangestelltes Adjektiv mulị mit Ligatur, nachgestelltes possessivisches Objunkt niyạ und eine Adjunktphrase mit Kernwort mga kulay (eingeleitet mit sa). | |||||||||
| [1b] ay hindị siyạ nagdalawạng
isip machte er sich keine zwei Gedanken | |||||
| ay hindi nagdalawang isip | siya | ||||
| {P-P=P-D(A DT)} | {P-T=P-N(HT)} | ||||
| ay | hindi siya nagdalawang isip | ||||
| {GGT/A|HT|D} | |||||
| ay | hindi | siya | nagdalawang | isip | |
| TP | A | HT | DT00/N/mag+(dalawang isip) | ||
| nicht | er | zwei | denken | ||
Nach der langen Adverbphrase [1a] steht vor dem Bezugswort des Subjektinterklit das Bestimmungswort des Prädikats ay. | |||||
dalawạng isip wird als ein Begriff betrachtet, aus dem mit dem Präfix mag- ein Verb gebildet wird. {7A-141 (2)} | |||||
| [2] na sundạn at hanapin agạd ang
dulo ng bahạghari zu folgen und sofort das Ende des Regenbogens zu suchen | ||||||||
| na sundan | at | hanapin agad ang dulo ng bahaghari | ||||||
| {S-L/P0} | C | {S-L/PT} | ||||||
| na | sundan | at | hanapin | agad | ang | dulo | ng | bahaghari |
| L | DB10/W | K | DB10/W | A | TT | N | TW | N/Tb |
| folgen | und | suchen | sofort | Ende | Regenbogen | |||
Teilsatz [2] besteht aus zwei Teilen, die durch die Konjunktion at verbunden sind. Beide Verben der Prädikate stehen im Infinitiv, sie sind als untergeordnete Verben zu nagdalawạng isip zu betrachten. | ||||||||
Der erste Teil ist subjektlos (das Subjekt des zweiten Teiles ang dulo passt semantisch nicht zu sundan). | ||||||||
Das Adverb agad gehört zur kanina Gruppe und wird ohne Ligatur angeschlossen {9-5.3}. | ||||||||
| [3] na ayon pa sa kuwẹnto ng
kanyạng lolo ay lugạr das immer noch entsprechend der Geschichte seines Großvaters der Ort war | |||||||||
| na | ayon pa sa kuwento ng kanyang lolo | ay lugar | |||||||
| {P-0=P-O(O A/HG P-K)} | {P-P=P-N} | ||||||||
| na | ayon | pa | sa | kuwento | ng | kanyang | lolo | ay | lugar |
| L | O | A/HG | TK | N/Es | TW | U//HT/K | N/Es | TP | N/Es |
| gemäß | noch | Geschichte | er | Großvater | Ort | ||||
Der Ligatursatz ist verkürzt, sein Kern lautet na ay lugar. Das Subjekt ang dulo entfällt, da es das Bezugswort des Ligatursatzes ist, das am Ende des vorherigen Teilsatzes steht. | |||||||||
Die Präpositionalphrase ist unabhängig. | |||||||||
| [4] na kung saạn maaaring
matagpuạn ang isạng bangạ ng kayamanan wo man einen großen Topf Reichtum finden kann | |||||||||
| kung saan | maaaring matagpuan | ang isang banga ng kayamanan | |||||||
| {P-K/L} | {P-P=P-D(AH DB)} | {P-T=P-N(U.L N P-W)} | |||||||
| na | kung | saan | maaaring | matagpuan | ang | isang | banga | ng | kayamanan |
| L | K | HN | AH.L | DB10/W | TT | U.L | N | TW | N |
| wenn | dies (wo) | kann | finden | eins | Tonkrug | Reichtum | |||
Vor die Konjunktion kung wird die Ligatur na gesetzt, um die Beziehung zum vorhergehenden lugạr deutlicher zu machen. | |||||||||
| [5] ngunit tanging ang may mabubuting kaloobạn lamang ang maaaring makakuha nito aber um den zu bekommen, braucht man viel Willensstärke wörtlich: aber besonders der, der gute Willensstärken hat, kann den [Topf des Reichtums] bekommen. |
| Satzanalyse siehe {2A-332 Σ}. |
{13A-211} Statistische Untersuchung der Reihenfolge von Prädikat und Subjekt
In einer Studie haben wir die Reihenfolge von Prädikat und Subjekt in filipinischen Texten der Schriftsprache untersucht (etwa 1000 Teilsätze {W Stat P-S}). Die betrachteten Texte werden in drei Gruppen eingeteilt, die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtzahl der Sätze, die Phrasen als Prädikat und Subjekt besitzen.
| Textgruppe | Kanonisch (PS) | Nichtkanonisch (SYP) | ||
| Erzähltexte | 95 % - 100 % | 0 % - 5 % {*} | ||
| Akademisch | 49 % - 96 % | 4 % - 51 % | ||
| Schulorientiert | 20 % - 76 % | 24 % - 80 % | ||
{*} In einem besonderen Teil eines Textes 18 % {W Daluyong Didang}.
Nicht nur die Unterschiede zwischen den drei Gruppen, sondern insbesondere die großen Unterschiede innerhalb der Gruppen sind auffallend. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass diese Zahlen weniger durch grammatikalische Sachzwänge beeinflusst werden, vielmehr hat der Autor eine sehr weit gehende Wahlfreiheit.
Im westlichen Stil herrscht die nichtkanonische Reihenfolge vor (mehr als 25 % der Sätze) {13-5.1}. Dieser Stil findet sich vorwiegend in akademischen Texten und in Schulbüchern.
{13A-401 ![]() } Teilsätze in Filipino und in
europäischen Sprachen
} Teilsätze in Filipino und in
europäischen Sprachen
In der filipinischen Sprache wird unterschieden, ob bei einem untergeordneten Satz eine besondere semantische Beziehung zum übergeordneten Satz besteht oder nicht. Konjunktionssätze werden gebildet, um eine solche Beziehung anzuzeigen. Fehlt diese, wird ein Ligatursatz gebildet. Eine Ausnahme ist die Konjunktion kung, wenn sie mit einem Fragewort verwendet wird {8-4.3.1}.
In europäischen Sprachen gibt es Konjunktionssätze und Relativsätze. Relativsätze entsprechen filipinischen Ligatursätzen mit Bezugswort. Fehlt ein solches, wird in den europäischen Sprachen ein Konjunktionssatz gebildet, notfalls mit einer inhaltsarmen Konjunktion wie 'dass'. Es gibt also Konjunktionssätze mit und ohne besondere semantische Beziehung zum übergeordneten Satz.
{13A-4311 Σ} Satzanalyse: Ligatursätze
| Umalịs akọ ng Kinaway na bitbịt ang ilạng damịt at kauntịng pera na pabaon ng Lola na talagạ namạng ayaw akọng payagang umalịs. {W Damaso 4.3} Ich verließ Kinaway und trug einige Kleidungsstücke und etwas Geld, das Großmutter für die Reise mitgegeben hatte, die wirklich nicht zulassen wollte, dass ich weggehe. | |||||
| [1] Umalis ako ng K. | |||||
| {S-0/L} | |||||
| [2] na bitbit ang … pera | |||||
| {S-L} | |||||
| [3] na pabaon ng Lola | |||||
| {S-L} | |||||
| [4] na talagang ayaw akong payagang umalis | |||||
| {S-L} | |||||
Dem übergeordneten Teilsatz [1] sind die Ligatursätze [2-4] kaskadenförmig untergeordnet. | |||||
In den Ligatursätzen [3 4] wird die na Form der Ligatur gewählt, obwohl die -ng Form phonologisch möglich wäre. | |||||
| [1 2] Umalịs akọ ng Kinaway na bitbịt ang ilạng damịt at kauntịng pera. Ich verließ Kinaway und trug einige Kleidungsstücke und etwas Geld. | ||||||||||||
| [1] umalis ako ng Kinaway | [2] na bitbit ang ilang damit at kaunting pera | |||||||||||
| {S-0/L/PTP} | {S-L/PT} | |||||||||||
| umalis ng Kinaway | ako | bitbit | ang ilang damit at kaunting pera | |||||||||
| {P-P=P-D} | {P-T=P-N} | {P-P=P-D} | {P-T=P-N} | |||||||||
| umalis | ako | ng | Kinaway | na | bitbit | ang | ilang | damit | at | kaunting | pera | |
| DT10/N | HT | TW | N/Ta | L | DB10//X | TT | U.L | N | K | U.L | N/Es | |
| weggehen | ich | Ort | baumeln lassen | einige | Kleidung | und | wenig | Geld | ||||
Der Teilsatz [2] ist ein verkürzter Regelsatz. | ||||||||||||
In diesem Ligatursatz fehlt das Objunkt ko zu bitbit; es ist nicht erforderlich, da ako im übergeordneten Satz das Bezugswort für den Ligatursatz ist. Dass ako ein ANG-Pronomen ist und ein NG-Pronomen fehlt, ist unerheblich {13-4.6.3}. | ||||||||||||
bitbit ist der Wortstamm anstelle einer Zeitform (binitbit ko ang damit) {6-6.3}. | ||||||||||||
| [3 4] Na pabaon ng Lola na talagạ namạng ayaw akọng payagang umalịs. Das Großmutter für die Reise mitgegeben hatte, die wirklich nicht zulassen wollte, dass ich weggehe. | |||||||||||
| [3] na pabaon ng Lola | [4] na talaga namang ayaw akong payagang umalis | ||||||||||
| {S-L/P0} | {L-L/GGT} | ||||||||||
| pabaon ng Lola | talaga namang | ayaw payagang umalis | ako | ||||||||
| {P-P=P-N(N P-W)} | {P-0=P-A} | {P-P=P-D(AH DB.L P-D)} | {P-S=P-N} | ||||||||
| ayaw akong payagang umalis | |||||||||||
| {GGT/AH|HT|DB} | |||||||||||
| na | pabaon | ng | Lola | na | talaga | namang | ayaw | akong | payagang | umalis | |
| L | N | TW | N | L | A//U | A/HG.L | AH | HT.L | DB/W.L | DT/W | |
| Proviant | Großmutter | wirklich | tatsächlich | nicht mögen | ich | zulassen | weggehen | ||||
Neben der Ligatur besitzt der Ligatursatz [3] nur die Nominalphrase baon ng Lola als Prädikat. Das Subjekt ang pera wird nicht wiederholt, 'Das Geld ist der Proviant von der Großmutter'. | |||||||||||
Wegen des Subjektinterklits ist Teilsatz [4] kein Regelsatz. | |||||||||||
In Teilsatz [4] passt das fehlende niya (Erwäger-Objunkt zum Potenzialdverb ayaw mit nominalem Verhalten) zum Bezugswort Lola im übergeordenten Teilsatz [3]. | |||||||||||
Wegen des nominalen Verhaltens des | |||||||||||
| Potenzialadverbs ayaw kann der potenzielle Täter ako als Subjekt dargestellt werden. | |||||||||||
payagang umalis sind | |||||||||||
| verbundene Verben. Der potenzielle Täter ako kann sich auf beide Verben beziehen. Somit wird ein Konflikt in der Argumentstruktur vermieden, der Teilsatz [4] ist ein einfacher Satz {13-4.4.2}. | |||||||||||
{13A-4321 Σ} Satzanalyse: Teilsatz als Subjekt
| Bakit ba ipinasiyạ ng 1935 Kumbensiyong Konstitusyonal na isạng wikang batay sa isạ sa mga katutubong wika ng Filipinas ang ating magịng wikang pambansạ? {W Almario 2007 3.1} Warum hat die Verfassungsgebende Versammlung von 1935 beschlossen, dass eine Sprache aus den einheimischen Sprachen der Philippinen als unsere zukünftige Landessprache gewählt wird? | ||
| {S-Tb/PT(P-P=S-0 P-T=S-L} | ||
| [1] bakit ba ipinasiya ng 1935 KK | [2] na isang wikang batay sa … | |
| {P-P=S-0} | {P-T=S-L} | |
Im zusammengesetzten Satz ist der Teilsatz [1] übergeordnet. Er besitzt kein Subjekt, sein Subjekt ist der Teilsatz [2]. | ||
| [1] Bakit ba ipinasiya ng 1935 Kumbensiyong Konstitusyonal | ||||
| {S-0/L/P0} | ||||
| bakit ba | ipinasiya ng 1935 KK | |||
| {P-0} | {P-P=P-D(DB10 P-W)} | |||
| bakit | ba | ipinasiya | ng | 1935 KK |
| AN | AN/HG | DB10/N | N/Ta | |
| warum | beschließen | TW | Verfass.Versammlung | |
Teilsatz [1] ist ein Fragesatz. Erfragt wird ein Disjunkt. | ||||
| [2] na isang wikang batay sa isa sa mga katutubong wika ng Filipinas ang ating maging wikang pambansa? | |||||||||||||
| {S-L/PT} | |||||||||||||
| na | isang wikang batay sa isa sa mga … wika | ang ating maging wikang pambansa | |||||||||||
| {P-P=P-N(UB.L N.L P-O)} | {P-T=P-N(U//HT/K.L U//DT N.L U)} | ||||||||||||
| batay sa isa sa mga … wika | |||||||||||||
| {P-L=P-O(O P-K=P-N)} | |||||||||||||
| isa sa mga … wika | |||||||||||||
| {P-N(N//UB P-K)} | |||||||||||||
| na | isang | wikang | batay | sa | isa | sa | mga | wika | ang | ating | maging | wikang | pambansa |
| L | UB.L | N.L | O | TK | N//UB | TK | Y/M | N | TT | U//HT/K.L | U//DT | N.L | U |
| eins | Sprache | gemäß | eins | Sprache | wir | werden | Sprache | Landes- | |||||
Der Ligatursatz ist ein Regelsatz. Prädikat und Subjekt sind Nominalphrasen in kanonischer Reihenfolge. | |||||||||||||
Das Substantiv wika hat zwei Attribute. Vorangestellt ist Adjektiv isang und nachgestellt die Präpositionalphrase batay sa … Letztere ist wegen der voranstehenden Ligatur ein echtes Attribut {10-2 (2)}. | |||||||||||||
Das Adjunkt sa mga … wika ist ein Attribut zu dem als Substantiv gebrauchtem Numerale isa. {8-8.2}. | |||||||||||||
{13A-4322 Σ} Satzanalyse: Teilsatz als Prädikat
| [1] Ang tangi mo na lang nagawạ upang alisịn ang tensiyon ay paglaruạn ang tungkị ng aking ilong. {W Madaling Araw 3.1} Einzig konntest du tun, um den Stress loszuwerden, mit meiner Nasenspitze spielen. | |||||||||||||
| [a] ang tangi mo na lang nagawa | [c] ay paglaruan ang tungki ng aking ilong. | ||||||||||||
| {S-Tb/TYP(P-T P-P=S-L} | |||||||||||||
| [b] upang … | |||||||||||||
| {S-K/B} | |||||||||||||
| Ang tangi mo na lang nagawa | ay paglaruan ang tungki ng aking ilong. | ||||||||||||
| {P-T=P-D(GGW)} | {P-P=S-0} | ||||||||||||
| tangi mo na lang nagawa | paglaruan ang tungki ng aking ilong. | ||||||||||||
| {GGW/A|HT|D} | {S-0/PT} | ||||||||||||
| paglaruan | ang tungki ng aking ilong. | ||||||||||||
| {P-P=P-D} | {P-T=P-N} | ||||||||||||
| ang | tangi | mo | na | lang | nagawa | ay | paglaruan | ang | tungki | ng | aking | ilong | |
| TT | A//U | TW.HP | A | A | DB10/N | TP | DB10/W | TT | N | TW | U//HT/A.L | N | |
| einzig | du | schon | bloß | machen | spielen | Spitze | ich | Nase | |||||
Dieser zusammengesetzte Satz besteht aus drei Teilsätzen. Der Teilsatz [1b] ist deutlich untergeordnet und wird im Folgenden nicht weiter betrachtet. | |||||||||||||
Der Satz [1a+1c] besitzt zwei Subjekte, ist also zusammengesetzt. | |||||||||||||
Das Prädikat des zusammengesetzten Satzes ist der zweite Teilsatz [1c]. Das Subjekt ist der erste Teilsatz [1a], der selbst kein Prädikat besitzt {*}. Der zusammengesetzte Satz ist in nichtkanonischer Reihenfolge; am Anfang des Prädikat-Teilsatzes steht das Bestimmungswort ay. {*} Wir bezeichnen das Gebilde [1a] als "Teilsatz", obwohl es nur ein Subjekt ohne Prädikat ist. [1a] kann zu einem einfachen Satz erweitert werden {13-1.1 (2)}. | |||||||||||||
Die Verbphrase tangi mo na lang nagawa ist ein Objunktinterklit mit mo als Interklitkurzwort und tangi als Bezugswort. | |||||||||||||
Wegen des vorangehenden Teilsatzes steht vor dem Prädikat das Bestimmungswort ay. | |||||||||||||
Der Teilsatz [1c] ist ein nicht verkürzter Regelsatz. Das Verb hat globale Wirkung, und ein Subjekt ist vorhanden. | |||||||||||||
| ||||||||
| [4] Paglaruạn ang tungkị ng aking ilong ang tangi mo na lang nagawạ. | ||
| Paglaruan ang tungki ng aking ilong ang tangi mo na lang nagawa | ||
| {S-Tb(P-P=S-0 P-T)} | ||
| Paglaruan ang tungki ng aking ilong | ang tangi mo na lang nagawa | |
| {P-P=S-0/PT} | {P-T=P-D} | |
Der zusammengesetzte Satz steht in kanonischer Reihenfolge. | ||
{13A-441 Θ} Ligaturgebilde
(1) Ligaturgebilde in einfachen Sätzen sind Subjuktphrasen {5-4 Θ}. Alle Gebilde, die eine Subjunktphrase als Attribut darstellen, können formal als Ligatursätze betrachtet werden. Im Beispiel [1] kann das Attribut pulạ zu einem einfachen Satz erweitert werden [1c]. Dann können die beiden einfachen Sätze [1b 1c] in einem zusammengestzten Satz vereint werden, was zu Satz [1a] führt.
In [2a] ist das Attribut nilaga ein Partizip. In dem einfachen Satz [2b], wird es zum Vollverb. Als Vollverb bildet es das Prädikat des Ligatursatzes in [2c].
| ||||||||||||||||||
Wegen der Gleichartigkeit von einem Attribut zu einem Nomen und einem Ligatursatz können alle Phrasen, die das Prädikat eines Ligatursatzes mit Nomen als Bezugswort bilden, ein Attribut zu diesem Bezugswort werden, und umgekehrt.
(2) Die filipinische Sprache ermöglicht diesen einfachen Übergang,
{13A-451 Σ} Satzanalyse: Teilsätze mit gemeinsamem Subjekt
| Ambisyosa .. yạn ang salitạng karaniwan ay bukambibịg ng mga taong nakapaligid sa akin. {W Material Girl 3.1} Ehrgeizig, das ist das ständige Wort, das die Redensart der Leute um mich herum ist. | |||||||||||||
| ambisyosa | || | yan ang salitang karaniwan ay buk. ng mga taong nak. sa akin | |||||||||||
| || | {S-Tb(S-0/L/PT S-T/TYP)} | ||||||||||||
| yan ang salitang karaniwan | |||||||||||||
| {S-0/L/PT} | |||||||||||||
| yan | ang salitang karaniwan | ||||||||||||
| {P-P=P-N} | {P-T=P-N} | ||||||||||||
| ang salitang karaniwan ay buk. ng mga taong nak. sa akin. | |||||||||||||
| {S-T/TYP} | |||||||||||||
| ang salitang karaniwan | ay buk. ng mga taong nak. sa akin. | ||||||||||||
| {P-T=P-N} | {P-P=P-N} | ||||||||||||
| ambiyosa | yan | ang | salitang | karaniwan | ay | buk. | ng | mga | taong | nak. | sa | akin | |
| U/Es | HP/2 | TT | N.L | U | TP | N | TW | Y/M | N.L | U | TK | HT/K | |
| ehrgeizig | dies | Wort | gebräuchlich | Red. | Leute | umr. | ich | ||||||
Subjekt des ersten und auch des zweiten Teilsatzes ist die Phrase ang salitang karaniwan. In kanonischer Reihenfolge ist der erste Teilsatz, während der zweite nichtkanonisch ist (Teilsätze mit gemeinsamem Subjekt). | |||||||||||||
{13A-452 Σ} Satzanalyse: Konjunktion kasi und Teilsätze mit gemeinsamem Subjekt
| Palatanọng kasị si Joe at si Nimfa namạ'y naghahanap nang makakausap ukol sa kanyạng mga sinusulat. {W Suyuan 5.5} Weil Joe und Nimfa wirklich neugierig waren, suchen sie das Gespräch über das, was sie schreibt. | ||||||||||||
| palatanong kasi si Joe at si Nimfa nama'y naghahanap nang makakausap ukol … | ||||||||||||
| {S-Tb(S-T/B/PT S-0/L/TYP)} | ||||||||||||
| Palatanong kasi si Joe at si Nimfa naman | ||||||||||||
| {S-T/B/PT} | ||||||||||||
| Palatanong | kasi | si Joe at si Nimfa naman | ||||||||||
| {P-P=P-U} | K | {P-T=P-N} | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| si Joe at si Nimfa nama'y naghahanap nang makakausap ukol … | ||||||||||||
| {S-0/L/TYP} | ||||||||||||
| si Joe at si Nimfa naman | ay naghahanap nang makakausap ukol … | |||||||||||
| {P-T=P-N} | {P-P=P-D(DT A/HG.L P-L)} | |||||||||||
| palatanong | kasi | si | Joe | at | si | Nimfa | nama'y | naghahanap | nang | makakausap | ukol | |
| U | K | Y/Ta | N/Ta | K | Y/Ta | N/Ta | A.TP | DT00/K | A.L | DT01/H | O | |
| neugierig | weil | Joe | und | Nimfa | wirklich | suchen | schon | reden | wegen | |||
Die Konjunktion kasi wird in der Regel am Satzanfang vermieden und erscheint hier wie ein enklitisches Kurzwort. | ||||||||||||
Die Phrase si Joe at si Nimfa naman ist gleichzeitig Subjekt des vorangehenden untergeordneten Konjunktionssatzes und des folgenden unabhängigen Teilsatzes. Dies ist möglich, da der erste Teilsatz in kanonischer und der zweite in nichtkanonischer Rehenfolge steht (Teilsätze mit gemeinsamem Subjekt). | ||||||||||||
Das enklitische Kurzwort naman gehört zum gemeinsamen Subjekt. | ||||||||||||
naghahanap na makakausap sind verbundene Verben. nang |na+ng| ist enklitisches Adverb mit Ligatur {5-3.4 (2)}. Das untergeordnete Verb steht im Futur. | ||||||||||||
{13A-511} Beispiele für westlichen Stil
|
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_usap_A.html
(1) Das Schlüsselsystem ordnet Sätzen, Teilsätzen, Phrasen und Wörtern eine Art Steckbrief mit deren wichtigen Eigenschaften zu. Diesen Steckbrief nennen wir Schlüssel. Am Beginn des Schlüssel steht der Klassenname des Bestandteiles (Beispiele: {S-} für 'Teilsatz' oder {D} für 'Verb'). Dem Klassennamen werden weitere Buchstaben und Zahlen hinzugefügt, um Unterklassen zu kennzeichnen (Beispiel: {DB} sind 'Verben der Unterklasse Passiv'). Durch Schrägstriche getrennt, werden dem Klassennamen die wesentlichen syntaktischen, phonologischen, morphologischen, semantischen und lexikalischen Eigenschaften angehängt (Beispiel pumupuntạ {DT01/K/fg|fn/um+punta/Es} ist ein 'Verb der Unterklasse Aktiv und der Unter-Unterklasse Kein Objunkt - ein Adjunkt' mit den Eigenschaften 'Präsens, Täterfokus, lokative Funktion', dem morphologischen Aufbau |um+punta|, und der Stamm ist ein spanisches Lehnwort.
Die Abkürzungen für die Schlüsselemente leiten wir von den filipinischen Fachausdrücken ab.
(2) Unsere Arbeit ist in Kapitel (Beispiel 4 Adjunktphrasen) gegliedert, die Abschnitte (Beispiel 4-3.2 SA-NG Phrasen) enthalten. Innerhalb der Abschnitte gibt es Absätze, die teilweise mit Zahlen in runden Klammern gekennzeichnet sind (Beispiel (3)). Beispielsätze werden mit Nummern in eckigen Klammern bezeichnet (Beispiel [5]).
Bei der deutschen Übersetzung der Beispielsätze haben wir mehr Wert gelegt auf eine möglichst wörtliche Übersetzung, statt einen "guten" deutschen Stil zu wählen.
• 14A-2 Allgemeines |
D N U A H T .. P- S- |
| {..-..} | Verweis (Link) | |
| {..A-..} | Verweis zum Anhang (pangabit) | |
| {..A-.. Σ} | Verweis zu Satzanalyse im Anhang (Σ Sigma für Analyse) | |
| {..A-.. Θ} | Verweis zu theoretischer Betrachtung im Anhang (Θ Theta für Theorie) | |
| {..A-.. | Verweis zu Betrachtung bei anderen linguistischen Autoren oder zu sprachvergleichender Anmerkung im Anhang (Piktogramm Buch) | |
| {W …} | Verweis zu Arbeitstext in unserer Werkstatt (gawaan) | |
 | Zitat aus privater Internetunterhaltung | |
| { | Verweis zu Quelle im Quellenverzeichnis |
| !! | Unregelmäßig | Gr | Grammatischer Fachausdruck |
| → | Verweis (linkes Wort wird bei rechtem behandelt) | ⇒ | Ersatz (linkes Wort wird durch rechtes ersetzt |
| ✉ | Schriftsprache | [ʔʌ'bʌ] | Phonetische Transkription (IPA) |
| ☺ | Umgangssprache | /ʔʌ'bʌ/ | Phonemische Transkription (IPA) |
| ≈ | Synonym | <aba> | Orthografische Darstellung |
| ∼ | nahezu Synonym | |a+ba| | Morphologischer Aufbau |
| ⊥ | Gegensatz | |globo| | Originalwort in Fremdsprache |
| ≠ | Abweichende Bedeutung | <-kaka-> | Silbendoppelung |
| ➤ | Verweis zu gleichwertigen filipinischem Wort bei Lehnwörtern. Bei nur teilweiser Übereinsimmung wird es in runde Klammern (...) gesetzt. | ||
| ➣ | Verweis zu Lehn- oder Fremdwort, das häufiger als das filipinische Wort gebraucht wird bzw. Verweis zu filipinischem Wort, das von dem Lehn- oder Fremdwort weitgehend verdrängt worden ist. | ||
| {…} | Schlüssel. |
| {X(…)} | Inhalt von X; Teile des Inhalts von X. |
| {X: Y)} | X wird verwendet in Y oder in Zusammenhang mit Y. |
| / | Trennung von Gruppen innerhalb eines Schlüssels. |
| . (Punkt) | Zu einem Wort verschmolzen (Beispiel {MC.PP}). |
| + | Trenner zwischen ursprünglichen Morphemen (Sprachsilben) eines Wortes. Beispiel: pangibabawan {VP10/pang+i+babaw+an} |
| . (Punkt) | Trenner zwischen Sprechsilben. Beispiel: pangibabawan {VP10/pa.ngi.ba.ba.wan} |
| - | Affixe (Beispiel ma-, -um-, -an, ka--an) |
| /& | Silbendoppelung, wobei die gedoppelte Silbe betont wird |
| /& | Silbendoppelung, wobei die gedoppelte Silbe unbetont ist |
| /&& | Doppelung (der ersten beiden Silben) des Stammworters |
| X | Wortstamm (radix), nicht als selbständiges Wort verwendet |
| .., X/... | Wort .. gehört zu Wortstamm ... . |
| x | Affix (Präfix, Infix, Suffix) |
| /Tb | Zusammengesetztes Wort (tambalan) |
| /CN, /Ch | Wortstamm ist chinesischen Ursprungs |
| /En | Wortstamm ist englischen Ursprungs |
| /US | Wortstamm ist US-amerikanischen Ursprungs |
| /ES, /Es | Wortstamm ist spanischen Ursprungs (España) |
| /Esm | Filipinisches Wort mit spanischer Nachsilbe (España ...) |
| /MY, /My | Wortstamm ist malaiischen Ursprungs (Malay) |
| ♦ | Wort wird selten verwendet (Wort kommt im Werkstatt-Korpus {1-1.2 (3)} nicht vor). |
| |7| | Häufigkeit → Filipinisch - deutsches Wörterbuch: Häufigkeit. |
| ~ ~~ | (Tilde) = anstelle des Wortes (der Wörter). |
| ✦ ✧ | Begriff wird im Teil Kabihasnang Pilipino = Philippinische Kultur beschrieben. |
| F | Neu geprägtes filipinisches Wort. |
| <F | Bedeutungserweiterung eines filipinischen Wortes. |
| D | Verb im Allgemeinen (auch Partizip) oder Verb in Satz ohne Subjekt (pandiwa) | |
| DT | Aktivverb (pandiwang tahasan) | |
| DB | Passivverb (pandiwang balintiyak) | |
| DT?DB | Verb im Übergangsbereich zwischen Aktiv und Passiv | |
| ..00, ..01, ..10, ..11, ..20 | Zahl und Art der Argumente des Verbs {6A-202}. | |
| ..+01, ..+10 | Verb, das ein zusätzliches Adjunkt bzw. Objunkt zur Bezeichnung des ausführenden Täters besitzt. Das zusätzliche Argument wird kursiv geschrieben {7-4.1 (2)}. | |
| /N | Präteritum (pangnagdaan) | |
| /K | Präsens (kasalukuyan) | |
| /H | Futur (panghinaharap) | |
| /W | Infinitiv (pawatas) | |
| DT//X, DB//X | Wortstamm an Stelle von Zeitform | |
| DP | Katatapos | |
| /f0 | Verb ohne Fokus | |
| /fa | Erwägerfokus (tagaakala) | |
| /fg | Täterfokus, auch ausführender und potenzieller Täter (tagaganap, tagagawa) | |
| /fh | Veranlasserfokus (tagahimok) | |
| /fl | Fokus des Vergleichs oder Austausches (pagpalit) | |
| /fm | Werkzeugfokus (kagamitan) | |
| /fn | Lokativer Fokus (lunan) | |
| /fn | Lokativer Fokus im übertragenen Sinn {6-3.4.6 (3)} | |
| /fp | Empfängerfokus (tagatanggap) | |
| /fr | Reziproker Fokus (resiprokal) | |
| /fs | Ursachefokus (sanhi) | |
| /ft | Tatobjektfokus (tagatiis) | |
| /fy | Zustandsfokus (panlagay) | |
| /fK | K-Fokus (pandako) {6-3.1 (2b)} | |
| /f..(S-..) | Teilsatz als Argument {6-2.5} | |
| /ft|fg|fp | Werden mehrere durch senkrechte Striche | getrennte f-Schlüssel angegeben, so bezieht sich der erste auf den Fokus, die weiteren auf die Funktion von Objunkt(en) und Adjunkt {6-3.1 (2)}. | |
| U//D A//D N//D | Partizip als Adjektiv, Adverb, Substantiv | |
| N | Substantiv (pangngalan) |
| N/X | Substantiv als Stammwort der Wortfamilie |
| N/Ta | Eigenname (pangngalang pantangi) |
| N/Tb | Zusammengesetztes Substantiv (pangngalang pantambalan) |
| ND | Gerundium (pangngaldiwa) |
| ND/G | Perfektives Gerundium (ganap) |
| ND/U | Iteratives Gerundium (pang-ulit) |
| N//D | Als Substantiv gebrauchtes Partizip |
| N//AH | Als Substantiv gebrauchtes Potenzialadverb |
| HT | Personalpronomen (tao) | |
| /I | Singular (isahan) | |
| /M | Plural (maramihan) | |
| TW.HT | NG-Pronomen (Personalpronomen) | |
| HT/K | SA-Pronomen (Personalpronomen) | |
| HP | Demonstrativpronomen (patlig) | |
| TW.HP | NG-Pronomen (Demonstrativpronomen) | |
| TK.HP | SA-Pronomen (Demonstrativpronomen) | |
| HN | Interrogativpronomen (pananong) | |
| HS | Indefinitivpronomen (saklaw) | |
| T | Bestimmungswort (tanda) | |
| TT | Bestimmungswort des Subjekts (tiyak) | |
| TP | Bestimmungswort des Prädikats (panaguri) | |
| TW | Bestimmungswort der Objunktphrase (pantuwid) | |
| TK | Bestimmungswort der Adjunktphrase (pandako) | |
| T0 | Bestimmungswort der Disjunktphrase | |
| L | Ligatur (Bestimmungswort der Subjunktphrase, pariralang panlapag): -ng/na | |
| Y | Artikel (pantukoy) | |
| Y/M | Pluralartikel (pangmaramihan) | |
| Y/Ta | Artikel für Namen (pantangi) | |
| TW.Y | Mit ng verschmolzener Artikel | |
| TK.Y | Mit sa verschmolzener Artikel | |
| O | Präposition (pang-ukol) | |
| OD | Existenzwort (doon) | |
| K | Konjunktion (katnig) | |
| M | Interjektion (padamdam) | |
| /LM | Inhaltswort (pangnilalaman) | |
| /UG | Proklitisches Kurzwort (untaga) | |
| /HG | Enklitisches Kurzwort (hutaga) | |
| P- | Phrase (parirala) | |
| P-..=P-.. | Phrase mit äußerer Identität (links, Funktionsphrase) und innerer Identität (rechts, Inhaltsphrase) {1-6.3 (1)} | |
| P-../L | Unabhängig im Satz stehende Phrase (malaya) | |
| P-T | Subjektphrase (tiyak) | |
| P-P | Prädikatphrase (panaguri) | |
| P-W | Objunktphrase (pantuwid) | |
| P-K | Adjunktphrase (pandako) | |
| P-L | Subjunktphrase (panlapag) | |
| .. L | Vereinfachte Darstellung der Subjunktphrase {5-2 *} | |
| P-0 | Disjunktphrase (0 = Null für ohne Anbindung) | |
| P-0=P-N | Disjunktive Nominalphrase | |
| P-D | Verbphrase (pandiwa) | |
| P-D/B | Untergeordnete Verbphrase von verbundenen Verben (pang-ibaba) | |
| P-N | Nominalphrase (makangalan) | |
| P-ND | Gerundphrase (pangngaldiwa) | |
| P-U | Adjektivphrase (pang-uri) | |
| P-A | Adverbphrase (pang-abay) | |
| P-O | Präpositionalphrase (pang-ukol) | |
| P-OD | Existenzphrase (doon) | |
| GG | Interklit (panggitaga) | |
| GGT | Subjektinterklit (tiyak) | |
| GGW | Objunktinterklit (pantuwid) | |
| GGD | Existenzinterklit (doon) | |
| Die Bestandteile des Interklit können angezeigt werden: {GG../Bezugswort | Enklit | Kernwort} | ||
| GH | Interpotenzial (panggitahil) | |
| GHT | Subjektinterpotenzial (tiyak) | |
| GHW | Objunktinterpotenzial (pantuwid) | |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_susi.html
Stichwörter, die im Inhaltsverzeichnis deutlich zu finden sind, sind hier nicht aufgenommen.
| A | |
| Abgeleitetes Wort {1-7.3 (2)} Adjunktphrase: Vergleich mit Objunktphrase {3-5} Adjunktphrase, Unabhängige {4-4} Adverbialphrase {5-3 (3)} Adverbphrase: Unabhängig im Satz {9-5.3} Affixe sind im Wörterbuch aufgenommen. Affixe der Verben {6-4} Akkusativ {1A-521 Θ} Aktiv und Passiv der Verben {6-3.2} Aktiv - Passiv: Übergange zwischen A. und P. {6-3.3} Anbindung: Teilsätze ohne A. {13-4.1} |
ang: Funktion von ang {2A-102 ang: Adverbiales ANG {2-3.3} ang - ng - sa Paradigma {1A-633 Θ} Argument des Verbs {6-2} Argumentstruktur {6-2 (2)} Argument und Attribut {6A-201 Θ} Artikel {8-6.2} Artikel: Tabelle {8-5} Aspekt: Tempus und A. {6-6.2.5 Θ} Attribut {1-6.2 (2)} Attribut: Eigenschaften {1A-621} Attribut und ergänzte Phrase {5A-201 Θ} Ausführender Täter {6-3.4.2} Austauschbarkeit von sa und ng {3-4} |
| B C D | |
| Bestimmtheit: Fokus und B. {2-3} Bestimmungswort {11-2} Betonung {1-7.3 (4)} Bezugswort von Attribut {1-6.2 (2)} Bezugswort von Kurzwort {11-4.2} Bezugswort von Ligatursatz {13-4.3} Conveyance voice {7-2.1 (4)} |
Deklination: Fehlen von {1A-521 Θ} Demonstrativpronomen: Tabelle {8-5} Direkte Rede {13-2.3.3} Disjunktive Nominalphrase {5-3.1} Duale Identität der Phrase {1-6.3} Dualpronomen kitạ {8-4.5 (2)} |
| E F | |
| Englische Einsprengsel "Taglish" {13-5.2} Erwäger {6-3.4.2} Existenzinterklit {11-6.5} Fachausdrücke, Filipinische {1-1.5} Fähigkeit: Modalität der F. {7A-301} Filipino: Unser Projekt F. {1-1.3}. Filipino: Landesprache {1-1.2}. Finite und infinite Verbformen {6-6 (4)} Flexion der Verben {6-6} Flexionsparadigma {6-6.1} Fokus des Subjekts {1-3} |
Fokus und Bestimmtheit {2-3} Fokus der Verben {6-3} Formaler Stil: Westlicher Stil {13-5.1} Frage: Erfragbare Phrase {12-4} Fremdsprachige Fachausdrücke {1A-151} Fremdsprachliche Einflüsse {1-1.4} Funktion eines Argumentes {6-3.1 (2)} Funktionsphrase {1-2} Funktionsphrasen: Bezeichnung der F. {1A-201} Funktionswort {1-7.1 (2)} |
| G | |
| Gegenwartssprache in den Philippinen {1A-121} Genus der Nomina {8-3.1} Genus verbi {6-3.2} Genus verbi: Verkürzte Verbformen {6A-631 Θ} Gerundium {6-6.5} |
Gerundium: Perfektives G. {6-6.5.1} Gerundium: Iteratives G. {6-6.5.2} Gerundphrasen {5-3.2} Gesprächswörter {9-8} Globale Wirkung des Verbs im Satz {2-4.3} |
| H I | |
| Hilfsverb: Fehlen von H. {6-1} Hilfsverb, modales: Potenzialadverb {9A-612} Hypothetische Aussagen {6-6 (2)} Imperativ {6-6 (2)} Imperativsatz {13-2.1.3} Indefinitpronomen {8-4.3.2} Inflectional phrase {1-6.1 (2)} Inhaltswort {1-7.1 (1)} | Interjektion {9-8} Interklit {11-6} Interpotenzial {9-6.1.1} IPA: Phonetisches Alphabet {1-7.3 (3)} isạ: Unbestimmtes isạ {8-7.2} Iterativer Aspekt {6-6.2.5 Θ} Iteratives Gerundium {6-6.5.2} |
| K L | |
| K-Fokus und K-Funktion {6-3.1 (2b)} Kanonische Reihenfolge von Prädikat und Subjekt {13-2.1.1} Kasus, Fehlen von {1A-521 Θ} Katatapos {6-6.6} Kernwort einer Phrase {1-6.2} Konjunktiv {6-6 (2)} |
Konstruktion: Gebilde. Nach unserer Auffassung werden in der
Sprache Gebilde gebildet und keine Konstruktionen konstruiert.. Konventionelle filipinische Syntax {1-9}. Korpus, Werkstatt-K. {1-1.2 (3)} Kurzwort {1-7.1 (3)} Kurzwort, Enklitisches {11-4} Lautänderung Locative voice {7-2.1 (3)}. |
| M | |
| ma-: Präfixe {7A-111 Θ} mag-: Präfixe mag- und pag- {7-1.3 (6) Θ} mang-: Affix und Lautänderungen {7A-121} mga: Pluralartikel {8-6.3 (3)} |
mga: Adverb {9-4.2 (2)} Modalität der Verben {6-5} Modalwörter: Potenzialadverbien {9-6} Morphologie der Verben {6-4.2 Θ} Morphosyntax {1-8 (4)} Muttersprache {1A-112} |
| N | |
| Nachlaufendes Verhalten des Objunkts {3-1 (3)} nang: Verschiedene Wörter [nʌŋ] {5-3.4} [ ŋ ]: Lautänderung bei Präfixen mit [ ŋ ] {7A-121} Nichtnominales Verhalten von Potenzialadverbien {9-6.1.3} Nomen {8} |
Nominales Verhalten von Potenzialadverbien
{9-6.1.2} Nominalphrase: Disjunktive {5-3.1} Nominalisierung von Nicht-Nomina in der Subjektphrase {2A-102 Nominativ {1A-521 Θ} |
| O P | |
| Objekt {6-2 (2)} Objunktinterklit {11-6.4} Objunktphrase {3} Objunktphrase im Strukturmodell {1-5.2} Objunktphrase: Vergleich mit Adjunktphrase {3-5} pang-: Affix und Lautänderungen {7A-121} Paradigma ang - ng - sa {1A-633 Partikel {1A-701 Partizip {2A-431} Passiv und Aktiv der Verben {6-3.2}. Passiv: Übergange zwischen Aktiv und P. {6-3.3} Passiv: Häufigkeit von Aktiv und P. {6A-321} Patient voice {7-2.1 (2)}. |
Perfektives Gerundium {6-6.5.1} Person-Numerus-Flexion: Fehlen von P. {6-6 (4)} Phrase {1-2} Phrasen und Bestimmungswörter {13-3} Plosiv: Glottaler P. Po [ʔ] {1-7.3 (4)} Po: Glottaler Plosiv Po [ʔ] {1-7.3 (4)} Possessivbeziehungen mit Pronomen {8-4.7} Potenzialadverbien {9-6} Prädikat: Reihenfolge von Pr. und Subjekt {13-2.1 (3)} Prädikat: Tausch von Pr. und Subjekt {2-2.3} Proklitisches Adverb {9-4.2} Pseudopräposition {4-4.2} |
| R | |
| Rechtsverzweigung {1-5.4} Reflexivpronomen {8-4} "Reflexive" Verben {7A-412} Reihenfolge der Argumente von Verben {6-2.4} Reihenfolge von enklitischen Kurzwörtern {11-4.3} |
Reihenfolge von Prädikat und Subjekt {13-2.1 (3)} Regelsatz {13-2.1} Relativsatz {13A-401 |
| S | |
| sa: Austauschbarkeit mit ng {3-4} sa … ng Phrase {4-3.2} SA-Pronomen {8-4.6} Schlüsselsystem {14A} si, sina: Artikel {8-6.2} sing-: Affix und Lautänderungen {7A-121} siya (Adverb bzw. Substantiv) {9A-431} Sprung aus dem Subjekt {11-7} Stammwort {1-7.3} Stil: Westlicher oder formaler Stil {13-5.1} Strukturmodell der filipinischen Syntax {1-3} |
Subjekt {2-2.2} Subjekt im Strukturmodell {1-5.1} Subjekt: Erfragung des S. {12-4.2} Subjekt: Reihenfolge von Prädikat und S. {13-2.1 (3)} Subjekt: Sätze ohne S. {13-2.2.2} Subjekt: Sprung aus dem S. {11-7} Subjekt: Tausch von Prädikat und S. {2-2.3} Subjektinterklit {11-6.3} Subjunkt, Subjunktphrase {5-2} Symmetrie von Prädikat und Subjekt {2-2.4} |
| T | |
| Tagalog 1917 und Filipino 2005 {W Tag-Fil} Taglish {13-5.2} Täter, Darstellung des T. {6-3.5} Tätigkeit: Einfache T. {6-4 (2)} Tausch von Prädikat und Subjekt {2-2.3} |
Teilsatz {13-1.1}
{13A-401 Teilsatz: Verkürzter T. {13-4.4} Tempusflexion der Verben {6-6} Tempus und Aspekt {6-6.2.5 Θ} Transitives usw. Verb {6-2 (2)} |
| U V | |
| Uhrzeit {9-2.8 (5)} Unabhängige Phrase {5-3 (2)} Unbestimmter Artikel isa {8-7.2} Untergeordnete Verbphrasen {6-7.2} Unverträglichkeit mit der Ligatur {5A-221} Veranlasser {6-3.4.2} Verb: Affixe der V. {6-4} Verb: Einfache V. {6-4 (2)} Verb: Globale Wirkung im Satz {2-4.3} Verb: Verbundene V. {6-7.2} Verb: Wortstamm ohne Affixe {6-6.3} |
Verbale Affixe, Funktion der v. A. {6-4.1 Θ}. Verbphrase: 'Inflectional phrase' {1-6.1 (2 Θ)} Verbphrase: Untergeordnetes V. {6-7.2} Verneinung {9-7}. Vollverb {2-4.3} |
| W Z | |
| wala, walang {10-4} Werkstatt-Korpus {1-1.2 (3)} Werkstatttexte {16A-2} Westlicher Stil {13-5.1} Wortart {1-7} Wortart: Konventionelle {1-7.2} |
Wortart: Syntaktische {1-7.1} Wortfamilie {1-7.3} Wortstamm {1-7.3} Wortstamm ohne Affixe als Verbform {6-6.3}. Zeiformen der Verben {6-1} Zusammengesetzter Satz {13-1.1} |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_sach.html
{![]() Aganan 1999}
Fernanda P. Aganan, Paulina B. Bisa, Wilfreda J. Legaspi, Carmelita S. Lorenzo, Fe Laura
R. Quetua, Anatalia G. Ramos, Vilma M. Resuma, Teresita P. Sermolan: Sangguniang
Gramatika ng Wikang Filipino
Aganan 1999}
Fernanda P. Aganan, Paulina B. Bisa, Wilfreda J. Legaspi, Carmelita S. Lorenzo, Fe Laura
R. Quetua, Anatalia G. Ramos, Vilma M. Resuma, Teresita P. Sermolan: Sangguniang
Gramatika ng Wikang Filipino
Quezon City 1999.
ISBN 971-8781-50-1. Siehe auch {W Aganan}.
{![]() Alcantara 2006}
Alcantara, Teresita A.: Ang mga hispanismo sa Filipino at ang makabagong Filipino
Alcantara 2006}
Alcantara, Teresita A.: Ang mga hispanismo sa Filipino at ang makabagong Filipino
Ika-9 na Kongreso ng Linggwistika sa Pilipinas, Enero 25-27, 2006, UP Diliman. Siehe auch
{W Alcantara 2006}.
{![]() Bloomfield 1917}
Bloomfield, Leonard: Tagalog Texts with Grammatical
Analysis
Bloomfield 1917}
Bloomfield, Leonard: Tagalog Texts with Grammatical
Analysis
Urbana 1917: The Univ. of Illinois (University of Illinois Studies in Language and
Literature Vol.III 2-4).
{![]() Castle 2000}
Corazon Salvacion Castle, Laurence Mcgonnell: Tagalog
Castle 2000}
Corazon Salvacion Castle, Laurence Mcgonnell: Tagalog
London 2000/2006. ISBN 0-340-87101-0
{![]() Constantino 1996} Pamela C. Constantino, Monico M. Atienza
(ed.): Mga piling Diskurso sa Wika at Lipunan
Constantino 1996} Pamela C. Constantino, Monico M. Atienza
(ed.): Mga piling Diskurso sa Wika at Lipunan
Quezon City 1996. ISBN 971-542-064-8
{![]() Duden Gr}
Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
Duden Gr}
Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
Mannheim 1998,
ISBN 3-411-04046-7
{![]() Himmelmann 1987}
Himmelmann, Nikolaus jr.: Morphosyntax und Morphologie -
Himmelmann 1987}
Himmelmann, Nikolaus jr.: Morphosyntax und Morphologie -
Die Ausrichtungsaffixe im Tagalog
München 1987. ISBN 3-7705-2493-4
{![]() Himmelmann 2004}
Himmelmann, Nikolaus P.: How to miss a paradigm or two: Multifunctional ma- in
Tagalog
Himmelmann 2004}
Himmelmann, Nikolaus P.: How to miss a paradigm or two: Multifunctional ma- in
Tagalog
pdf-file, July 2004
To appear in: F. Ameka, A. Dench, and N. Evans (eds) Catching Language, Berlin:
Mouton de Gruyter.
{![]() Himmelmann 2005} Himmelmann, Nikolaus P.: Tagalog
Himmelmann 2005} Himmelmann, Nikolaus P.: Tagalog
In: K. Alexander Adelaar and Nikolaus P. Himmelmann (eds), The Austronesian
Languages of Asia and Madagascar
London 2005, pp. 350-376.
{![]() Humboldt}
Humboldt, Wilhelm v.: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes
Humboldt}
Humboldt, Wilhelm v.: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes
1836 / Darmstadt 1963
in Schriften zur Sprachphilosophie, herausgegeben von A. Flitner
/ K. Giel (Werke in fünf Bänden, Band 3, pp. 368-756).
{![]() Katagiri 2006}
Katagiri, Masumi: Topichood of the Philippine topic
Katagiri 2006}
Katagiri, Masumi: Topichood of the Philippine topic
10-ICAL, Puerto Prinsesa, Philippinen, 2006.
{![]() Kroeger 1991}
Kroeger, Paul R.: Phrase structure and grammatical relations in Tagalog
Kroeger 1991}
Kroeger, Paul R.: Phrase structure and grammatical relations in Tagalog
Ph.D. thesis. Stanford University, USA, 1991.
{![]() LJE} English, Leo James: Tagalog-English
LJE} English, Leo James: Tagalog-English
Manila 1986/1995. ISBN 971-08-4465-2
English-Tagalog
Mandaluyong City 1977/2003. ISBN 971-08-1073-1.
{![]() Lopez 1925/1970}
Lopez, Cecilio: On the Boak Tagalog of the Island of Marinduque
Lopez 1925/1970}
Lopez, Cecilio: On the Boak Tagalog of the Island of Marinduque
The Archive (New Series) 1 (2): 1-52 (1970)
"Originally submitted as a paper in a class in Philippine Linguistics under Otto Scherer
in 1925, College of Liberal Arts, University of the Philippines."
In Constantino, Ernesto: Selected Writings of Cecilio Lopez in Philippine
Linguistics
Diliman, Quezon City 1977. Siehe auch {W Boak}.
{![]() Lopez 1940} Lopez, Cecilio: The Tagalog
Language: An Outline of Its Psychomorphological Analysis
Lopez 1940} Lopez, Cecilio: The Tagalog
Language: An Outline of Its Psychomorphological Analysis
Manila 1940.
In Constantino, Ernesto: Selected Writings of Cecilio Lopez in Philippine
Linguistics
Diliman, Quezon City 1977.
{![]() Lopez 1941}
Lopez, Cecilio: A Manual of the Philippine National Language
Lopez 1941}
Lopez, Cecilio: A Manual of the Philippine National Language
Manila 1941.
{![]() NIU}
NIU: Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA
NIU}
NIU: Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA
Center for Southeast Asian Studies
Web-Site Tagalog
http://www.seasite.niu.edu/tagalog/Tagalog_mainpage.htm
{![]() Nolasco 2006}
Nolasco, Ricardo Ma.: Ano ang S, A at O sa mga Wika sa Pilipinas
Nolasco 2006}
Nolasco, Ricardo Ma.: Ano ang S, A at O sa mga Wika sa Pilipinas
Ika-9 na Kongreso ng Linggwistika sa Pilipinas, Enero 25-27, 2006, UP Diliman. Siehe auch
{W Nolasco 2006}.
{![]() Oxford}
The Concise Oxford Dictionary
Oxford}
The Concise Oxford Dictionary
Oxford, Great Britain 1995. ISBN 0-19-861319-9
{![]() Paz 2003}
Consuela J. Paz, Viveca V. Hernandez, Irma U. Peneyra: Ang Pag-aaral ng
Wika
Paz 2003}
Consuela J. Paz, Viveca V. Hernandez, Irma U. Peneyra: Ang Pag-aaral ng
Wika
Quezon City 2003. ISBN 971-542-374-4
{![]() Perdon 2003}
Perdon, Renato: Making out in Filipino
Perdon 2003}
Perdon, Renato: Making out in Filipino
Boston, USA 2003. ISBN 0-8048-3373-7, 0-8040-3564-0
{![]() Ramos 1985}
Ramos, Teresita V.: Conversational Tagalog
Ramos 1985}
Ramos, Teresita V.: Conversational Tagalog
Honolulu, USA 1985. ISBN 0-8248-0944-0
{![]() Romero 2004}
Romero, Victor Eclar: Learn Filipino
Romero 2004}
Romero, Victor Eclar: Learn Filipino
Vol. 1: Atlanta GA, USA 2004. ISBN 1-932956-41-2
Vol. 2: Atlanta GA, USA 2007. ISBN 1-932956-42-9
Website http://www.tagalog1.com
{![]() Santiago 2003 B}
Alfonso O. Santiago, Norma G. Tiangco: Makabagong Balarilang
Filipino
Santiago 2003 B}
Alfonso O. Santiago, Norma G. Tiangco: Makabagong Balarilang
Filipino
Maynila 2003, ISBN 971-23-3681-6
Siehe auch {W Santiago 2003-B}.
{![]() Schachter 1972}
Paul Schachter, Fe T. Otanes: Tagalog Reference Grammar
Schachter 1972}
Paul Schachter, Fe T. Otanes: Tagalog Reference Grammar
Berkeley, USA 1972. ISBN 0-520-01776-5
{![]() SS}
Vito C. Santos, Luningning E. Santos: New Vicassan's English-Pilipino Dictionary
SS}
Vito C. Santos, Luningning E. Santos: New Vicassan's English-Pilipino Dictionary
Manila 1995/2001. ISBN 971-27-0349-5
{![]() UPD}
V. S. Almario et al.: UP Diksiyonaryong Filipino
UPD}
V. S. Almario et al.: UP Diksiyonaryong Filipino
Quezon City 2001. ISBN 971-8781-986
{![]() VCS}
Santos, Vito C.: Vicassan's Pilipino-English Dictionary
VCS}
Santos, Vito C.: Vicassan's Pilipino-English Dictionary
Manila 1978/86. ISBN 971-08-2900-9
{![]() Villanueva
1968/1998} Antonia F. Villanueva, Federico B. Sebastian: Pampaaralang
Balarila ng Wikang Pambansa
Villanueva
1968/1998} Antonia F. Villanueva, Federico B. Sebastian: Pampaaralang
Balarila ng Wikang Pambansa
Quezon City 1968/1998, 4 Bände, ohne ISBN.
Die oben angegebenen Autoren beziehen sich auf Band 1 - 3.
Autoren von Band 4: F.B. Sebastian, B. Del Valle, A.F. Villanueva
Die mit {W …} gekennzeichneten Texte sind Bestandteil des Werkstatt-Korpus und sind auf meiner Webseite on-line zugänglich unter http://www.germanlipa.de .
| {W Aesop} {W Äsop} |
Custodio, R. M.: Pabula: Isang Makabagong Koleksyon Valenzuela, Metro Manila, 1996. Zitiert nach NIU: Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA. Center for Southeast Asian Studies Web-Site Tagalog http://www.seasite.niu.edu/tagalog/Tagalog_mainpage.html . |
| {W Aganan} | Aganan, Fernanda P. et al.: Sangguniang Gramatika ng Wikang Filipino. ausrücken fehlt
{ |
| {W Alcantara 2006} | Alcantara, Teresita A.: Ang mga hispanismo sa Filipino at ang
makabagong Filipino. { |
| {W Almario 2006} | Almario, Virgilio, S.: Pag-unawa sa Ating Pagtula Pasig City 2006. ISBN 971-27-1781-X. |
| {W Almario 2007} | Almario, Virgilio, S.: Bakit Kailangan ng Filipino ang Filipino? Liwayway, Manila, 10 Disyembre 2007, p. 30. ISSN 1656-98-14. |
| {W Ambrosio 2006} | Ambrosio, Dante L.: Sandaigdigan at Kalangitan: Katutubong Larawan, Katutubong
Pangalan Ika-9 na Kongreso ng Linggwistika sa Pilipinas, 25-27 Enero 2006, UP Diliman. |
| {W Anak ng Lupa} | Landicho, Domingo G.: Anak ng Lupa Quezon City 2005. ISBN 971-550-175-5. |
| {W Angara 2012} | Angara, Rommel N. Paano naiiba sa mga pag-aaklas sa ibang bansa ang rebolusyong
people power sa Pilipinas Liwayway, 27 Pebrero 2012. |
| {W Angela} | Almena, Omer Oscar B.: Angela Liwayway, 22 Setyembre 2008. |
| {W Aquino 2010} | Aquino, Benigno: Talumpati sa pagtanggap ng tunkulin (30 Hunyo 2010) Philippine Daily Inquirer 30 June 2010. |
| {W Arrivederci} | Villanueva, Bella M.: Arrivederci Liwayway, 15 Oktubre 2007. |
| {W Bestechung} | Bestechung als Wirtschaftszweig in Entwicklungsländern Aufsatz von Werner Kottmann, 2001 |
| { |
Ang Banal na Kasalutan Maynila 2004, ISBN 971-29-0103-3. |
| {W Boak} | Lopez, Cecilio: On the Boak Tagalog of the Island of Marinduque
{ |
| {W Bulaklak} | Landicho, Domingo G.: Bulaklak ng Maynila Quezon City 1995/2004. ISBN 971-550-177-x. |
| {W Busilak} | Gonzales, Lei de Chaves: Si Busilak (Schneewittchen), 2005. |
| {W Cao 2013} | Cao, Sergio S.: Wikang Filipino bilang Wika ng Pananaliksik Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Vol. 19 No. 1 (2013) pp. 108-118. |
|
{ |
Ching, Desiderio: Ang Munting Prinsipe Übersetzung von Antoine de Saint-Exupery: Le Petit Prince Diliman, Quezon City 1991. ISBN 971-501-488-7. |
| {W Daluyong} | Francisco, Lazaro: Daluyong Quezon City 1986. ISBN 971-550-166-4. |
| {W Damaso} | Austria, LN: Kalye Damaso, Liwayway, 09 Enero 2006. |
| {W Dasal} | Coraza, Michael M.: Unang Limbag na Salin sa Tagalog ng Popular na Dasal
Katoliko Liwayway, 04 Oktubre 2010. |
| {W Dayuhan} | Medina, Buenaventura S.: Dayuhan Kurzgeschichte in Paquito B. Badayos et al.: Kulintang - Interaktibong Aklat sa Filipino IV Pasig City 1999. ISBN 971-27-0718-0. |
| {W DC} | Doctrina Christiana, en lengua españa
y tagala Manila 1593. Facsilimile-Ausgabe Manila 1991, ISBN 971-538-013-1. |
| {W Estranghera} | Reymundo, Jeselle More Anne B.: Estranghera Liwayway, 22 Oktubre 2007. |
| {W Gapos sa Puso} | Patron, Elena M.: Gapos sa Puso Liwayway, 04 Hulyo 2005. |
| {W Gubat} | Ong, Bob: Alamat ng Gubat Pasay City 2004. ISBN 971-92574-1-5. |
| {W Halina} | Valera, Leonora P.: Halina't Magsaya Audio-CD Alpha ARCD-2K5-8229 |
| {W Hibik} | Bonifacio, Andres: Katapusang Hibik ng Pilipinas Quelle: { |
| {W Javier} | Javier, E.Q.: Diksiyonaryong Filipino sa Bagong Milenyum Einleitung in { |
|
{ |
Jocano, F. Landa: Filipino Value System Quezon City 1997, ISBN 971-622-004-9 . |
| {W Kanta} | Lieder und Schlager |
| {W Karla} | Bartolome, Denzelle: I Hate You, My Love Maynila 2004, ISBN 971-02-1671-6 Der Roman gehört zur Gruppe Tagalog Romance. |
| {W Katesismo} | Katesismo Para sa mga Pilipinong Katoliko Manila 2007, ISBN 971-0307-86-X Übersetzung des Catechism for Filipino Catholics der Catholic Bishops' Conference of the Philippines.. |
|
{ |
Kintanar, Thelma B. et al: Cultural Dictionary for Filipinos Quezon City 1996, ISBN 971-542-082-6 . |
| {W Krus} | Claridades, Ana Rolina D.: Laruang Krus Liwayway, 16 Hulyo 2007. |
| {W Kung saan} | Bautista, Clemen M.: Kung Saan Ka Naroon Liwayway, 02 Marso 2008. |
|
{ {W Liwayway} |
Liwayway "Nangungunahang linguhang magasin pantahanan sa bansa. Inilalathala tuwing Lunes ng Manila Bulletin Publishing Corporation." Führende wöchentlich erscheinende Hauszeitschrift des Landes. Erscheint jeden Montag bei Manila Bulletin Publishing Corporation. Seit 1925 (oder früher). |
| {W Lopez 1940} | Quelle: { |
| {W Lunsod} | Gonzales, M.V.M.: Lunsod, Nayon at Dagat-dagatan Aus: Mag-atas, Rosario U. et al.: Panitikang Kayumanggi Mandaluyong 1994, ISBN 971-08-5654-5. Herausgegeben von Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. |
| {W Madaling Araw} | Aguilar, Dheza Maria: Madaling Araw Liwayway, 05 Disyembre 2005. |
| {W Manunulat} | Rubin, Ligaya Tiamson: Ang mga Manunulat sa Panahon ng Americano Liwayway, 10 Oktubre 2005. |
| {W Material Girl} | Sto. Domingo, Rubie B.: Material Girl Liwayway, 24 Oktubre 2005. |
| {W Matematika} | Tangco, Jesufa T. et al.: Matematika para sa pankalahatang edukasyon Quezon City 2002. ISBN 971-8781-48-X. |
| {W Mumo} | Cruz, Genaro R. G.: Mumu sa Bintana Liwayway, 06 Hunyo 2005. |
| {W Naglaho} | Almario, Salvador C.: Naglaho Man Ang Pag-Ibig Liwayway, 02 Hunyo 2008. |
| {W Nanyang} | Bai, Ren: Nanyang piaoliuji (Roman in chinesischer Sprache) Übersetzung in Filipino von Sy, Joaquin: Lagalag sa Nanyang Quezon City 2007. ISBN 978-971-542-535-3. |
| {W Nolasco 2006} | Nolasco, Ricardo Ma.: Ano ang S, A at O sa mga wika ng Pilipinas?
{ |
| {W Pagbabalik} | Manzano, Leah D.: Pagbabalik, Liwayway, 26 Enero 2010. |
| {W Piso} | Cheathom, Rhia L.: Piso Liwayway, 05 Pebrero 2007. |
| {W Plano} | Coraza, Michael M.: Pagpaplanong Pangwika sa Filipinas Liwayway, 15 Nobyembre 2010. |
| {W Prutas} | Antonio, Billy T.: Si Apo Dakkel at ang Labingdalawang Bilog na Prutas Liwayway, 09 Enero 2006. |
| {W Regine} | Gonzales, Vir: Ang Tunay na Pagkatao ni Regine Velasquez Liwayway, 21 Nobyembre 2005. |
| {W Rica} | Alip, Nap C.: Jolina, Rica: May Feud ba Hanggang Ngayon? Liwayway, 04 Hulyo 2005. |
| {W Pag-ibig ni Rizal} | Bautista, Clemen M.: Ang una at huling pag-ibig ni Dr. Jose P. Rizal Liwayway, 23 Hunyo 2008. |
| {W Rosas} | Lahan, Virgie Guyguyon: Tanungin mo ang mga Rosas Liwayway, 25 Setyembre 2006. |
| {W Sabong} | Hidalgo, Antonio A.: Ang Masayang Mundo ni Nestor D. Quezon City 2001. ISBN 971-828-010-3. |
| {W Salazar 1996} | Salazar, Zeus A.: Ukol sa Wika at Kulturang Pilipino Aus Pamela C. Constantino at Monico M. Atienza: Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan, Lunsod Quezon 1996 ISBN 971-542-064-8, pp. 19-45. |
| {W Samadhi} | Tumbaga, Ronald Fababier: Si Samadhi At Ang Kayamanan Sa Dulo Ng Bahaghari Liwayway, 22 Mayo 2006. |
| {W Santiago 2003-B} | Alfonso O. Santiago, Norma G. Tiangco: Makabagong Balarilang Filipino
{ |
| {W Simo} | Dionela, Edgar G.: Simo - Ayos Lang Quezon City 2002, ISBN 971-10-1068-2. |
| {W Aman Sinaya} | Pluma, Kir: Aman Sinaya Website Wattpad, Philippine Mythology. https://www.wattpad.com/902938622-philippine-mythology-aman-sinaya |
| {W Sprache} | Sprache und Gesellschat in den Philippinen Aufsatz von Armin Möller, 2008. |
| {W Supot} | Rubin, Ligaya Tiomson: Supot - Praktikal na Sisidlan ng Halos Kahit Ano Liwayway, 06 Hunyo 2005. |
| {W Suyuan} | Baylon, Estrelito: Suyuan sa Bisikleta Liwayway, 27 Hunyo 2005. |
| {W SWF} | Kasaysayan ng Sentro ng Wikang Filipino - UP Diliman https://sentrofilipino.upd.edu.ph/tungkol-sa-swf/kasaysayan-ng-swf/ |
| {W Thomas} | Projekt Thomas oder die Sprache in den Philippinen Aufsatz von Armin Möller, Februar 2003 |
| {W Tiongson} | Tiongson, N.G.: Kung Baga sa Kaban (1985) Einführung in Rosario Torres-Yu, Lilia F. Antonio, Ligaya Tiamson-Rubin: Talinghagang Bukambibig Pasig City 1999, ISBN 971-27-0788-1. |
| {W Tiya Margie} | Manzano, Leah D.: Si Tiya Margie Liwayway, 19 Enero 2009. |
| {W Uhaw} | Arceo, Liwayway A.: Uhaw ang Tigang na Lupa (1943). Aus: Lumbera, Bienvenido; Barrios, J.; Tolentino, R.B.; Villanueva R.O.: Paano magbasa ng Panitikang Filipino Quezon City 2000/2006. ISBN 971-542-284-5. |
| {W Ulan} | Sicat, Ellen: Unang Ulan ng Mayo Pasig City 2009, ISBN 978-971-27-2065-9. |
| {W Unawa} | Catungal, Nova: Pang-unawa Liwayway, 12 Disyembre 2005. |
| {W Unggoy} | L. Bloomfield (1917) / K. Saguid (2005): Unggoy at Pagong. |
Diese Studien sind Bestandteil des Werkstatt-Korpus und sind auf meiner Webseite on-line zugänglich unter http://www.germanlipa.de .
| {W Akt-Pass} | Häufigkeit von Aktiv und Passiv in der filipinischen Sprache |
| {W Hulaping an} | Pangngalang may hulaping -an |
| {W Betrachtungen} | Betrachtungen zur filipinischen Sprache |
| {W Bestechung} | Bestechung als Wirtschaftszweig |
| {W Einf Verb} | Syntax der einfachen Verben |
| {W Gesellschaft} | Sprache und Gesellschaft in den Philippinen |
| {W Phrasen} | Funktionsphrasen statt Nominalphrasen |
| {W Phrasen 2} | Statistische Untersuchung der Häufigkeit von Funktions- und Inhaltsphrasen (Fragment) |
| {W Possessiv} | Possessivbeziehungen in der filipinischen Sprache |
| {W PT} | Prädikat und Subjekt in der filipinischen Sprache |
| {W PT_TP} | Statistische Untersuchung der Reihenfolge von Prädikat und Subjekt im filipinischen Satz |
| {W Silbe 3/4} | Drei- und viersilbige Wortstämme in der filipinischen Sprache (Fragment) |
| {W Stat Phon} | Statistik in der filipinischen Phonologie |
| {W Tag-Fil} | Tagalog 1917 und Filipino 2005 |
| {W Taglish} | Englische Einsprengsel in der filipinischen Sprache |
09. Aug. 2022 06:55:37 Ende der Datei www/filipino/sy_sangguni.html